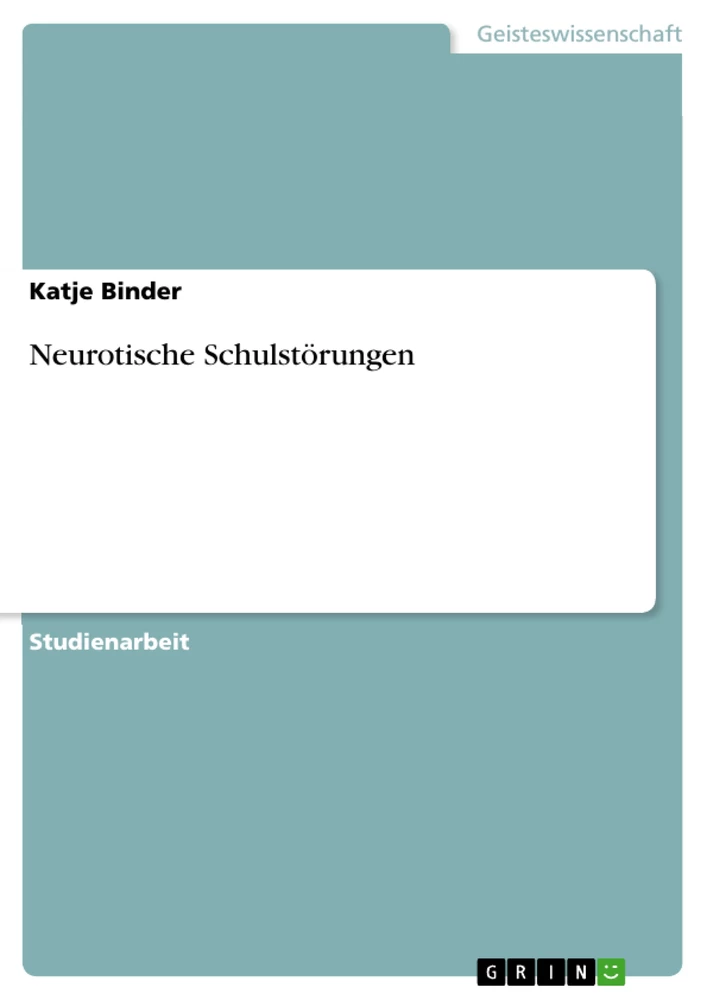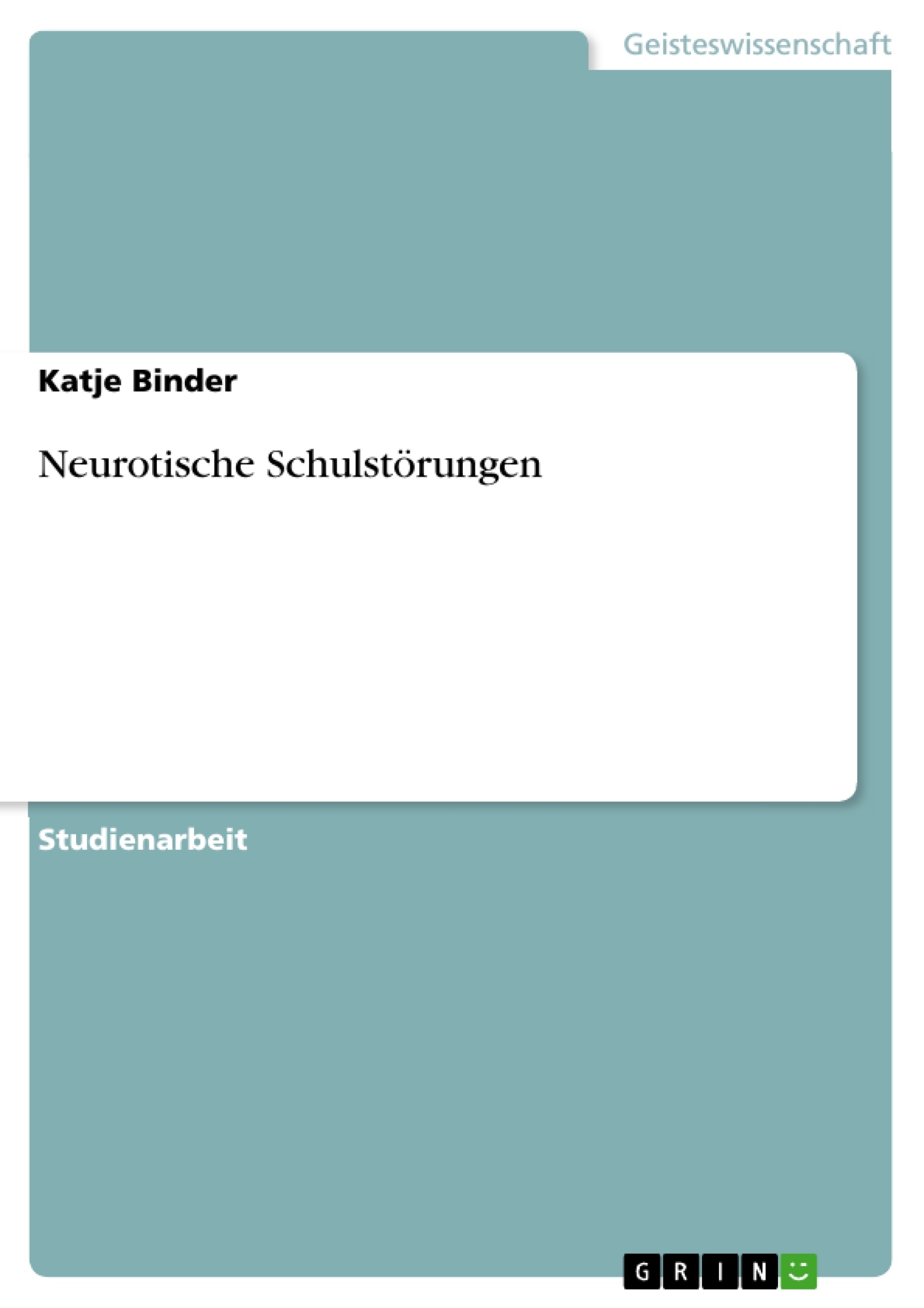Einleitung
Ein siebenjähriges Mädchen fällt seiner Lehrerin auf, weil es sich nicht konzentrieren kann. Die Eltern bemerken, daß das Kind blaß ist und morgens über Bauchschmerzen klagt. Es schläft sehr schwer ein und rechnet laut im Schlaf. Es onaniert häufig, zeitweise täglich. Das Mädchen ist kontaktunfähig, weint leicht und verhält sich Erwachsenen gegenüber sehr gefügig. Zu dieser Symptomatik kommt eine extreme Ängstlichkeit, die es dem Kind unmöglich macht, z.B. bei
geschlossener Zimmertür einzuschlafen.(1)
Was führt zu einer derartigen Störung ? Welche Faktoren treffen bei diesem Kind aufeinander, um es so reagieren zu lassen ? Wie kann ihm geholfen werden ? Diese Arbeit befaßt sich mit einem Phänomen, das überzufällig häufig an den Schulen auftritt:
Schüler können bei mittlerer bis guter Intelligenz nicht lernen, obwohl ihr Entwicklungsstand und der Intelligenzquotient es vermuten ließen, daß sie das Klassenziel erreichen könnten. Wir haben
es hier mit einer psychogenen Lernstörung zu tun, die durch Gehemmtheiten in bestimmten Antriebsbereichen den Menschen daran hindert, seine Fähigkeiten voll auszuleben. Als Grundlage haben mir zu dieser Arbeit A. Dührssens „Psychogene Erkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen“ sowie die Aufsätze „Psychisch bedingte Lernstörungen im Kindesund Jugendalter“ von K. Singer und „Neurotische Kinder und ihre Familien“ von E.v.Strachwitz
gedient. Für das Verständnis der Psychodynamik der Neurose im Allgemeinen und der Lernhemmung im Besonderen zog ich S. Mentzos, „Neurotische Konfliktverarbeitung“ und G. Wunderlichs
Werk „Neurosen“ heran. Diese Literatur ist die Grundlage des zweiten Kapitels, das sich einleitend mit den Voraussetzungen für die Entstehung solcher Störungen vor dem Hintergrund der frühkindlichen Entwicklung befaßt.
[...]
_____
1 Vgl. Singer 1970, S..254f
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung neurotischer Störungen
- 2.1 Phasen der kindlichen Entwicklung und ihre Bedeutung
- 2.1.1 Die orale Phase
- 2.1.2 Entstehung der intentionalen Störung
- 2.1.3 Phase der handelnden Weltbewältigung
- 2.1.4 Phase der theoretischen Weltbewältigung
- 3. Die psychogene Lernhemmung
- 3.1 Zwei Beispiele
- 3.2 Erscheinungsbild des lerngehemmten Kindes
- 3.3 Psychodynamik der Lernhemmung
- 3.4 Die Eltern als Hauptverursacher der Neurose
- 3.5 Schule - Brutstätte gestörten Verhaltens?
- 4. Therapie
- 4.1 Spieltherapie
- 4.2 Beratung der Eltern
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht psychogene Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Sie zielt darauf ab, die Entstehung solcher Störungen im Kontext der frühkindlichen Entwicklung zu verstehen und mögliche Therapieansätze aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert anhand von Fallbeispielen, wie psychische Faktoren zu Lernhemmungen führen können.
- Entstehung neurotischer Störungen im Kindesalter
- Bedeutung der frühkindlichen Entwicklung für die Entstehung von Lernhemmungen
- Psychodynamik der Lernhemmung
- Rolle der Eltern und der Schule bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung
- Mögliche Therapieansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Fall eines siebenjährigen Mädchens vor, das unter starken Konzentrationsschwierigkeiten, Ängsten und psychosomatischen Beschwerden leidet. Diese Fallbeschreibung dient als Ausgangspunkt für die Untersuchung psychogener Lernstörungen, die trotz durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher Intelligenz das Lernen behindern. Die Arbeit konzentriert sich auf die psychogenen Ursachen dieser Lernhemmungen und mögliche therapeutische Interventionen.
2. Entstehung neurotischer Störungen: Dieses Kapitel beleuchtet die allgemeinen Prozesse, die zur Entstehung neurotischer Störungen führen. Es wird der Einfluss der frühkindlichen Entwicklung und insbesondere der ersten Lebensjahre hervorgehoben, in denen Konflikte mit Bezugspersonen, wie der Mutter, zu einer Verdrängung von Impulsen und Wünschen führen können. Die ständige Mikrotraumatisierung durch wiederholte Ablehnung oder Liebesentzug wird als wichtiger Faktor für die Entwicklung neurotischer Symptome beschrieben. Das Kapitel betont die Bedeutung der emotionalen Umgebung in der frühen Kindheit für die spätere psychische Gesundheit.
3. Die psychogene Lernhemmung: Dieses Kapitel befasst sich mit der psychogenen Lernhemmung selbst. Anhand von zwei Fallbeispielen (Anne und Marco) werden die Symptome und die psychodynamischen Hintergründe dieser Störung detailliert untersucht. Es wird die Rolle der Eltern als Hauptverursacher der Neurose und die mögliche Bedeutung der Schule als Verstärker gestörten Verhaltens diskutiert. Die Analyse der Fallbeispiele verdeutlicht den komplexen Zusammenhang zwischen frühkindlichen Erfahrungen, emotionalen Konflikten und der Ausprägung von Lernhemmungen.
4. Therapie: Das Kapitel skizziert mögliche Therapieansätze für psychogene Lernstörungen. Im Fokus stehen Spieltherapie und die Beratung der Eltern. Die Ausführungen basieren auf den in den vorherigen Kapiteln dargestellten Fallbeispielen und betonen die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, der die individuellen Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie berücksichtigt. Die Notwendigkeit der Elternberatung wird aufgrund ihres Einflusses auf die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Psychogene Lernstörung, frühkindliche Entwicklung, Neurose, Lernhemmung, Spieltherapie, Elternberatung, psychodynamische Konfliktverarbeitung, Mikrotraumatisierung, Fallbeispiele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Psychogene Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht psychogene Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert die Entstehung solcher Störungen im Kontext der frühkindlichen Entwicklung und beschreibt mögliche Therapieansätze. Anhand von Fallbeispielen wird gezeigt, wie psychische Faktoren zu Lernhemmungen führen können.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung neurotischer Störungen im Kindesalter, die Bedeutung der frühkindlichen Entwicklung für Lernhemmungen, die Psychodynamik der Lernhemmung, die Rolle der Eltern und der Schule, und mögliche Therapieansätze wie Spieltherapie und Elternberatung.
Welche Phasen der kindlichen Entwicklung werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die orale Phase, die Entstehung intentionaler Störungen, die Phase der handelnden Weltbewältigung und die Phase der theoretischen Weltbewältigung im Hinblick auf ihren Einfluss auf die Entstehung neurotischer Störungen.
Wie wird die Entstehung neurotischer Störungen erklärt?
Die Entstehung neurotischer Störungen wird im Kontext frühkindlicher Entwicklung und der Interaktion mit Bezugspersonen erklärt. Konflikte, wiederholte Ablehnung oder Liebesentzug (Mikrotraumatisierung) in den ersten Lebensjahren führen zu Verdrängung von Impulsen und Wünschen und können die Entwicklung neurotischer Symptome begünstigen.
Welche Rolle spielen die Eltern?
Die Eltern werden als Hauptverursacher der Neurose gesehen. Ihr Einfluss auf die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung wird hervorgehoben, daher ist die Elternberatung ein wichtiger Bestandteil der Therapie.
Welche Rolle spielt die Schule?
Die Arbeit diskutiert die mögliche Bedeutung der Schule als Verstärker gestörten Verhaltens.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt Spieltherapie und Elternberatung als mögliche Therapieansätze für psychogene Lernstörungen. Ein ganzheitlicher Ansatz, der die individuellen Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie berücksichtigt, wird betont.
Welche Fallbeispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die Fallbeispiele von Anne und Marco, um die Symptome und psychodynamischen Hintergründe der psychogenen Lernhemmung detailliert zu untersuchen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Psychogene Lernstörung, frühkindliche Entwicklung, Neurose, Lernhemmung, Spieltherapie, Elternberatung, psychodynamische Konfliktverarbeitung, Mikrotraumatisierung, Fallbeispiele.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur Entstehung neurotischer Störungen, der psychogenen Lernhemmung, Therapieansätzen und einem Literaturverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis erleichtert die Navigation.
- Arbeit zitieren
- Katje Binder (Autor:in), 1996, Neurotische Schulstörungen, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/2286