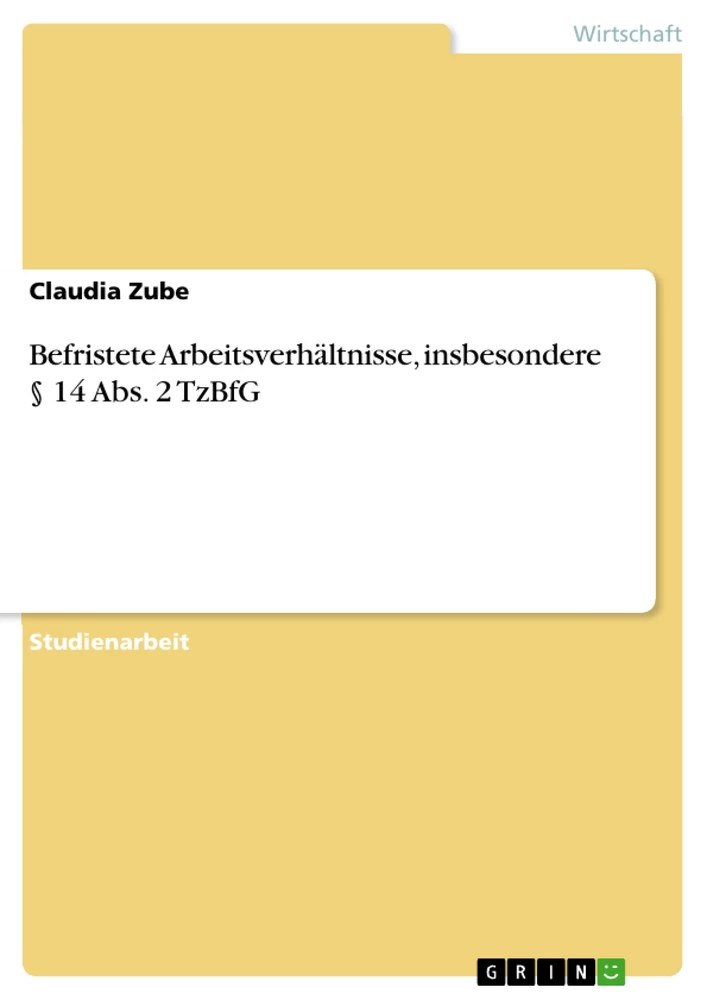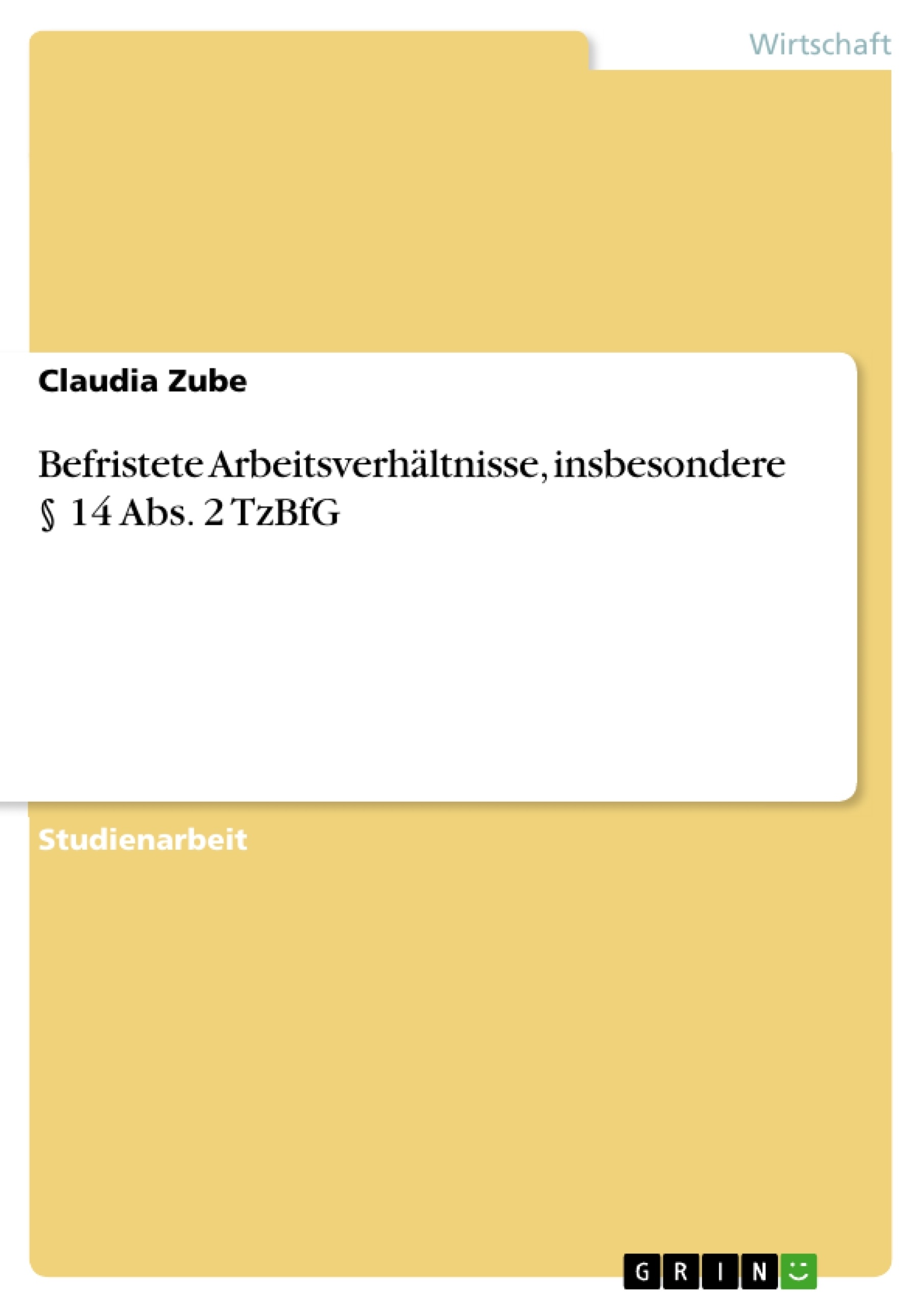Inhaltsverzeichnis:
1 BEGRIFF DES BEFRISTET BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMERS 1
2 ZULÄSSIGKEIT DER BEFRISTUNG 1
2.1 BEFRISTUNG AUS SACHLICHEM GRUND 1
2.2 BEFRISTETE VERTRÄGE OHNE SACHLICHEN GRUND 3
3 BLICK ZURÜCK – WIE KAM ES ZUM § 14 ABS. 2 TZBFG? 3
4 SINN UND ZWECK – WAS WILL DER GESETZGEBER ERREICHEN? 4
5 INHALT DES § 14 ABS. 2 TZBFG – BEFRISTUNG OHNE SACHLICHEN GRUND 4
6 ERLÄUTERUNGEN 5
6.1 GRENZEN 5
6.2 SCHRIFTFORM 5
6.3 WAS PASSIERT BEI UNZULÄSSIGER BEFRISTUNG? 6
6.4 KEINE BENACHTEILIGUNG WEGEN BEFRISTUNG 7
6.5 WIRKSAME VERLÄNGERUNG DES BEFRISTETEN ARBEITSVERHÄLTNISSES 8
6.6 BEENDIGUNG BEFRISTETER ARBEITSVERHÄLTNISSE 8
6.7 KÜNDIGUNG DES BEFRISTETEN ARBEITSVERTRAGES 9
6.8 INFORMATIONSPFLICHT DES ARBEITGEBERS ÜBER UNBEFRISTETE ARBEITSPLÄTZE 9
6.9 INFORMATION DER ARBEITNEHMERVERTRETUNG 9
6.10 AUS- UND WEITERBILDUNG 9
6.11 GLÜCKSFÄLLE FÜR DEN ARBEITNEHMER 9
7 BLICK IN DIE PRAXIS 10
7.1 SIND DIE ZIELE ERREICHT WORDEN? 10
7.2 VOR- UND NACHTEILE FÜR DEN ARBEITGEBER 10
7.3 VOR- UND NACHTEILE FÜR DEN ARBEITNEHMER 11
8 KRITIK UND FAZIT 12
9 WAS JETZT? BLICK IN DIE ZUKUNFT 12
1 Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers
Laut § 3 Abs. 1 TzBfG ist der Begriff der befristet beschäftigten Arbeitnehmers wie folgt definiert: “§ 3 Begriff des befristet Beschäftigten Arbeitnehmers. (1) 1Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit geschlossenen Arbeitsvertrag. 2Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag (befristeter Arbeitsvertrag) liegt vor, wenn seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist (kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag) oder sich aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag).“
2 Zulässigkeit der Befristung
Die Zulässigkeit der Befristung eines Arbeitsvertrages ist in § 14 TzBfG geregelt. Dieser kennt zwei Fälle: a) Für die Befristung gibt es einen „sachlichen Grund“. b) Die Befristung erfolgt ohne sachlichen Grund, jedoch wird ein Zeitraum von zwei Jahren bei maximal dreimaliger Verlängerung nicht überschritten. Auch muss es sich um eine „Neueinstellung“ handeln, d. h. der Arbeitnehmer darf vorher nicht beim selben Arbeitgeber tätig gewesen sein.
[...]
---
(1) grundlegend: BAG, AP Nr. 16 zu § 620 BGB befristeter Arbeitsvertrag
Inhaltsverzeichnis
- Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers
- Zulässigkeit der Befristung
- Befristung aus sachlichem Grund
- Befristete Verträge ohne sachlichen Grund
- Blick zurück – Wie kam es zum § 14 Abs. 2 TzBfG?
- Sinn und Zweck – Was will der Gesetzgeber erreichen?
- Inhalt des § 14 Abs. 2 TzBfG - Befristung ohne sachlichen Grund
- Erläuterungen
- Grenzen
- Schriftform
- Was passiert bei unzulässiger Befristung?
- Keine Benachteiligung wegen Befristung
- Wirksame Verlängerung des befristeten Arbeitsverhältnisses
- Beendigung befristeter Arbeitsverhältnisse
- Kündigung des befristeten Arbeitsvertrages
- Informationspflicht des Arbeitgebers über unbefristete Arbeitsplätze
- Information der Arbeitnehmervertretung
- Aus- und Weiterbildung
- Glücksfälle für den Arbeitnehmer
- Blick in die Praxis
- Sind die Ziele erreicht worden?
- Vor- und Nachteile für den Arbeitgeber
- Vor- und Nachteile für den Arbeitnehmer
- Kritik und Fazit
- Was jetzt? Blick in die Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert befristete Arbeitsverhältnisse im deutschen Recht, insbesondere im Kontext von § 14 Abs. 2 TzBfG. Ziel ist es, die Zulässigkeit von Befristungen zu beleuchten, sowohl mit als auch ohne sachlichen Grund, und die Auswirkungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu untersuchen. Die Arbeit betrachtet die historische Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen und die praktische Anwendung des Gesetzes.
- Zulässigkeit der Befristung von Arbeitsverträgen
- Sachliche Gründe für Befristungen
- Befristungen ohne sachlichen Grund gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG
- Auswirkungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- Praktische Relevanz und Kritik des Gesetzes
Zusammenfassung der Kapitel
Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers: Dieses Kapitel definiert den Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers gemäß § 3 Abs. 1 TzBfG, indem es zwischen kalendermäßig und zweckmäßig befristeten Arbeitsverträgen unterscheidet. Es legt die Grundlage für das Verständnis der weiteren Kapitel, indem es die rechtliche Definition des zentralen Begriffs klärt.
Zulässigkeit der Befristung: Dieses Kapitel behandelt die Zulässigkeit der Befristung von Arbeitsverträgen, indem es die beiden Hauptfälle unterscheidet: Befristung mit und ohne sachlichen Grund. Es bietet einen Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen und die damit verbundenen Anforderungen.
Blick zurück – Wie kam es zum § 14 Abs. 2 TzBfG?: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung befristeter Arbeitsverträge und den Wandel vom ursprünglich im BGB vorgesehenen Normalfall hin zum Ausnahmefall aufgrund des verstärkten Kündigungsschutzes. Es erklärt die Entstehung des Problems der Kettenarbeitsverträge und den Bedarf an einer gesetzlichen Regelung.
Inhalt des § 14 Abs. 2 TzBfG - Befristung ohne sachlichen Grund: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die detaillierte Erläuterung der gesetzlichen Bestimmungen des § 14 Abs. 2 TzBfG, der die Befristung ohne sachlichen Grund unter bestimmten Voraussetzungen zulässt. Es beschreibt die zeitliche Begrenzung und die Möglichkeit der Verlängerung.
Erläuterungen: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Auslegung der verschiedenen Aspekte des § 14 Abs. 2 TzBfG. Es untersucht die Grenzen der Befristung, die Schriftformvorschriften, die Konsequenzen bei unzulässiger Befristung, Fragen der Benachteiligung, die wirksame Verlängerung, Beendigung und Kündigung befristeter Arbeitsverträge, die Informationspflichten des Arbeitgebers und die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung im Kontext befristeter Beschäftigung.
Blick in die Praxis: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Anwendung von § 14 Abs. 2 TzBfG. Es bewertet die Erreichung der gesetzten Ziele, untersucht die Vor- und Nachteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und liefert eine praxisorientierte Perspektive auf die Thematik.
Schlüsselwörter
Befristete Arbeitsverträge, § 14 Abs. 2 TzBfG, sachlicher Grund, Kettenarbeitsverträge, Zulässigkeit der Befristung, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Kündigungsschutz, Arbeitsrecht, Rechtsprechung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Befristete Arbeitsverhältnisse im deutschen Recht - § 14 Abs. 2 TzBfG"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert befristete Arbeitsverhältnisse im deutschen Recht, insbesondere im Kontext von § 14 Abs. 2 TzBfG. Sie untersucht die Zulässigkeit von Befristungen mit und ohne sachlichen Grund und deren Auswirkungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung, die rechtlichen Grundlagen und die praktische Anwendung des Gesetzes.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit behandelt die Zulässigkeit der Befristung von Arbeitsverträgen, sowohl mit als auch ohne sachlichen Grund (§ 14 Abs. 2 TzBfG). Sie analysiert die Auswirkungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die praktische Relevanz und die Kritikpunkte des Gesetzes. Die historische Entwicklung und der Sinn und Zweck des § 14 Abs. 2 TzBfG werden ebenfalls erörtert.
Wie wird der Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers gemäß § 3 Abs. 1 TzBfG, indem sie zwischen kalendermäßig und zweckmäßig befristeten Arbeitsverträgen unterscheidet. Diese Definition bildet die Grundlage für das Verständnis der weiteren Kapitel.
Was sind die Voraussetzungen für eine zulässige Befristung?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Befristungen mit und ohne sachlichen Grund. Sie erläutert die gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen für beide Fälle. Besonderes Augenmerk liegt auf der Befristung ohne sachlichen Grund gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG.
Welche Bedeutung hat § 14 Abs. 2 TzBfG?
§ 14 Abs. 2 TzBfG regelt die Befristung von Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund unter bestimmten Voraussetzungen. Die Arbeit erläutert detailliert die Bestimmungen dieses Paragraphen, einschließlich der zeitlichen Begrenzung und der Möglichkeit der Verlängerung.
Welche Konsequenzen hat eine unzulässige Befristung?
Die Arbeit beschreibt die Konsequenzen einer unzulässigen Befristung. Sie behandelt die Rechtsfolgen, wie beispielsweise die Umwandlung eines befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Welche Informationen müssen Arbeitgeber Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretungen bereitstellen?
Die Arbeit beleuchtet die Informationspflichten des Arbeitgebers gegenüber den Arbeitnehmern und der Arbeitnehmervertretung bezüglich unbefristeter Arbeitsplätze und weiterer relevanter Aspekte.
Welche Vor- und Nachteile haben befristete Arbeitsverträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile befristeter Arbeitsverträge aus der Perspektive von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Diese Betrachtung erfolgt sowohl aus rechtlicher als auch aus praktischer Sicht.
Wie wird die Wirksamkeit von Verlängerungen befristeter Arbeitsverträge beurteilt?
Die Arbeit erläutert die Kriterien für eine wirksame Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses und die damit verbundenen rechtlichen Anforderungen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Thema?
Die Arbeit nennt folgende Schlüsselwörter: Befristete Arbeitsverträge, § 14 Abs. 2 TzBfG, sachlicher Grund, Kettenarbeitsverträge, Zulässigkeit der Befristung, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Kündigungsschutz, Arbeitsrecht, Rechtsprechung.
Welche Kritikpunkte werden an § 14 Abs. 2 TzBfG geübt?
Die Arbeit untersucht die Kritikpunkte am § 14 Abs. 2 TzBfG und fasst diese zusammen.
Wie wird die zukünftige Entwicklung des Themas eingeschätzt?
Die Arbeit gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Rechtsprechung und Gesetzgebung im Bereich befristeter Arbeitsverhältnisse.
- Quote paper
- Claudia Zube (Author), 2003, Befristete Arbeitsverhältnisse, insbesondere § 14 Abs. 2 TzBfG, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/22826