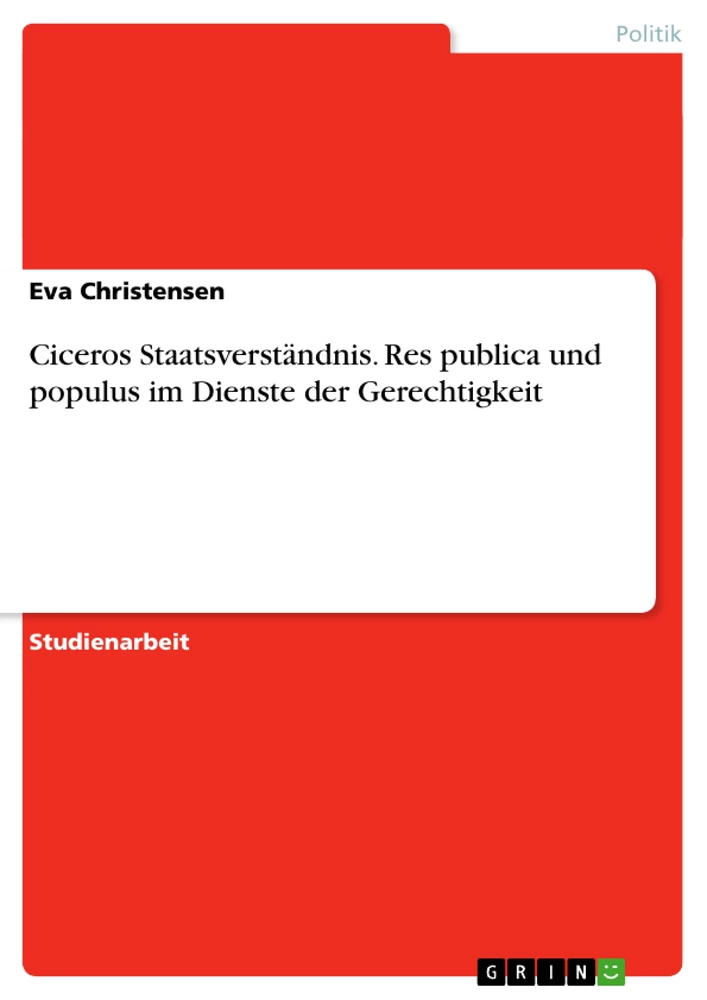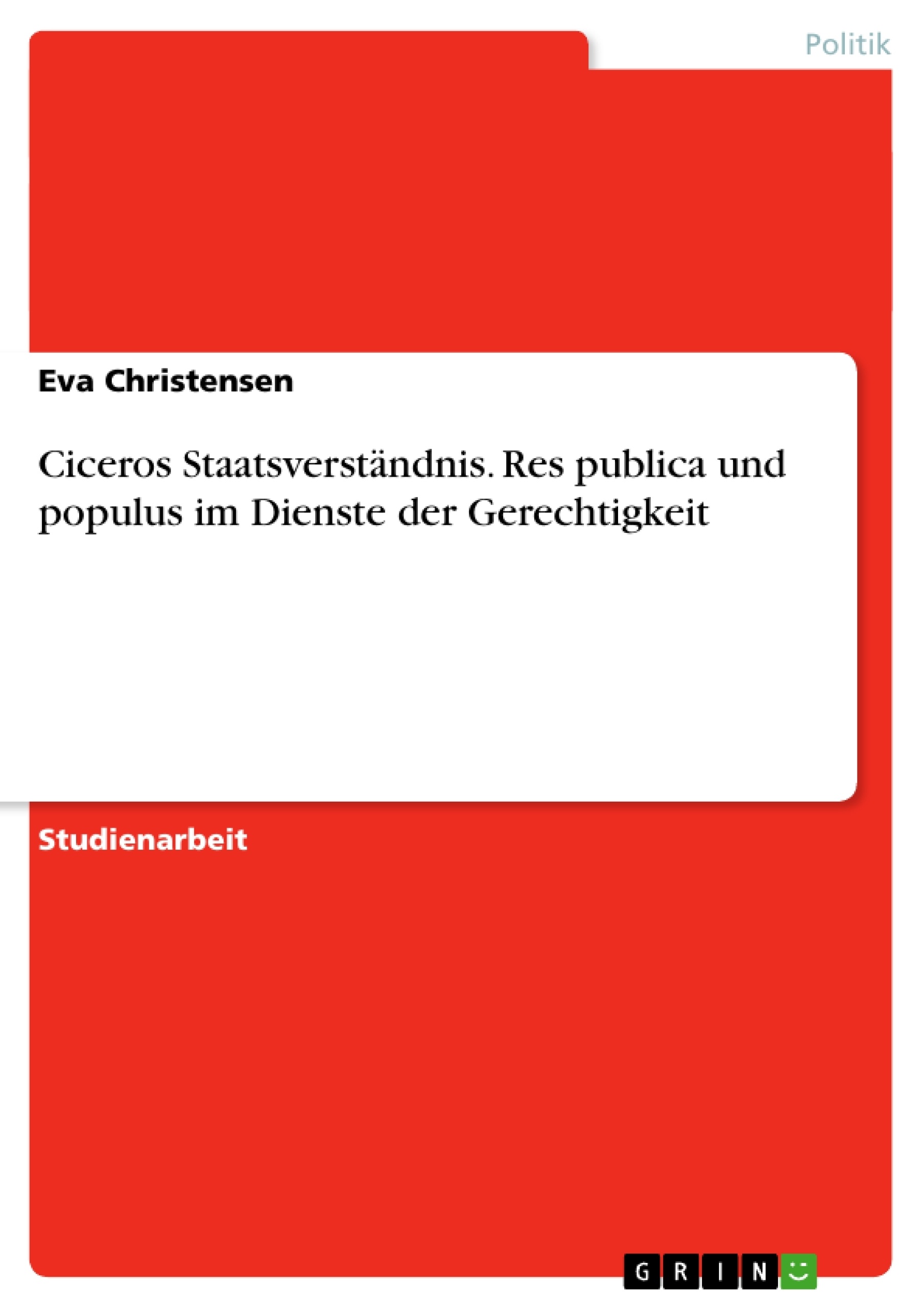[...]
Dabei wird die Darstellung einer Biografie bewusst ausgeklammert: Sie müsste
sinnvollerweise einen Bezug zwischen Leben und Werk herstellen, was in diesem Rahmen
nicht leistbar ist.2 Es sei hier nur erwähnt, dass der Theoretiker, Redner und Politiker
Cicero sein Leben in den Dienst des römischen Staates stellte. Ebenso erfährt die
Anthropologie Ciceros keine eigenständige Beachtung, sie mag jedoch im erörterten
Thema anklingen. Auch die äußerst komplizierte Frage nach Quellen und Vorbildern soll
nicht näher diskutiert werden, zumal um sie eine große Forschungskontroverse besteht3
und erschwerend hinzu kommt, dass die Werke, die Cicero vermutlich geprägt haben,
verloren und daher nicht bekannt sind.
Es sei noch auf weitere Schwierigkeiten bei der Interpretation von De re publica, dem
zentralen Werk für Ciceros Staatsverständnis, hingewiesen: Es ist nur unvollständig
überliefert und weist auch an zentralen Stellen Lücken auf. Seine späte Entdeckung im Jahr
1822 verhinderte eine jahrhundertelange Diskussion durch andere große Denker.4
Um Ciceros Vorstellung von Staat verständlich zu machen, werde ich nun zuerst seine
Definition des Gemeinwesens, der res publica, und einige Unterschiede zum modernen
Staatsbegriff darstellen. Untrennbar damit verbunden ist die Erläuterung seines
Volksbegriffes. Im Anschluss erfolgt eine Darstellung der Verfassungsanalyse Ciceros:
von seiner Kritik an den drei Einzelverfassungen über den Verfassungskreislauf bis zur Bevorzugung der Mischverfassung. Abschließend werden die Aufgaben des Staatsmannes
und die zu ihrer Erfüllung notwendigen Fähigkeiten und Eigenschaften aufgezeigt.
2 Als exemplarisch für diesen Versuch seien genannt: Matthias Gelzer: Cicero. Ein biographis cher Versuch,
Wiesbaden 1969; Marion Giebel: Marcus Tullius Cicero. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten,
Reinbek bei Hamburg 11 1997; Friedrich Klinger: Cicero, in: ders.: Römische Geisteswelt, München 5 1965,
S. 110-159.
3 Beispielsweise: Viktor Pöschl: Römischer Staat und griechisches Staatsdenken bei Cicero. Untersuchungen
zu Ciceros Schrift De re publica, Darmstadt 1976. Kritisch dazu: Pierre Boyancé: Études sur l'humanisme
Cicéronien, Brüssel 1970, S. 222-247.
4 Andere Probleme der Interpretation vgl.: Karl Büchner: De re publica. Kommentar, Heidelberg 1984, S. 15-
20.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Staates
- Ciceros Definition der res publica
- Moderner Staat und römische res publica
- Definition und Ursprung des Volkes
- Analyse der Verfassungen
- Die drei Einzelverfassungen und Ciceros Kritik
- Die beste der drei Einzelverfassungen
- Mischverfassung als beste Verfassung
- Die römische Mischverfassung
- Gefährdung der Stabilität der Mischverfassung
- Der Staatsmann
- Wesen des Staatsmannes
- Aufgabe des Staatsmannes
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Beitrag bietet einen Überblick über Ciceros Staatsverständnis und zielt darauf ab, sein Verständnis von Staat, Volk und Staatsmann zu erörtern. Im Zentrum steht die Frage, ob dieses Verständnis formal oder inhaltlich bestimmt ist, wobei der gerechte Sinn des Staates als zentrales Element hervorgehoben wird.
- Definition der res publica und ihre Abgrenzung zum modernen Staatsbegriff
- Analyse der verschiedenen Verfassungsformen und die Vorzüge der Mischverfassung
- Der Staatsmann als zentrale Figur im Staatsverständnis Ciceros
- Die Rolle des Volkes als Grundlage des Gemeinwesens
- Das Streben nach Gerechtigkeit als grundlegender Wert im Staatsverständnis Ciceros
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung bietet eine kurze Einführung in Ciceros Schriften und das Ziel des Beitrags, einen Überblick über sein Verständnis von Staat, Volk und Staatsmann zu liefern. Es wird auch auf die Herausforderungen bei der Interpretation seiner Werke hingewiesen, insbesondere auf die Unvollständigkeit des zentralen Werks "De re publica".
- Definition des Staates: Dieses Kapitel untersucht Ciceros Definition der "res publica" und zeigt Unterschiede zum modernen Staatsbegriff auf. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Volkes ("populus") als zentrales Element der römischen Staatstheorie.
- Analyse der Verfassungen: Dieses Kapitel erörtert Ciceros Kritik an den drei Einzelverfassungen (Monarchie, Aristokratie, Demokratie) und die Vorteile der Mischverfassung. Cicero argumentiert für die Stabilität und Nachhaltigkeit einer Verfassung, die Elemente aller drei Einzelverfassungen vereint.
- Der Staatsmann: Dieses Kapitel beschreibt die Eigenschaften und Aufgaben des Staatsmannes, der durch seine Fähigkeiten und seine Verpflichtung zur Gerechtigkeit die res publica fördern soll.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Beitrags sind: res publica, populus Romanus, Staatsverständnis, Verfassungsanalyse, Mischverfassung, Staatsmann, Gerechtigkeit, Recht, Interesse, Gemeinwesen, und Cicero. Der Beitrag beleuchtet die philosophischen und politischen Aspekte von Ciceros Staatsverständnis, insbesondere die Verbindung von Staat und Volk, die Rolle der Gerechtigkeit und die Bedeutung des Staatsmannes für die Erhaltung und Förderung der res publica.
- Quote paper
- Magistra Artium Eva Christensen (Author), 2003, Ciceros Staatsverständnis. Res publica und populus im Dienste der Gerechtigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/22642