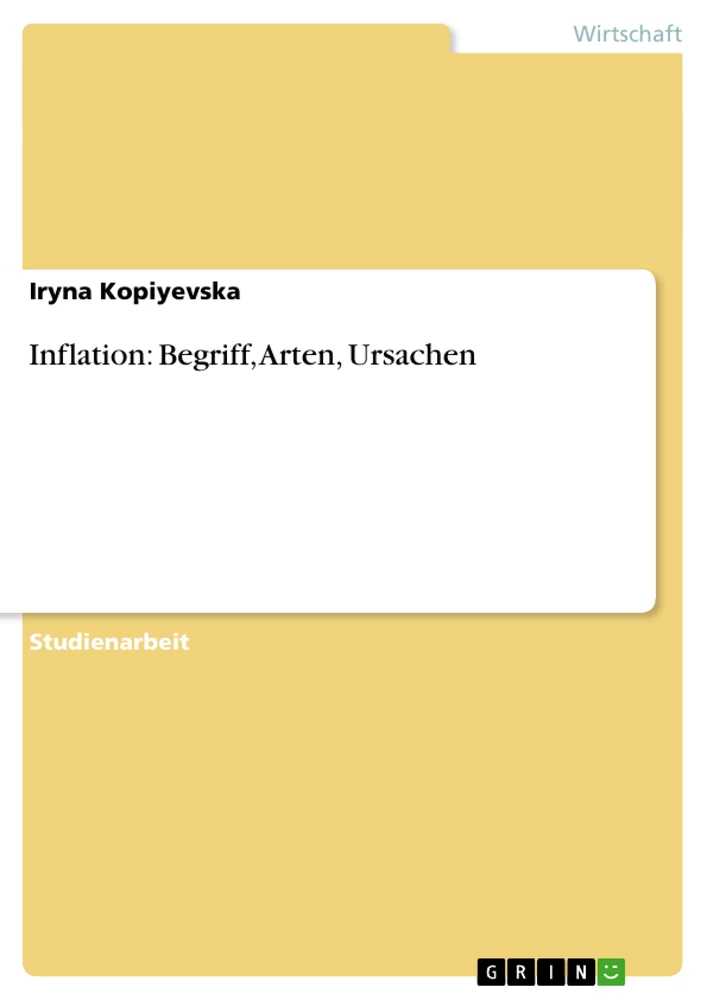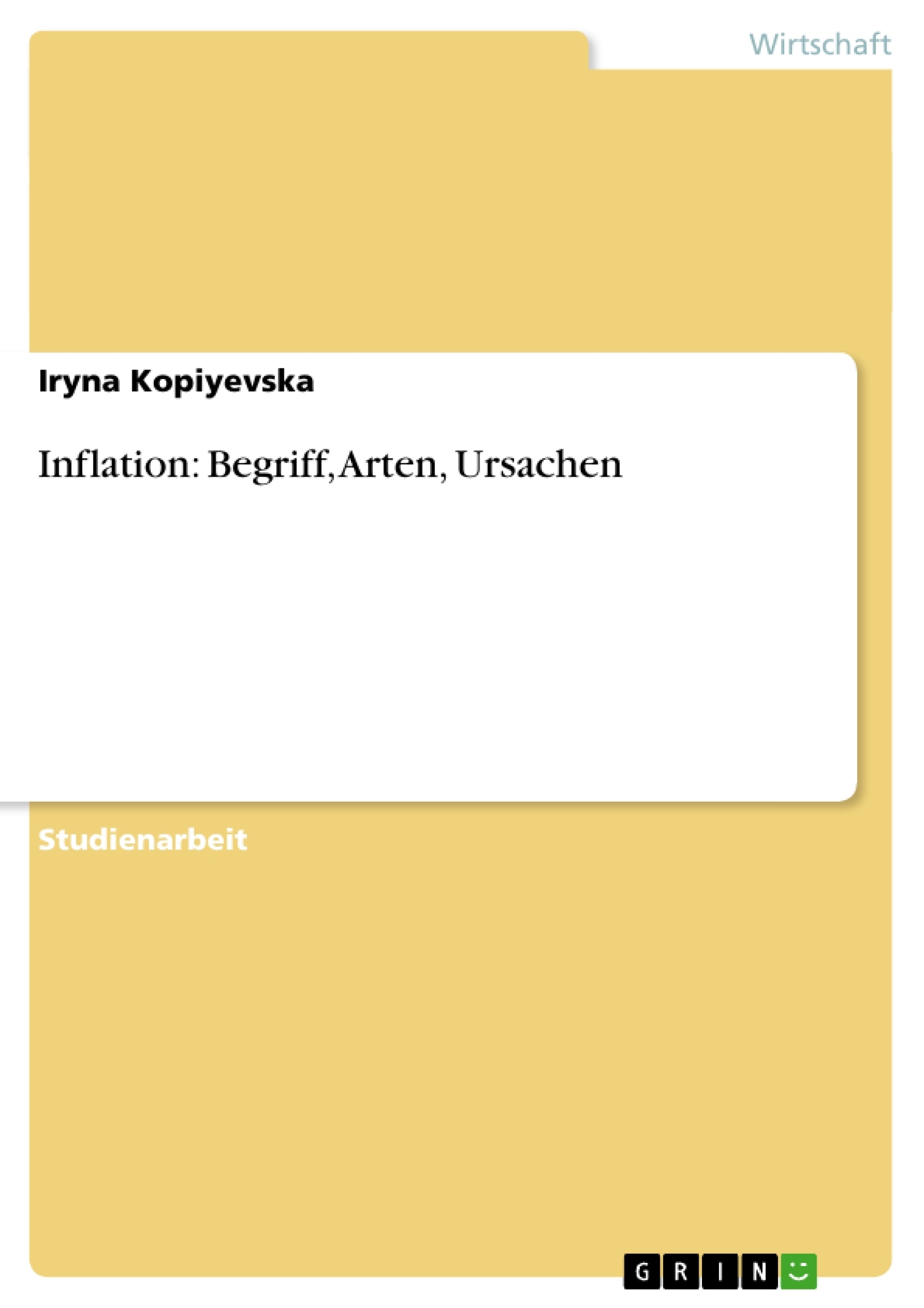Das Phänomen der Inflation sowie die damit verbundenen Probleme beschäftigen die Menschheit bereits sehr lange. Ungeachtet dessen gibt es dazu in den wissenschaftlichen Analysen sowie politischen Debatten immer noch keine einheitliche Meinung. Das Problem des Inflationsprozesses ist jedoch nach wie vor sehr aktuell und von großer Bedeutung, weil es praktisch keine Volkswirtschaft gibt, die nicht inflatorische Prozesse verzeichnet oder von ihnen in unterschiedlichem Maße geprägt wird.
Die diversen Betrachtungsweisen des Inflationsphänomens sind hauptsächlich auf die unterschiedlichen Ausgangspositionen und Zugehörigkeiten einer bestimmten ökonomischen Schule, z. B. der Keynesianern oder Monetaristen, zurückzuführen. Es existiert eine Vielzahl von Inflationsliteratur, in der die verschiedenen Theorien niedergelegt sind. Diese Arbeit setzt sich kritisch mit unterschiedlichen Erklärungsansätzen der Inflationstheorie anhand der ausgewählten Literatur auseinander, mit dem Ziel, das ‚Wesen’ des inflationären Prozesses anhand seiner Definition, Erscheinungsformen und Ursachen
darzustellen. Die Existenz kontroverser Auffassungen wird bei einigen Punkten hervorgehoben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriff und Arten der Inflation
- 2.1 Begriff
- 2.1.1 Symptomorientierte Definition
- 2.1.2 Alternative Inflationsbegriffe
- 2.2 Arten
- 2.2.1 Offene und zurückgestaute Inflation
- 2.2.2 Schleichende, trabende, galoppierende und Hyperinflation
- 2.2.3 Vollkommen und unvollkommen antizipierte Inflation
- 2.2.4 Nachfrage- und Angebotsinflation
- 2.2.5 Absolute und relative Inflation
- 2.1 Begriff
- 3. Ursachen der Inflation
- 3.1 Nicht-monetäre Inflationstheorien
- 3.1.1 Nachfrageinflation
- 3.1.1.1 Nachfrage privater Haushalte
- 3.1.1.2 Unternehmens- bzw. Investitionsnachfrage
- 3.1.1.3 Staatliche Nachfrage
- 3.1.1.4 Nachfrage des Auslands
- 3.1.2 Angebotsinflation
- 3.1.2.1 Kostendruckinflation
- 3.1.2.2 Gewinndruckinflation
- 3.1.1 Nachfrageinflation
- 3.2 Monetäre Inflationstheorien
- 3.2.1 Ältere Quantitätstheorie
- 3.2.2 Neuere Quantitätstheorie
- 3.1 Nicht-monetäre Inflationstheorien
- 4. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Inflation, ihre verschiedenen Arten und die zugrundeliegenden Ursachen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des inflationären Prozesses zu vermitteln und verschiedene Erklärungsansätze kritisch zu beleuchten. Dabei werden sowohl monetäre als auch nicht-monetäre Theorien berücksichtigt.
- Definition und Abgrenzung des Inflationbegriffs
- Klassifizierung verschiedener Inflationstypen
- Analyse nicht-monetärer Ursachen der Inflation
- Analyse monetärer Ursachen der Inflation
- Gegenüberstellung verschiedener Inflationstheorien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Inflation ein und verweist auf die lange Geschichte des Phänomens sowie die anhaltende wissenschaftliche und politische Debatte um seine Ursachen und Folgen. Sie benennt das Ziel der Arbeit: eine kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Erklärungsansätzen der Inflation, um deren Wesen anhand von Definition, Erscheinungsformen und Ursachen darzustellen. Die Existenz kontroverser Auffassungen wird als zentraler Aspekt hervorgehoben.
2. Begriff und Arten der Inflation: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Definition von Inflation. Es präsentiert die symptomorientierte Definition, die sich auf das anhaltende Ansteigen des Preisniveaus konzentriert, und vergleicht diese mit alternativen, ursachen- und wirkungsorientierten Definitionen. Die verschiedenen Arten der Inflation werden detailliert beschrieben und klassifiziert, darunter offene und zurückgestaute Inflation, schleichende, trabende, galoppierende und Hyperinflation, sowie Nachfrage- und Angebotsinflation. Die unterschiedlichen Definitionen und Klassifizierungen werden kritisch beleuchtet und in ihren jeweiligen Kontexten eingeordnet.
3. Ursachen der Inflation: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen der Inflation, indem es nicht-monetäre und monetäre Inflationstheorien unterscheidet und vergleicht. Die nicht-monetären Theorien konzentrieren sich auf Nachfrage- und Angebotsfaktoren, wie beispielsweise die Nachfrage privater Haushalte, Unternehmensinvestitionen, staatliche Ausgaben und die Nachfrage des Auslands (Nachfrageinflation) sowie Kostendruck- und Gewinndruckinflation (Angebotsinflation). Die monetären Theorien, sowohl die ältere als auch die neuere Quantitätstheorie, betonen die Rolle der Geldmenge bei der Entstehung von Inflation. Der Kapitel analysiert die Stärken und Schwächen der verschiedenen Theorien und ihren Erklärungswert für unterschiedliche inflationäre Prozesse.
Schlüsselwörter
Inflation, Preisniveau, Geldmenge, Nachfrageinflation, Angebotsinflation, Quantitätstheorie, Deflation, Kaufkraft, Geldwert, monetäre Theorie, nicht-monetäre Theorie, Preisstabilität.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Inflation
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Inflation. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der Definition von Inflation, ihren verschiedenen Arten und den zugrundeliegenden Ursachen, wobei sowohl monetäre als auch nicht-monetäre Theorien betrachtet werden.
Welche Arten von Inflation werden behandelt?
Das Dokument unterscheidet verschiedene Arten von Inflation, darunter offene und zurückgestaute Inflation, schleichende, trabende, galoppierende und Hyperinflation, sowie Nachfrage- und Angebotsinflation. Die vollkommen und unvollkommen antizipierte Inflation wird ebenfalls thematisiert. Die jeweiligen Definitionen und Klassifizierungen werden kritisch beleuchtet und in ihren Kontexten eingeordnet.
Welche Ursachen für Inflation werden diskutiert?
Der Text analysiert die Ursachen von Inflation, indem er nicht-monetäre und monetäre Theorien unterscheidet. Zu den nicht-monetären Theorien gehören Nachfrageinflation (betrachtet die Nachfrage privater Haushalte, Unternehmen, Staat und Ausland) und Angebotsinflation (Kostendruck- und Gewinndruckinflation). Die monetären Theorien umfassen die ältere und neuere Quantitätstheorie, die die Rolle der Geldmenge hervorheben. Die Stärken und Schwächen der verschiedenen Theorien werden im Hinblick auf ihren Erklärungswert für unterschiedliche inflationäre Prozesse untersucht.
Wie wird Inflation definiert?
Das Dokument präsentiert eine symptomorientierte Definition von Inflation, die sich auf das anhaltende Ansteigen des Preisniveaus konzentriert. Diese Definition wird mit alternativen, ursachen- und wirkungsorientierten Definitionen verglichen, um ein umfassenderes Verständnis zu ermöglichen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Begriff und den Arten der Inflation, ein Kapitel zu den Ursachen der Inflation und eine Schlussfolgerung. Jedes Kapitel wird im Dokument separat zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Zu den wichtigsten Schlüsselwörtern gehören: Inflation, Preisniveau, Geldmenge, Nachfrageinflation, Angebotsinflation, Quantitätstheorie, Deflation, Kaufkraft, Geldwert, monetäre Theorie, nicht-monetäre Theorie, Preisstabilität.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis des inflationären Prozesses zu vermitteln und verschiedene Erklärungsansätze kritisch zu beleuchten. Es soll ein kritisches Verständnis der Definition, Erscheinungsformen und Ursachen der Inflation ermöglichen.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für alle, die sich akademisch mit dem Thema Inflation auseinandersetzen, sei es im Studium oder in der Forschung. Der Text ist für ein professionelles, strukturiertes Verständnis konzipiert.
- Quote paper
- Iryna Kopiyevska (Author), 2003, Inflation: Begriff, Arten, Ursachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/22190