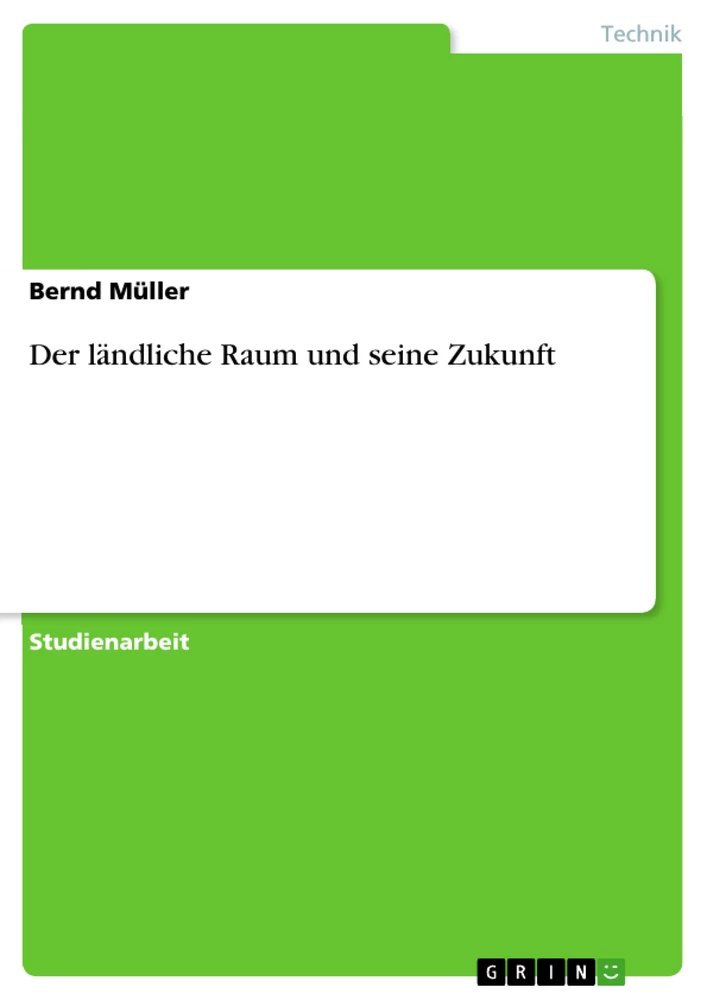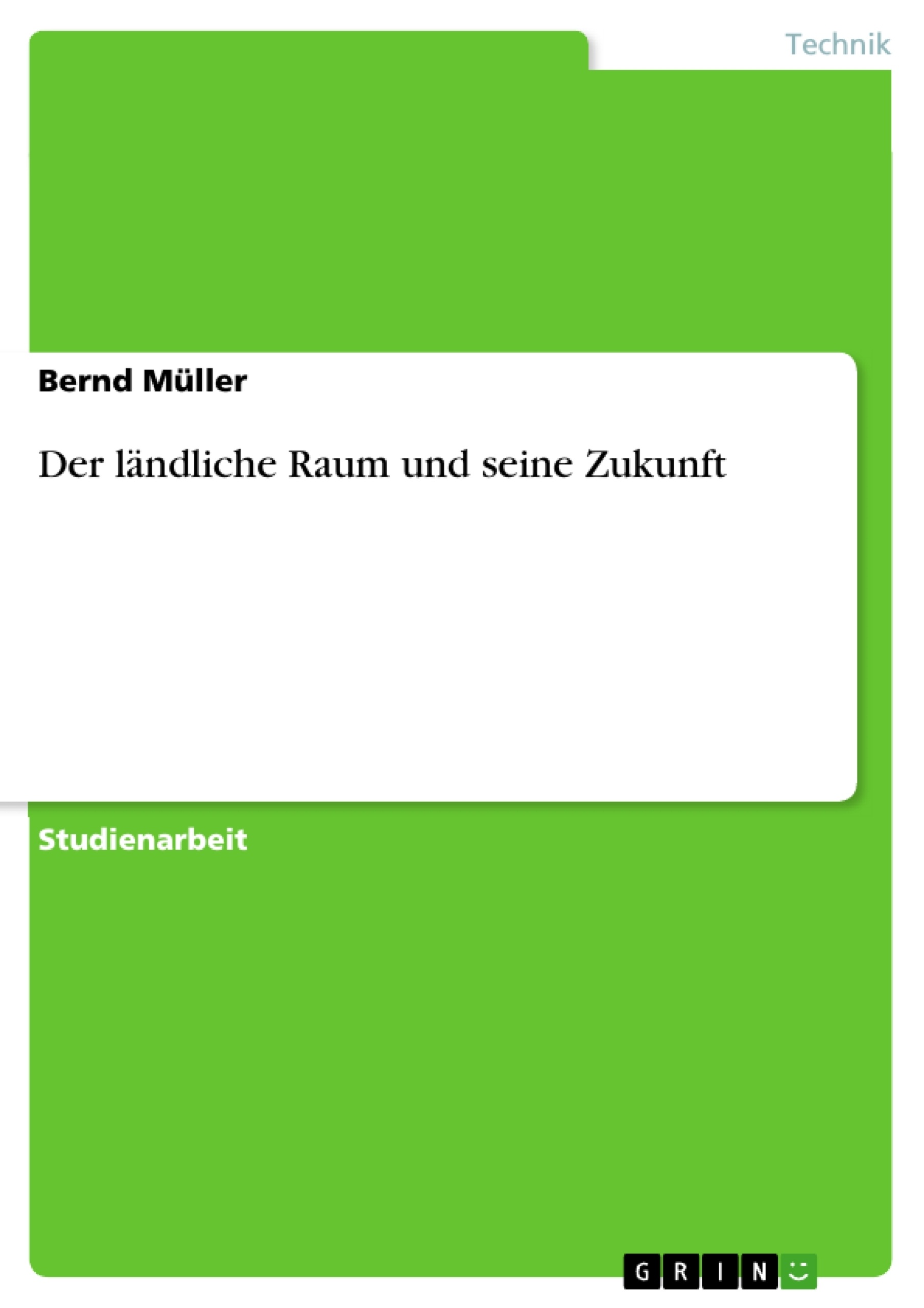Allgemeines zum ländlichen Raum
Der ländliche Raum, wie der Begriff im Allgemeinen verstanden wird, umfasst Gebietskörperschaften und Naturlandschaften, Ackerland, Wälder, Dörfer, Kleinstädte, industrielle Einsprengsel und regionale Zentren. Der ländliche Raum bildet ein sehr vielfältiges und kompliziertes Wirtschafts- und Sozialgefüge.
Aufgrund seiner reichhaltigen natürlichen Ressourcen, Lebensräumen und kulturellen Traditionen spielt es eine immer größer werdende Rolle für Erholung und Freizeit. Der Begriff „ländlicher Raum“ wird zu meist von jedermann so verstanden, als dass dem ländlichen Raum ein materielles, soziales und kulturelles System vorliegt, welches das Gegenteil vom „städtisch“ ist. Eine eindeutige und für alle Zwecke brauchbare Abgrenzung zwischen Stadt und Land ist jedoch nicht möglich.
Die Mitgliedsstaaten der EU haben im allgemeinen jeweils eigene Definitionen des ländlichen Raumes entwickelt. Diesen Definitionen liegen meist Kriterien wie landwirtschaftliche Merkmale,
Bevölkerungsdichte oder Bevölkerungsrückgang zugrunde.
Zur Abgrenzung zwischen ländlichen und städtischen Gebieten wird meist das Kriterium der Bevölkerungsdichte verwendet. Dieses ist aber oft zu ungenau und als Richtschnur für politische Entscheidungen nicht geeignet.
Ländliche Gebiete lassen sich durch ihre Bevölkerungsentwicklung auf lokaler Ebene unterscheiden. Auf der einen Seite sind manche ländlichen Gebiete Europas, so z.B. in den ostdeutschen Bundesländern und im französischen Zentralmassiv, durch Abwanderung der Bevölkerung gekennzeichnet, auf der anderen Seite sind aber manche Gebiete durch Zuwanderung gekennzeichnet.
Die OECD hat vor einiger Zeit ein einfaches System zum internationalen Vergleich der Strukturen und Trends der verschiedenen ländlichen Räume entwickelt. Dieses System hat sich
trotz der großen Unterschiede im Hinblick auf die ländlichen Probleme, Perspektiven und Politiken auf staatlicher Ebene als zweckmäßig erwiesen. Dieses System unterscheidet zwei hierarchische Ebenen von Gebietseinheiten, die lokale und die regionale Ebene. Auf lokaler Ebene definiert die OECD ländliche Gebiete als Gemeinwesen mit einer Bevölkerungsdichte von weniger als 150 Einwohner je Quadratkilometer. Auf regionaler Ebene unterscheidet die OECD größere funktionale und administrative Einheiten nach dem Grad
ihrer „Ländlichkeit“, je nachdem, wie hoch der Anteil der regionalen Bevölkerung ist, der in ländlichen Gemeinwesen lebt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der ländliche Raum in Europa
- Allgemeines zum ländlichen Raum
- Bruttoinlandsprodukt 1994
- Umwelt und Landschaft
- Forstwirtschaft
- Landwirte
- 2. Chancen für den ländlichen Raum
- Allgemeines
- Der ländliche Tourismus
- Ökologischer Landbau
- Anbau von nachwachsenden Rohstoffen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Charakteristika des ländlichen Raumes in Europa und beleuchtet potentielle Zukunftsentwicklungen. Der Fokus liegt auf der Definition des ländlichen Raumes, seinen sozioökonomischen Strukturen und den Chancen für eine nachhaltige Entwicklung.
- Definition und Abgrenzung des ländlichen Raumes
- Sozioökonomische Strukturen des ländlichen Raumes
- Herausforderungen und Probleme im ländlichen Raum
- Chancen und Potentiale für die Entwicklung des ländlichen Raumes
- Verschiedene Ansätze zur Klassifizierung ländlicher Gebiete
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der ländliche Raum in Europa: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Einführung in den ländlichen Raum Europas. Es beleuchtet die vielschichtige Definition des Begriffs "ländlicher Raum", der sich je nach Perspektive und den verwendeten Kriterien (Bevölkerungsdichte, landwirtschaftliche Merkmale etc.) unterscheidet. Die Schwierigkeiten einer einheitlichen Definition werden hervorgehoben, und verschiedene Klassifizierungssysteme, wie das der OECD und EUROSTAT, werden vorgestellt und verglichen. Die Kapitel analysiert die heterogene Entwicklung ländlicher Gebiete, die von Abwanderung in einigen Regionen bis hin zu Zuwanderung in anderen reicht. Die unterschiedlichen sozioökonomischen Strukturen und die Bedeutung der natürlichen Ressourcen für Erholung und Freizeit werden ebenfalls thematisiert.
2. Chancen für den ländlichen Raum: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die positiven Entwicklungsmöglichkeiten des ländlichen Raumes. Es werden verschiedene Strategien und Ansätze für eine nachhaltige Entwicklung präsentiert, darunter der ländliche Tourismus, der ökologische Landbau und der Anbau nachwachsender Rohstoffe. Die Kapitel beleuchtet das Potential dieser Bereiche, um neue Wirtschaftszweige zu schaffen und die Lebensqualität in ländlichen Regionen zu verbessern. Der Fokus liegt auf innovativen Ansätzen, die die Stärken des ländlichen Raums nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen der Globalisierung und des demografischen Wandels bewältigen.
Schlüsselwörter
Ländlicher Raum, Europa, Bevölkerungsdichte, sozioökonomische Strukturen, nachhaltige Entwicklung, ländlicher Tourismus, ökologischer Landbau, nachwachsende Rohstoffe, OECD-Klassifizierung, EUROSTAT-Klassifizierung, Raumordnung.
Häufig gestellte Fragen zu: "Charakteristika des ländlichen Raumes in Europa und Zukunftsentwicklungen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Charakteristika des ländlichen Raumes in Europa und beleuchtet mögliche Zukunftsentwicklungen. Sie konzentriert sich auf die Definition des ländlichen Raumes, seine sozioökonomischen Strukturen und Chancen für eine nachhaltige Entwicklung. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in Kapitel 1 ("Der ländliche Raum in Europa") behandelt?
Kapitel 1 bietet eine umfassende Einführung in den ländlichen Raum Europas. Es diskutiert die vielschichtigen Definitionen des Begriffs "ländlicher Raum", die Schwierigkeiten einer einheitlichen Definition und verschiedene Klassifizierungssysteme (OECD und EUROSTAT). Es analysiert die heterogene Entwicklung ländlicher Gebiete, die sozioökonomischen Strukturen und die Bedeutung der natürlichen Ressourcen.
Was sind die Kernthemen von Kapitel 2 ("Chancen für den ländlichen Raum")?
Kapitel 2 konzentriert sich auf positive Entwicklungsmöglichkeiten im ländlichen Raum. Es präsentiert Strategien für nachhaltige Entwicklung, wie ländlichen Tourismus, ökologischen Landbau und den Anbau nachwachsender Rohstoffe. Es beleuchtet das Potential dieser Bereiche zur Schaffung neuer Wirtschaftszweige und Verbesserung der Lebensqualität. Der Fokus liegt auf innovativen Ansätzen zur Bewältigung von Globalisierung und demografischem Wandel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ländlicher Raum, Europa, Bevölkerungsdichte, sozioökonomische Strukturen, nachhaltige Entwicklung, ländlicher Tourismus, ökologischer Landbau, nachwachsende Rohstoffe, OECD-Klassifizierung, EUROSTAT-Klassifizierung, Raumordnung.
Wie ist der ländliche Raum definiert?
Die Arbeit betont die Schwierigkeiten einer einheitlichen Definition des ländlichen Raumes. Die Definition variiert je nach Perspektive und verwendeten Kriterien (Bevölkerungsdichte, landwirtschaftliche Merkmale etc.). Verschiedene Klassifizierungssysteme wie die der OECD und EUROSTAT werden vorgestellt und verglichen.
Welche Herausforderungen und Chancen bestehen für den ländlichen Raum?
Die Arbeit beleuchtet sowohl Herausforderungen (z.B. Abwanderung, sozioökonomische Disparitäten) als auch Chancen (z.B. ländlicher Tourismus, ökologischer Landbau, nachwachsende Rohstoffe) für den ländlichen Raum. Der Fokus liegt auf der Entwicklung nachhaltiger Strategien zur Bewältigung der Herausforderungen und Nutzung der Potenziale.
Welche Rolle spielen nachhaltige Entwicklungsansätze?
Nachhaltige Entwicklung spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht verschiedene Ansätze, wie ländlichen Tourismus, ökologischen Landbau und den Anbau nachwachsender Rohstoffe, um eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes zu fördern und die Lebensqualität zu verbessern.
- Quote paper
- Diplom-Ingenieur Bernd Müller (Author), 2001, Der ländliche Raum und seine Zukunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/2173