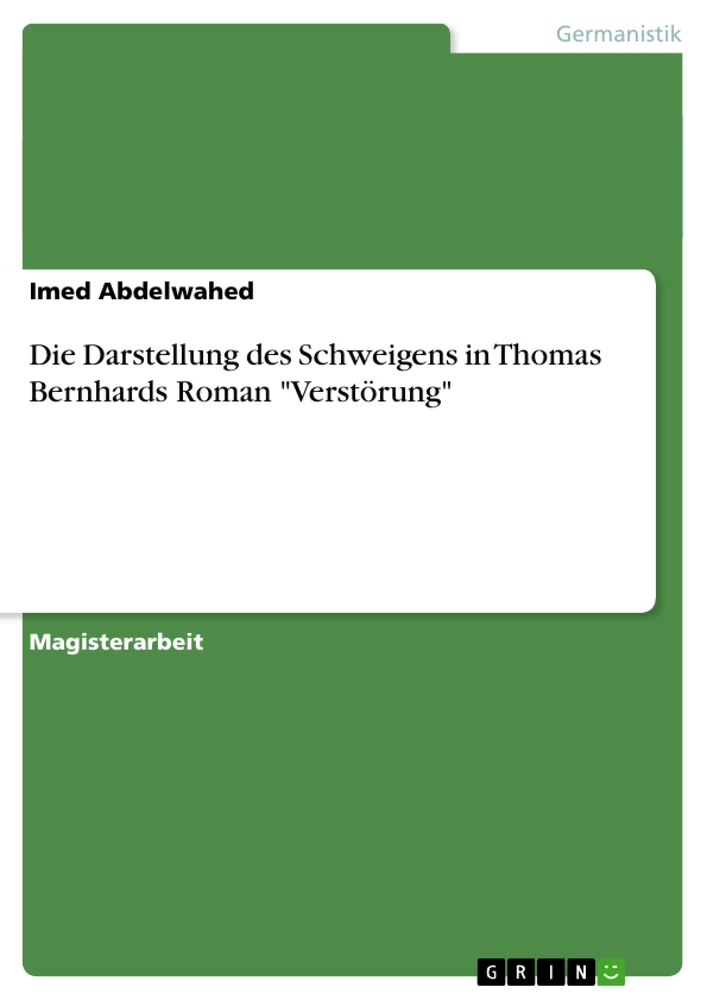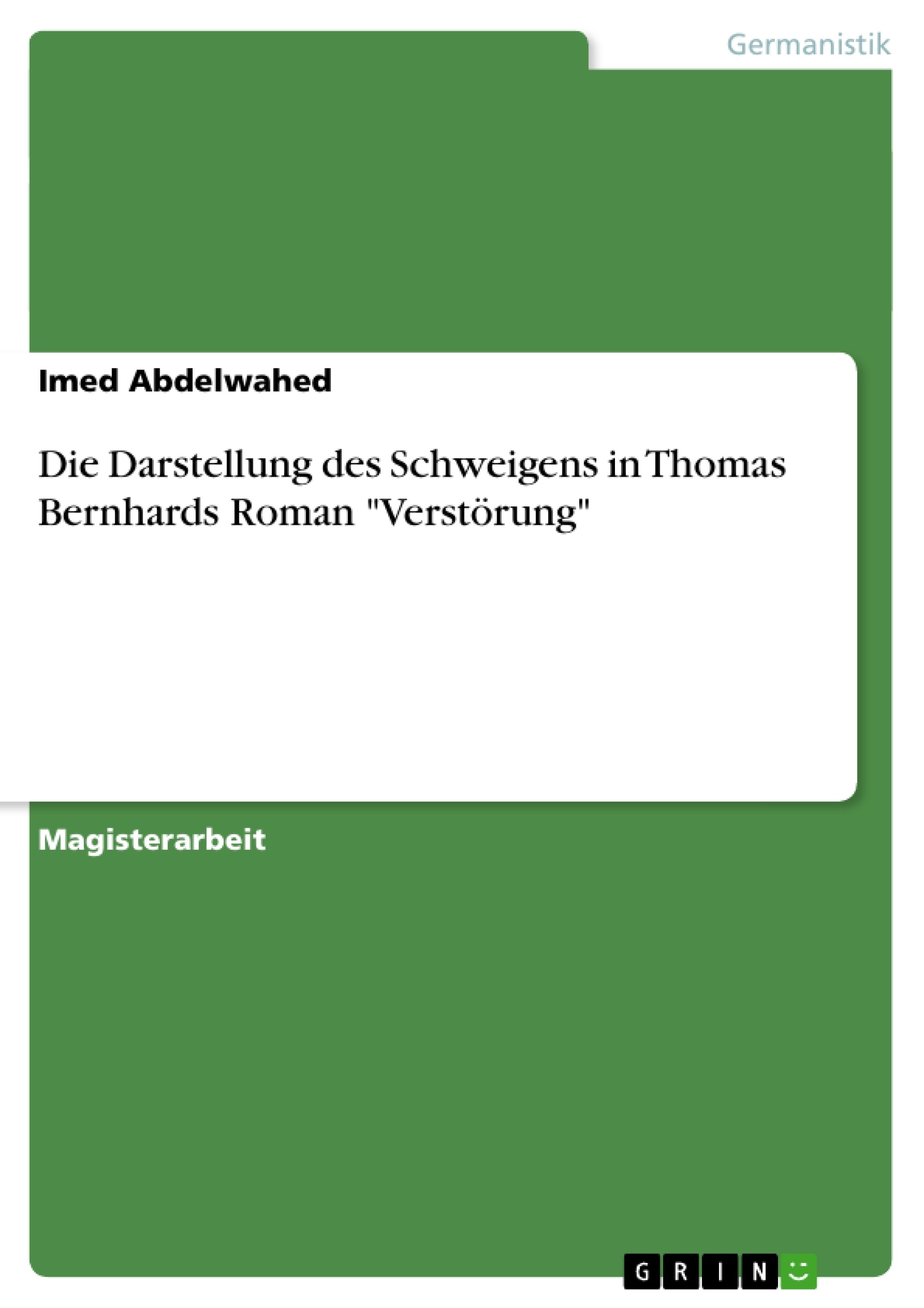Das Sprechen des Fürsten mit sich selbst hängt nicht von einem Zuhörer ab. In seinem partnerlosen Sprechen drückt sich eine menschliche Grundhaltung aus, die monologisch ist. Hört die Kommunikation mit der Außenwelt auf, so setzt die Verständigung mit der eigenen Person ein. Dem Sprechenden dient das Selbstgespräch als letztmögliche Ausdrucksmöglichkeit eines mitten einer todgeweihten Welt existierenden Menschen. Es fungiert als Notlösung vor dem endgültigen Schweigen, vor dem Tod.
Das Schweigen, in dem diese monologisierende Figur existiert und das sie gleichzeitig durch einen besonderen Sprechakt zu überwinden versucht, dominiert letztendlich ihr Denken und ihr Sprechen. Das Sprechen wird zur Form, zu einer unaufhörlich rekurrierenden Vergeblichkeit.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MITTEILUNGSLOSIGKEIT
- Familienverhältnisse
- Unüberbrückbares Schweigen
- Brief an den Vater
- Beziehungslosigkeit
- Die Familie: Eine Geistesamputation
- Unüberbrückbares Schweigen
- Familienverhältnisse
- DAS UNAUSSPRECHLICHE DENKEN
- Produktives Scheitern
- Das monologische Sprechen
- Zur Bestimmung des Monologischen
- Die monologische Grundhaltung des Fürsten
- Einöde des Daseins
- Geistloser Gesprächspartner
- Die Gedanken: Gesprächspartner
- Sprechen: Sich verständlich machen
- Geistige Heimatlosigkeit
- Form monologischen Sprechens
- DIE UNZULÄNGLICHKEIT DER SPRACHE
- Die Sprache: Ein Kerker
- Der Zitatcharakter der Sprache
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Darstellung des Schweigens im Roman „Verstörung" von Thomas Bernhard. Die Arbeit untersucht verschiedene Erscheinungsformen des Schweigens im Werk, sowohl als thematisiertes Motiv als auch als stillschweigend praktiziertes literarisches Phänomen. Dabei wird das Schweigen in Verbindung mit anderen Motiven wie Sprache, Einsamkeit, Familie, Krankheit und Tod untersucht.
- Die Unmöglichkeit der Kommunikation in Familienverhältnissen
- Die Unvereinbarkeit von Denken und Sprechen
- Die Unzulänglichkeit der Sprache als Mittel der Erkenntnis
- Die Verlorenheit des Individuums in einer von Traditionen geprägten Welt
- Die Bedeutung des Schweigens als Ausdruck einer existenziellen Krise
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Werk Thomas Bernhards ein und beleuchtet seine besondere Erzählform, die sich durch eine Verweigerung von traditionellen Erzählmustern auszeichnet. Bernhard verwendet in seinen Prosawerken häufig einen Ich-Erzähler, der einen Bericht über eine Person schreibt, die meist die Hauptfigur des Werkes ist. Die Einleitung zeigt auch Bernhards radikales Bestreben, „Geschichten" zu zerstören, um sich von den Grenzen des klassischen Erzählens zu befreien.
Das erste Kapitel analysiert die Darstellung des Schweigens im Kontext der Familienverhältnisse in „Verstörung". Der Roman schildert eine Familie, die von einer tödlichen Stille überschattet ist. Der Vater, ein Arzt, ist einer verstörten Welt der Krankheit und des Verbrechens ausgeliefert. Er selbst ist in seiner Kommunikation mit seiner Frau und seinen Kindern stark eingeschränkt. Der Sohn, der Berichterstatter im Roman, versucht, die „unguten Verhältnisse" innerhalb der Familie durch einen Brief an seinen Vater zu beleuchten. Dieser Brief bleibt jedoch unbeantwortet. Die Reise des Vaters und des Sohns in die Welt der Krankheit, die als Antwort auf den Brief des Sohns verstanden werden kann, führt sie schließlich zum Fürsten Saurau, der als letzte Station ihrer Reise in den Tod erscheint.
Das zweite Kapitel widmet sich dem monologischen Sprechen des Fürsten Saurau. Seine unaufhörlichen Selbstgespräche bilden den gesamten zweiten Teil des Romans. Der Fürst erscheint als eine Figur, die sich von der Außenwelt abgekapselt hat und in einem dauerhaften Zustand des Denkens gefangen ist. Er führt Gespräche mit sich selbst, die von Erinnerungen, Träumen, sprunghaften Assoziationen und Gedankensplittern geprägt sind. Das Selbstgespräch wird als Kommunikations- und Existenzform analysiert, die auf die Unmöglichkeit der Verständigung mit anderen Menschen hinweist. Der Fürst sieht in seinen Familienmitgliedern keine Gesprächspartner und betrachtet seine Umgebung als geistlos. Seine Gedanken sind seine einzigen Gesprächspartner, die er beim Spazierengehen in der Natur entwickelt. Das Sprechen wird zu einem Mittel der Selbstbegegnung, aber auch zu einer Darstellung des Zerfalls des Denkens. Der Fürst ist von Geräuschen in seinem Kopf gequält, die seine Krankheit und seinen nahenden Tod symbolisieren. Seine Selbstgespräche sind ein Versuch, sich verständlich zu machen, aber diese Versuche führen zu keiner wirklichen Kommunikation.
Das dritte Kapitel untersucht die Unzulänglichkeit der Sprache in „Verstörung". Der Fürst sieht die Wörter, die er verwendet, als nicht mehr existent an. Die Sprache ist für ihn ein Kerker, der ihn gefangen hält. Er beklagt sich über die Tradition, die ihn daran hindert, frei zu denken. Die Sprache wird zum Mittel der Selbstzerstörung und des Selbstmords. Das Sprechen des Fürsten ist von Zitathaftigkeit geprägt. Er wiederholt ständig das, was bereits gesagt wurde, ohne zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Das Sprechen wird zu einem endlosen Kreislauf der Wiederholung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Schweigen, die Mitteilungslosigkeit, die Familienverhältnisse, die Unvereinbarkeit von Denken und Sprechen, die Unzulänglichkeit der Sprache, die Tradition, die geistige Heimatlosigkeit, der Wahnsinn und der Tod. Die Arbeit analysiert die Darstellung des Schweigens in „Verstörung" von Thomas Bernhard und untersucht, wie dieses Motiv die existenziellen Krisen der Figuren im Roman widerspiegelt.
- Quote paper
- Dr. Imed Abdelwahed (Author), 2005, Die Darstellung des Schweigens in Thomas Bernhards Roman "Verstörung", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/215883