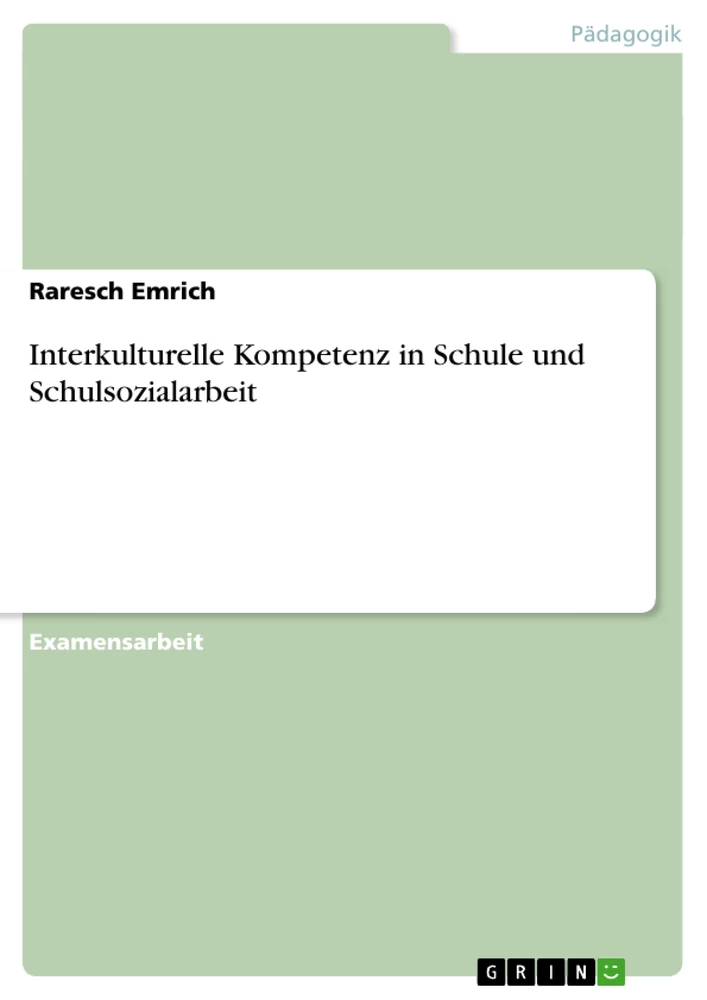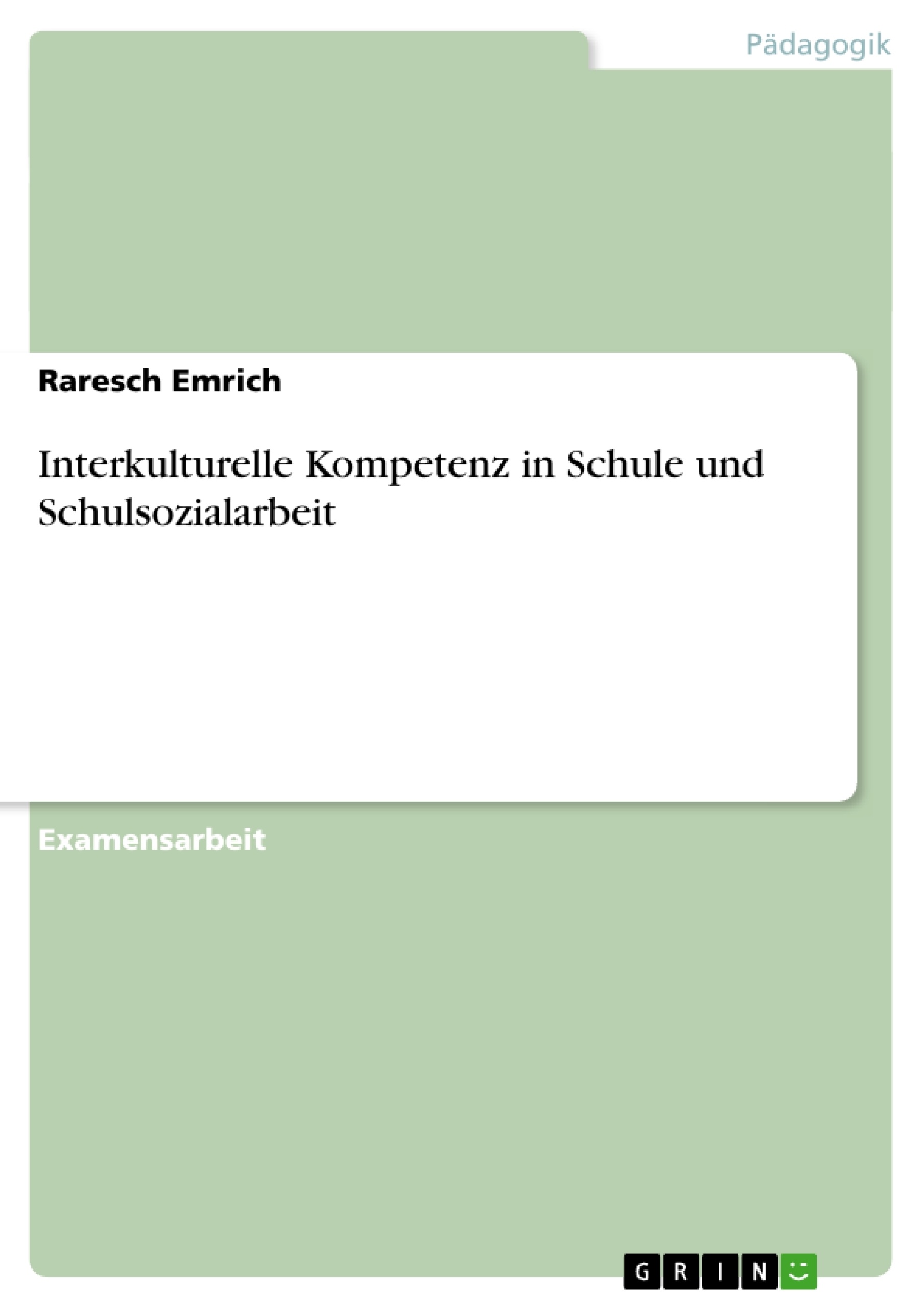Interkulturelle Kompetenz ist ein elementarer Bestandteil der pädagogischen Professionalität geworden und wird mittlerweile nicht nur in Schule sondern auch in der Schulsozialarbeit als Schlüsselqualifikation verlangt. Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderung, hin zu einem multikulturellen Deutschland, ist eine Kooperation von Schule und Schulsozialarbeit kaum mehr wegzudenken. Schulsozialarbeit versteht sich als komplementäres Glied des Bildungs- und Erziehungssystems und als ergänzendes Angebot zwischen Schule und Jugendhilfe. Die Erzieher und Lehrer der Institutionen tragen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung in ihrer Rolle. Sie prägen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung und sind dafür verantwortlich sie zu sozialen, mündigen, selbstbewussten Erwachsenen zu erziehen. Für die pädagogische Arbeit ist es daher immens wichtig, die grundlegenden Theorien Interkultureller Kompetenz zu kennen – besonders auch aufgrund der Fülle an Literatur. Auf knapp 60 Seiten bietet diese Arbeit eine Zusammenfassung der wichtigsten Grundrichtungen Interkultureller Pädagogik in Schule und Schulsozialarbeit.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Schulsituation von MigrantInnen in Deutschland
2.1 Entstehung interkultureller Erziehung und Bildung in Deutschland
2.2 Der Kulturbegriff innerhalb der Pädagogik
2.2.1 Der Begriff der Interkulturellen Kompetenz
3 Ausgangsebene Interkultureller Pädagogik
3.1 Zwei Grundrichtungen Interkultureller Pädagogik
3.2 Interkulturelle Erziehung und Bildung nach Wolfgang Nieke
4 Interkulturelle Kompetenz in Schule
4.1 Interkulturelles Lernumfeld
4.2 Interkulturelle Kompetenz bei Lehrkräften
4.3 Methoden zur Förderung interkultureller Kompetenz
4.3.1 Training Interkultureller Kompetenz
4.4 Messung interkultureller Kompetenz
4.4.1 Fragebogenverfahren
4.4.2 Kognitive Strukturtests
4.4.3 Critical Incident Methode
4.4.4 Repertory Grid
4.4.5 Assessment- Center- Verfahren
5 Kooperation von Schule und Schulsozialarbeit
5.1 Erziehung und Bildung in der Schulsozialarbeit
5.2 Interkulturelle Kompetenz in Schulsozialarbeit
5.3 Interkulturelle Kompetenz sozialer Organisationen
6 Erfolgreiches Lernen am Beispiel der Jenaplan-Schule
6.1 Grundlagen der Jenaplan-Pädagogik
6.2 Die Jenaplan- Schule Jena
7 Schlussfolgerung
8 Literatur- und Quellenverzeichnis
1 Einleitung
Die Bundesrepublik Deutschland ist durch einen sozialen und kulturellen Wandel gekennzeichnet, in dem Kinder und Jugendliche aufwachsen. Wie in anderen Staaten auch, beeinflusst die stetige Zu- und Abwanderung unsere Gesellschaft. Dies ist allerdings kein neues Phänomen, sondern hat die Gesellschaftsstrukturen schon immer geformt. Migration gehört damit zu den zentralen Motoren des Wandels, woraus sich neue Formen und Herausforderungen des Zusammenlebens ergeben. Die vielfältigen kulturellen, rechtlichen, sozialen und politischen Ursachen von Migration und die Rahmenbedingungen der Aufnahme im Einwanderungsland Deutschland, haben aus der deutschen Gesellschaft ein Land der multidimensionalen Diversität gemacht (vgl. Holzbrecher 2011, S. 91)
In Frankfurt beispielsweise, dem Zentrum des Rhein-MainGebietes, das eines der größten Migrationsräume Europas darstellt, gelten seit den Erhebungen des Mikrozensus 2009 nahezu 60 % der Einwohner und Einwohnerinnen als Migranten. Jeder dritte junge Mensch in der EU weist einen Migrationshintergrund auf (vgl. ebd.). Im gesamten Bundesgebiet beträgt der Anteil der Bevölkerung mit unmittelbarer Migrationsgeschichte 19%, mit steigender Tendenz (vgl. Mecheril 2004, S. 8). Die Interkulturelle Pädagogik nimmt Bezug auf die daraus resultierende, gesellschaftliche Heterogenität und den damit verbundenen Bildungsmöglichkeiten und Bildungschancen der Heranwachsenden. Studien im Rahmen von PISA (Programme for Intenational Student Assesment) haben auf die Benachteiligung Heranwachsender mit Migrationshintergrund, darunter auch jene, die mehrsprachig aufgewachsen sind, aufmerksam gemacht und die bildungspolitische Debatte in Deutschland neu entfacht. Damit ist die Bildungssituation der Migrantenkinder zunehmend in den Forschungsschwerpunkt gerückt. Für LehrerInnen[1] und SchulsozialarbeiterInnen bedeutet die veränderte Schulsituation, in der Schülerinnen die unterschiedlichsten Werte und Normen mitbringen, eine neue Herausforderung. Ziel ist es, MigrantInnen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, unabhängig ihrer Herkunft und unter Anerkennung und Förderung ihrer individuellen Ressourcen (vgl. Fischer 2005, S. 7). Dieses Bestreben soll mit Hilfe der Bildungs- und Erziehungseinrichtungen erreicht werden, denn eine multikulturelle Gesellschaft bedarf einer multikulturell ausgerichteten Schule. Im Zuge dieses Prozesses hat sich die Interkulturelle Pädagogik ausgebildet und mit ihr der Begriff der Interkulturellen Kompetenz, welcher, als Schlagwort zur Beschreibung und Bewältigung der multikulturellen Schullandschaft dient. Die vorliegende Arbeit betrachtet Interkulturelle Kompetenz im Kontext der Schule und Schulsozialarbeit und leistet einen Beitrag zu der Frage, in wie weit die Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund durch Interkulturelle Kompetenz verbessert werden und die Selektionsmechanismen des deutschen Schulsystems gemildert werden können.
In Anbetracht meiner zukünftigen Arbeit als Lehrer, werde ich meinen Schwerpunkt auf den Handlungsbereich der Schule legen und Schulsozialarbeit als komplementäres Glied und kooperativen Partner im Kontext der Schule vorstellen. Um mich mit der Leitfrage auseinanderzusetzen werde ich zunächst auf die Entstehungsgeschichte Interkultureller Erziehung und Bildung in unserer Gesellschaft eingehen und den dynamischen Kulturbegriff erläutern, da ohne eine angemessene Definition dessen, was Kultur ist, die Beschäftigung mit Interkultureller Kompetenz unbefriedigend wäre. Im Anschluss an den Kulturbegriff werde ich folglich Interkulturelle Kompetenz definieren und die Ausgangsebene dafür auf der Grundlage von Roths und Niekes aufgestellten Grundprinzipien behandeln. Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit Interkultureller Kompetenz folgt ein Kapitel zur praktischen Umsetzung an Schulen, wobei nicht nur Lernumgebung und Methoden zur Förderung Interkultureller Kompetenz, sondern auch Messverfahren dazu vorgestellt werden. Im letzten Teil meiner Arbeit soll die Jenaplan- Schule als Beispiel einer gelingenden Schule vorgestellt werden. Eine Schlussfolgerung am Ende meiner Arbeit soll die zu anfangs gestellte Leitfrage nochmals aufgreifen und zusammenfassend beantworten.
2 Schulsituation von MigrantInnen in Deutschland
Welche Auswirkungen Bildung und Ausbildung auf den Stellenwert des gesellschaftlichen Integrationsprozesses von Migranten haben kann, behandelt der Migrationsbericht der damaligen Ausländerbeauftragten (vgl. Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, 1999, S. 124). Darin wurde festgehalten, dass ein qualifizierter Schulabschluss sowie eine abgeschlossene Berufsausbildung, einen entscheidenden Beitrag zur stabilen Integration von Jugendlichen ausländischer Herkunft mit niedrigem Bildungsniveau leisten. Die niedrige Akzeptanz von MigrantInnen bei der einheimischen Bevölkerung erschwert ihnen zudem nicht nur die berufliche, sondern auch die soziale Integration (vgl. ebd.).
Der aktuelle Stand im deutschen Bildungssystem bestätigt, dass SchülerInnen ausländischer Herkunft nach wie vor an Haupt- und Sonderschulen überrepräsentiert und an Realschulen und Gymnasien deutlich unterrepräsentiert sind. Internationale Schulleistungsstudie wie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PISA und PIRLS/ IGLU haben erneut die Bildungsbenachteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, und darunter auch von jenen, die mehrsprachig aufgewachsen, im deutschen Schulsystem bestätigen können (vgl. Mecheril/ Dirim/ Gomolla/ Hornberg/ Stojanov 2010, S. 121). Beim Schulbesuch, bei Schulabschlüssen sowie in der beruflichen Ausbildung bestehen zwischen deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen weiterhin signifikante Unterschiede.
Zu der Problematik, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund einer stärkeren Förderung bedürfen, äußert sich Gogolin auseinander:
„Sie verharren überrepräsentativ im ,niedrigeren‘ Schulwesen, sie verfehlen häufiger selbst den Hauptschulabschluss, sie bleiben überdurchschnittlich oft ohne jegliche Berufsausbildung“ (Gogolin 2003, S. 1).
Dies führt er auf den deutlichen Leistungsrückstand dieser Schülerinnen im Leseverständnis der deutschen Sprache zurück. Die sprachlichen Mängel lösen auch Schwächen in anderen Leistungsbereichen aus. Soweit die statistischen Daten eine Nationaldifferenzierung zulassen, zeigen sich Tendenzen, dass Jugendliche spanischer Herkunft die erfolgreichste Gruppe darstellen, gefolgt von Jugendlichen griechischer und portugiesischer Herkunft. Am ungünstigsten stellt sich die Schulbildung Jugendlicher italienischer und türkischer Nationalität dar (Ausländerbeauftragte 1999, S. 129).
2.1 Entstehung interkultureller Erziehung und Bildung in Deutschland
Zum Thema Interkulturelle Pädagogik findet man innerhalb der Erziehungswissenschaft zahlreiche Diskussionen. Hervorzuheben ist allerdings der Umstand, dass die Pädagogik, die sich mit Menschen unterschiedlicher kultureller und ethnischer Merkmale beschäftigt, in Deutschland erst sehr spät entwickelt wurde. Im Zuge der Arbeitsmigration entstand zunächst die sogenannte Ausländerpädagogik (vgl. Gudjons 2003, S. 361). Im folgenden Teil soll mit Hilfe von Nieke (2008, S. 17-21), der die pädagogischen Probleme der Zuwanderung in sechs Phasen gliedert, ein Abriss über die Entstehung der Interkulturellen Pädagogik gegeben werden.
1. Phase: Gastarbeiterkinder an deutschen Schulen: „Ausländerpädagogik als Nothilfe“
Als erkannt wurde, dass der Aufenthalt der Gastarbeiter nicht dem Rotationsprinzip zur Folge von kurzer Dauer sein würde, trat auch für ausländische Kinder die Schulpflicht in Kraft. Die Mängel der deutschen Sprache ließen einen geregelten Unterricht allerdings nicht zu.
„Die Praktiker in den Schulen oder anderen Erziehungseinrichtungen hatten fehlende Voraussetzungen, Vorkenntnisse, Schulerfahrungen, nicht zuletzt fehlende Kenntnisse der Unterrichtssprache ,Deutsch‘ (...) als Defizit wahrgenommen, die ihre Arbeit erschwerten oder unmöglich machten“ (Diehm/ Radtke 1999, S. 128).
Auf die teilweise unübersehbare Vergeblichkeit ihrer Versuche, die Defizite durch fördernden Unterricht zu kompensieren, reagierten die Praktiker nicht mit einer kritischen Überprüfung ihrer Maßnahmen, sondern sie erklärten sich das Scheitern mit der herkunftskulturell geprägten psycho-sozial Ausstattung der Kinder und ihrer Familien.
Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Didaktik um Deutsch als Zweitsprache zu erlernen. Als Antwort für das Problem entstanden Förderklassen, in denen die SchülerInnen auf den deutschsprachigen Unterricht vorbereitet werden sollten.
2. Phase: Kritik an der Ausländerpädagogik
Die damals neu geschaffene Ausländerpädagogik wurde stark kritisiert. Es hieß, dass versucht werde, politische Probleme durch die Pädagogik zu lösen. Die Pädagogik versuchte politische Probleme zu lösen, war jedoch nur im Stande die soziokulturellen Missstände zu lindern. Aufgabe der Politik ist es gewesen, diese auch gesellschaftlich zu lösen (vgl. Nieke 2008, S. 15 f). Zugleich wurde der Begriff der Ausländerpädagogik als Stigmatisierung gesehen, weil dabei eine besondere Ausländerpädagogik geschaffen werden müsse.
„Der Begriff dient als Verlegenheitslösung und steht deshalb meist in Anführungsstrichen, um deutlich zu machen, daß [sic] man sich zwar der möglicherweise stigmatisierenden Wirkung des Wortes bewusst ist, sich aber noch nicht für einen anderen Begriff entscheiden konnte“ (Kämper 1992, S. 11).
Die entwickelten Konzeptionen bezogen sich nur auf die MigrantInnen und schlossen die Einheimischen aus. Diese wurden nur als Messinstrumente benutzt, um an ihnen die Defizite der Ausländer festzumachen und entsprechend auszugleichen (vgl. Nieke 2008, S. 16).
Gudjons (2003, S. 361) spricht auch polemisch von einer Zwangs- germanisierung, da es den Anschein macht, als würden die Maßnahmen tendenziell zu einer Akkulturation führen. Die MigrantInnen müssten sich dementsprechend der dominanten Mehrheitskultur unterordnen, so dass die Integration einseitig geschehe. Dieser Arroganz dürfte nicht stattgegeben werden, da die Möglichkeit der Rückkehr in das Herkunftsland bestehen blieb (vgl. Nieke 2008, S. 16).
Trotz der Kritik an der Ausländerpädagogik kam man zu der Überzeugung, die Entwürfe innerhalb einer interdisziplinären Forschungsdisziplin zu subsumieren (vgl. Jungmann 1995, S. 14). Im Hinblick darauf, dass alle Kulturen gleichwertig sind, entstanden die Konzepte der Interkulturellen Pädagogik in einer multikulturellen Gesellschaft (Nieke 2008, S. 17). Es kam deshalb zu einer Abkehr der Defizithypothesen hin zu einer Differenzhypothese beziehungsweise Kulturkonfliktthese (vgl. Jungmann 1995, S. 14).
3. Phase: Konsequenzen aus der Kritik: Differenzierung von Förderpädagogik und Interkultureller Erziehung
Im Hinblick auf die Tatsache, dass der Aufenthalt der meisten Ausländer von Dauer werden sollte, wurde der Versuch unternommen, unter einem neuen pädagogischen Aspekt heraus Fördermaßnahmen der Interkulturellen Erziehung zu entwickeln, die sich auf Kinder und Jugendliche ausländischer Herkunft bezogen (vgl. Nieke 2008, S. 18).
Man sah sich zu diesem Zeitpunkt auch gezwungen den Kulturbegriff zu definieren und zwischen Herkunftskultur und Migrantenkultur zu unterscheiden (vgl. Auernheimer 2007, S. 34ff.). Daraus entstand wiederum die Kritik, dass die Kultur der MigrantInnen „eine im Aufnahmeland funktionslos werdende Kultur, als bloße Folklore, zu konservieren“ sei (Nieke 2008, S. 18). Ebenso wurde die Befürchtung geäußert, dass die kulturellen Differenzen überbetont werden könnten. Dadurch könnte die Diskriminierung verstärkt und die Re-Ethnitisierung der MigrantInnen angetrieben werden (vgl. ebd.).
4. Phase: Erweiterung des Blicks auf die ethnische Minderheiten
Das Blickfeld wurde mit der Zeit von den Gastarbeitern auf weitere ethnische Minderheiten, wie etwa Flüchtlinge oder Sinti und Roma, erweitert (vgl. Nieke 2008, S. 18).
5. Phase: Interkulturelle Erziehung und Bildung als Bestandteil der Allgemeinbildung
Es setzte sich die Anschauung durch, dass es innerhalb einer multikulturellen Sozialstruktur der Gesellschaft für alle Beteiligten wichtig ist, sich in einer pluralen Gesellschaft bewegen zu können. Innerhalb der Schule wurde daher versucht diesen Wunsch in die Bildungsbemühungen zu integrieren (vgl. Nieke 2008, S. 19). Auernheimer (2007, S. 37ff.) fügte hinzu, dass durch den Daueraufenthalt der zugewanderten Arbeiterfamilien außerschulische pädagogische Arbeitsfelder, wie die Jugendarbeit oder die Schulsozialarbeit, immer bedeutsamer wurden.
6. Phase: Neo-Assimilationismus
Seit den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 hat die Diskussion einer dauerhaft multikulturellen Gesellschaft neue Formen angenommen. Fremde Kulturen werden seit diesem Zeitpunkt von einigen Einheimischen nicht mehr so erwünscht. Muslime werden sogar unter Generalverdacht gestellt Deutschland zu bedrohen. Aus diesem Kontext heraus hat sich die Toleranzbereitschaft stark verringert, so dass die „die bisherigen Diskurse des Neo-Assimilationismus davon gekennzeichnet sind, dass sie faktisch eine Zwangsakkulturation fordern, also eine Anstrengung der Zuwanderer, ihre Herkunftskultur zu verlassen und sich der Mehrheitskultur möglichst vollständig anzupassen“ (Nieke 2008, S. 21). Wer sich nicht anpasst, wird mit Sanktionen bestraft, die sogar bis hin zur Ausweisung reichen können.
Weiterhin sagt Nieke (2008, S. 21), „die pädagogischen Bemühungen wenden sich zunehmend von einer interkulturellen Erziehung und Bildung ab und hin zu einer Integrationsförderung mit Akkulturati- onsunterstützung“. Er stellt bei seinen Ausführungen auch die Frage, ob der Konflikt eine bloße Phase beziehungsweise Entwicklung sei oder diese Phase eventuell das Ende der Interkulturellen Pädagogik einleite.
2.2 Der Kulturbegriff innerhalb der Pädagogik
Der gegenwärtige Standpunkt der Erziehungswissenschaft geht von einer multikulturellen Gesellschaft aus, in der das Prinzip der Gleichheit und Anerkennung gilt (vgl. Auernheimer 2007, S. 20). Anerkennung meint dabei die kulturellen Formen und Inhalte und darf nicht mit Toleranz gleichgesetzt werden, da der Begriff der Toleranz eine Art Machtassymetrie und damit die Duldung der Minorität von der Majorität impliziert.
Als Gleichheit ist „das Eintreten für die Gleichheit aller ungeachtet ihrer Herkunft“ zu verstehen (ebd., S. 21). Die Interkulturelle Pädagogik strebt an, die Verschiedenheit und Gleichwertigkeit aller Kulturen anzuerkennen und segregierende beziehungsweise assimilatorische Tendenzen zu lokalisieren und aufzulösen. Damit bezieht sie sich auf eine kulturrelativistische Variante. Bevor jedoch darauf eingegangen werden kann, muss der Kulturbegriff definiert werden.
Jede Arbeit, die sich mit der Thematik der Migration beschäftigt, bezieht sich auch unmittelbar auf den Begriff der „Kultur“. Traditionell ist in der Pädagogik zahlreiche Literatur über das Verhältnis zwischen Erziehung, Bildung und Kultur geschrieben worden (vgl. Nieke 2008, S. 37). Dennoch ist eine eindeutige Definition was Kultur ist, äußerst schwierig. Es stellt sich stattdessen heraus, dass das Wort „Ethnie“ schon synonym für „Kultur“ verwendet wird.
Das Wort „Ethnie“ ist aus dem griechischen entlehnt und bedeutet „Volk“. Dabei meint Volk hier nicht das schriftlich tradierte Volk oder eines das sich als Nation versteht, sondern vielmehr ein Volk, das sich als zu einem Stamm zugehörig ansieht und dessen Vorfahren ursprünglich gleich sind (vgl. ebd. S. 38). Weiterhin beschreibt Nieke (2008, S. 37), dass Ethnien anhand folgender Kriterien unterschieden werden: Sprache, Rasse, Religion, Kultur, kollektive Selbstdefinition und ein gemeinsamer Siedlungsraum. Um von einer Ethnie sprechen zu können, müssen nicht zwangsweise alle Merkmale zutreffend sein. Es reichen auch schon wenige Merkmale aus, da „Ethnie“ ein Sammelbegriff mehrerer Eigenschaften eines Volkes ist, in dem ein Charakteristikum davon die Kultur ist, wobei die Kultur wiederum nur einen Aspekt der ganzen Ethnie beschreibt (vgl. ebd., S. 39).
Spricht man nun von Kulturkonflikten beinhaltet dies eine Kontroverse, in der es um die Konkurrenz von Siedlungsräumen und deren Ressourcen oder um das Fremdartige bezüglich der Merkmale von Rassenunterschieden geht. Genauso wird der Begriff der Ethnie für die Betrachtung von Lebenslagen zugewanderter Minoritäten benutzt, was sowohl in der Fremd- als auch in der Selbstwahrnehmung geschieht, wobei hier meistens der Begriff „Ethnizität“ gebraucht wird (vgl. Nieke 2008, S. 39ff.).
„Ethnizität wird (...) verwendet als Bezeichnung für eine Bindung bzw. Identifikation mit einem kulturell definierten Kollektiv, dem vergemeinschaftende Qualität zugeschrieben wird“ (Hamburger 2009, S. 116).
Ursprünglich, erklärt Nieke (2008, S. 40), sei der Begriff der „Kultur“ benutzt worden, um sich von der Natur abzugrenzen. Er bezeichnet damit Natur, als die vom Menschen unbehandelte reine Natur. Kultur meint auch die „zweckfreie Schöpfung des Geistes“ (Nieke 2008, S. 40), wie beispielsweise die Kunst oder die Philosophie. Ebenso fällt unter dem Terminus der Kultur „die Gesamtheit aller Symbole und ihrer materiellen Manifestation“ (ebd.), also die Kodierung von Gegenständen auf ein universelles Verständigungssystem. Kultur zeigt sich außerdem auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen, wie zum Beispiel Riten, Bräuchen, Sitten, Normen, Werten und vielem mehr, in der Werteorientierung, religiösen Deutungsmustern und in der Sprache (vgl. ebd., S. 40ff.). Es handelt sich also nicht um abgeschlossene, unveränderbare Konstanten, sondern um ein dynamisches,
„ein in Bewegung befindliches, adaptionsfähiges System. Es ist nicht hierarchisch aufgebaut, sondern reflexiv, heterogen und besteht aus mehreren, losen miteinander verkoppelten Systemebenen. Es enthält unterschiedliche Organisationsmuster und seine Grenzen sind nicht genau angebbar“ (Hamburger 2009, S. 108).
Es ist demensprechend schwierig eine genaue Definition für den Begriff der Kultur zu finden, denn Kultur fließt in alle Deutungs- und Orientierungsmuster ein, welche Kollektive untereinander steuern (vgl.
Auernheimer 1999, S. 28) und sich im Kontext der Sozialisation interna- lisiert haben. Sie ist im Unterbewusstsein vorhanden und daher ist es „nicht ohne aufwändige Verfahren der Bewusstwerdung und Reflexion möglich, aus den Denkprägungen und Handlungsschablonen der jeweiligen Kultur herauszukommen“ (Nieke 2008, S. 44).
Die Pädagogik versucht ethnozentrische Sichtweisen mithilfe dieser intensiven Reflexion zu identifizieren. „Ethnozentrismus“ wird auch bezeichnet als:
(...) den Terminus, der für Gruppenbezogenheit verwendet wird; er bezeichnet die Tendenz, die eigene Kultur als den anderen überlegen oder als ,besser‘ als die anderen anzusehen“
(Vivelo 1995, S. 46).
Das Gegenteil der gruppenbezogenen Ansicht ist der Kulturrelativismus, der die Andersartigkeit von Kulturen anerkennt und sie nicht bewertet. In der Praxis bedeutet dies, dass man seine eigene Kultur nicht als den Standard betrachtet und gegenüber anderen Kulturen frei von Vorurteilen bleibt (vgl. ebd.).
Die völlige Neutralität birgt aber die Gefahr in sich handlungsunfähig zu werden, denn ohne davon fest überzeugt zu sein, dass die eigene Weltansicht die richtige ist, ist ein Handeln unmöglich, weil es sich „auf einen Bezugsrahmen von nicht ständig bezweifelten und unsicheren Deutungsmustern stützen muss“ (Nieke 2008, S. 146).
Auch Prengel betont, dass andere Kulturen anzuerkennen nicht gleichzusetzen sei mit der bedingungslosen Akzeptanz dieser, da es innerhalb einiger Kulturen hinsichtlich der Menschenrechte Verstöße gäbe, die nicht einfach so hingenommen werden dürfen (vgl. Prengel 1995, S. 87). Der Leitgedanke der Interkulturellen Pädagogik ist es verstehen zu wollen, dass Menschen kulturell geprägt und zu begreifen, welche Besonderheiten, Möglichkeiten und Grenzen sich daraus ergeben (vgl. ebd., S. 90). Im besonderen Maße ist es wichtig darauf zu achten, welche Chancen und Potenziale dies zur Folge hat, um diese in der Folge zu verstärken.
2.2.1 Der Begriff der Interkulturellen Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz meint die Fähigkeit von Individuen „mit Situationen in der Einwanderungsgesellschaft umzugehen“ (Fischer/ Springer/ Zacharaki 2005, S. 7). Es ist darauf zu achten wann und wie der Begriff der Interkulturellen Kompetenz verwendet wird, da selbst Wolfgang Hinz-Rommel (1999, S. 17) der Wegbereiter dieses Begriffs in Deutschland, feststellend sagt, dass mit zunehmender Auseinandersetzung mit dem Thema Interkulturelle Kompetenz der Begriff für ihn „verschwimmt“. In der Verwendung des Begriffs hat sich allerdings das Verständnis etabliert, dass in Interkultureller Kompetenz viele soziale, kommunikative und methodische Kompetenzen zusammenwirken. Dazu gehören vor allem die Empathiefähigkeit, Akzeptanz, Ambiguitätstoleranz -also das Aushalten von Fremdheit, Konfliktfähigkeit, eine personenzentrierte Haltung in Gesprächen, aktives Zuhören, Beobachtungsgabe und Fähigkeit zur Anpassung des eigenen Handlungsrahmens an die neuen, kulturellen Anforderungen unserer Gesellschaft (vgl. Fischer et al.2005, S. 7 ff.).
Interkulturelle Kompetenz ist dementsprechend die Voraussetzung dafür, mit denjenigen Menschen sensibel umgehen zu können, die eine andere kulturelle Identität besitzen. Dazu bedarf es der Selbstreflexion, die den Grundstein für die eigene, im weitesten Sinne antirassistische Werthaltung, legt (vgl. Grünhage-Monetti 2006, S. 30).
Bei der Behandlung des Terminus der Interkulturellen Kompetenz geht es folglich um die Kulturdimension der Einwanderer. Wie bereits beschrieben, wird zum einen ein sensibler Umgang mit den unterschiedlichen Herkunftskulturen verlangt, zum anderen aber soll die Individualität der MigrantInnen gewahrt werden, was in diesem Postulat zu Widersprüchlichkeiten führt. Alexander Thomas, Stefan Kammhuber und Stefan Schmid (2005, S. 188) fassen fünf Punkte zur Bestimmung Interkultureller Kompetenz zusammen:
1. Interkulturelle Kompetenz ist erforderlich, um angemessene, erfolgreiche und zufriedenstellende Kommunikationen zwischen allen Individuen herzustellen. Sie ist das Fundament für die Begegnung und Kooperation von Menschen verschiedener Kulturen.
2. Interkulturelle Kompetenz ist das Resultat eines Lern- und Entwicklungsprozesses.
3. Um Interkulturelle Kompetenz erwerben zu können, muss die Offenheit gegenüber fremden Kulturen gewährleistet sein.
4. Interkulturelle Kompetenz kennzeichnet sich durch die Fähigkeit, sich und andere wahrzunehmen, zu beurteilen, respektieren und würdigen.
5. Ein hohes Maß an Interkultureller Kompetenz ist dann erreicht, wenn ein differenziertes Urteilsvermögen über andere Kulturen besteht und aus dem Vergleich zwischen den unterschiedlichen Kulturen eine „kulturadäquate Reaktions-, Handlungs- und Interaktionsweise generiert werden kann“. Desweiteren zeigt sich die Intensität der Interkulturellen Kompetenz in kulturellen Überschneidungssituationen, in denen „alternative Handlungspotenziale, Attributionsmuster und Erklärungskonstruktionen“ verlangt werden. In diesen Situationen, der kulturellen Begegnung, ist Handlungskreativität, Handlungsreflexivität und Handlungssicherheit gefragt.
3 Ausgangsebene Interkultureller Pädagogik
Der Grundstein der Interkulturellen Pädagogik ist nach Roth „eine Anthropologie, die von der Würde und Freiheit des Einzelnen ausgeht, von seiner Subjekthaftigkeit“ (Roth 2002, S. 105). Weiterhin führt er an, „dass der Mensch als soziales Wesen seine soziale Wirklichkeit wie auch seine personale Identität in Beziehung und Interaktion erwirbt und gestaltet“ (ebd.). Nach diesen Grundprinzipien stellt Roth Vierzehn Punkte der Interkulturellen Pädagogik auf, welche die Ziele der Interkulturellen Pädagogik richtungsweisend aufzeigen sollen. Alfred Holzbrecher, Professor für Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Breisgau, sieht die Aufstellung Roths (2002, S. 88 ff) als eine der umfassendsten Zusammenstellungen der Prinzipien Interkultureller Pädagogik.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anstatt wie Roth interkulturelle Standpunkte in den verschiedenen Wirkungsräumen aufzudecken, beschränkt sich Auernheimer (2007, S. 21 f.) mehr auf einen verhaltensbestimmenden Orientierungspunkt. Er richtet sich dabei an die Grundprinzipien der Interkulturellen Pädagogik, nach denen jede pädagogische Haltung auf der Grundlage einer Plura- len Gesellschaft analysiert werden sollte.
Zum einen unterscheidet Auernheimer zwischen den Haltungen, die sich auf Anerkennung und Gleichheit stützen und zum anderen auf das Wissen, welches zum interkulturellen Verstehen und dem interkulturellen Dialog befähigt. Gleichheit meint bezogen auf Interkulturelle Pädagogik, dass alle Menschen unabhängig ihrer Herkunft, die gleichen Rechte und sozialen Chancen haben sollen und dass ihre Andersartigkeit respektiert und jeder Mensch als Rechtssubjekt anerkannt werden muss (vgl. ebd.).
Jedes Individuum, welches zu einem „mündigen Staatsbürger“ erzogen werden soll, hat nach Roth (2002, S. 125) auch den Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Genau dieser Punkt gilt im Hinblick auf Deutschland allerdings nicht, da sich die deutsche Staatsbürgerschaft hauptsächlich aus dem Abstammungsrecht und nicht durch die Teilnahme an Bildung oder der Art und Weise der Lebensführung als „mündiger Staatsbürger“ ergibt.
Es entsteht dementsprechend eine paradoxe Situation für Migran- tInnen. Auf der einen Seite werden sie durch das Bildungswesen zu Menschen erzogen, „die aus eigener Überzeugung, Entschließung und Verantwortung zum politisch Handelnden [werden], um zum Erhalt, gegeben falls aber auch zur Veränderung des Staatswesens [beitragen sollen]“ (vgl. ebd., S.123), ihnen aber zugleich das Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft verwehrt wird, um im Sinne Roths ein „mündiger Staatsbürger“ werden zu können. Gleichheit herrscht also nicht auf den gesamten Gesellschaftebenen und sollte aufgrund dessen besonders im Fokus der Pädagogik stehen, wobei darauf zu achten ist, dass keine Pädagogisierung von politischen Fragen stattfindet. Eine weitere Forderung der Gleichheit besteht in der „antirassistischen Erziehung“. Dabei soll berücksichtigt werden, dass es Unterschiede gibt und eine Trennung zwischen Eigenem und Fremden immer automatisch und oft unterbewusst erfolgt (vgl. Auernheimer 2007, S. 22).
[...]
[1] In der vorliegenden Arbeit werde ich die „I-Form“ benutzen, um beide Geschlechter anzusprechen und den Text leserfreundlich zu gestalten.
- Quote paper
- Raresch Emrich (Author), 2012, Interkulturelle Kompetenz in Schule und Schulsozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/215351