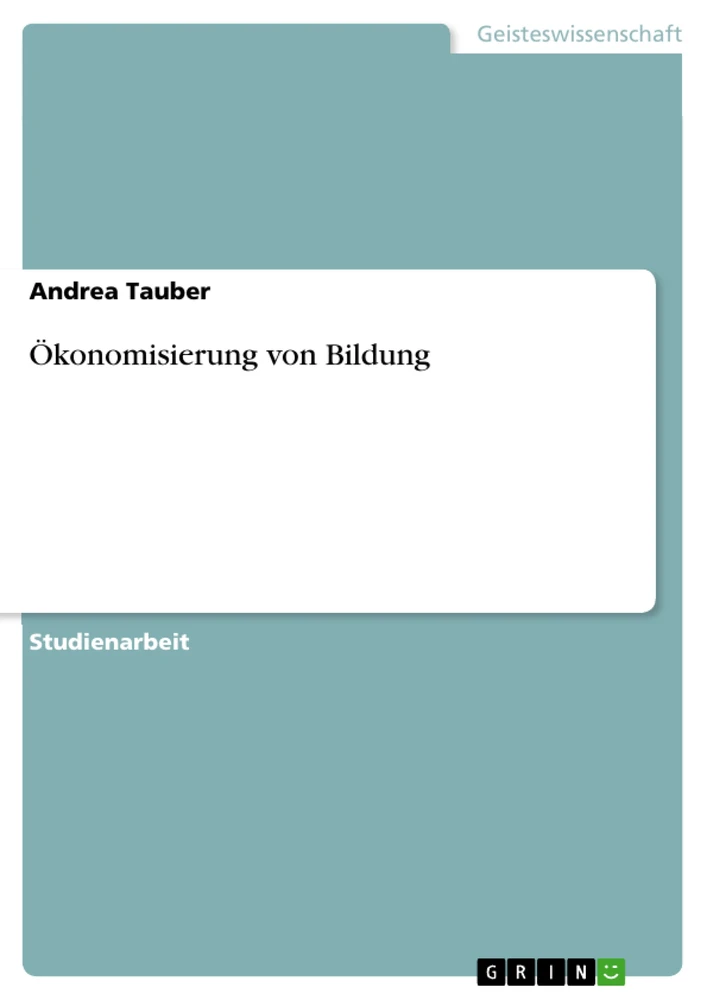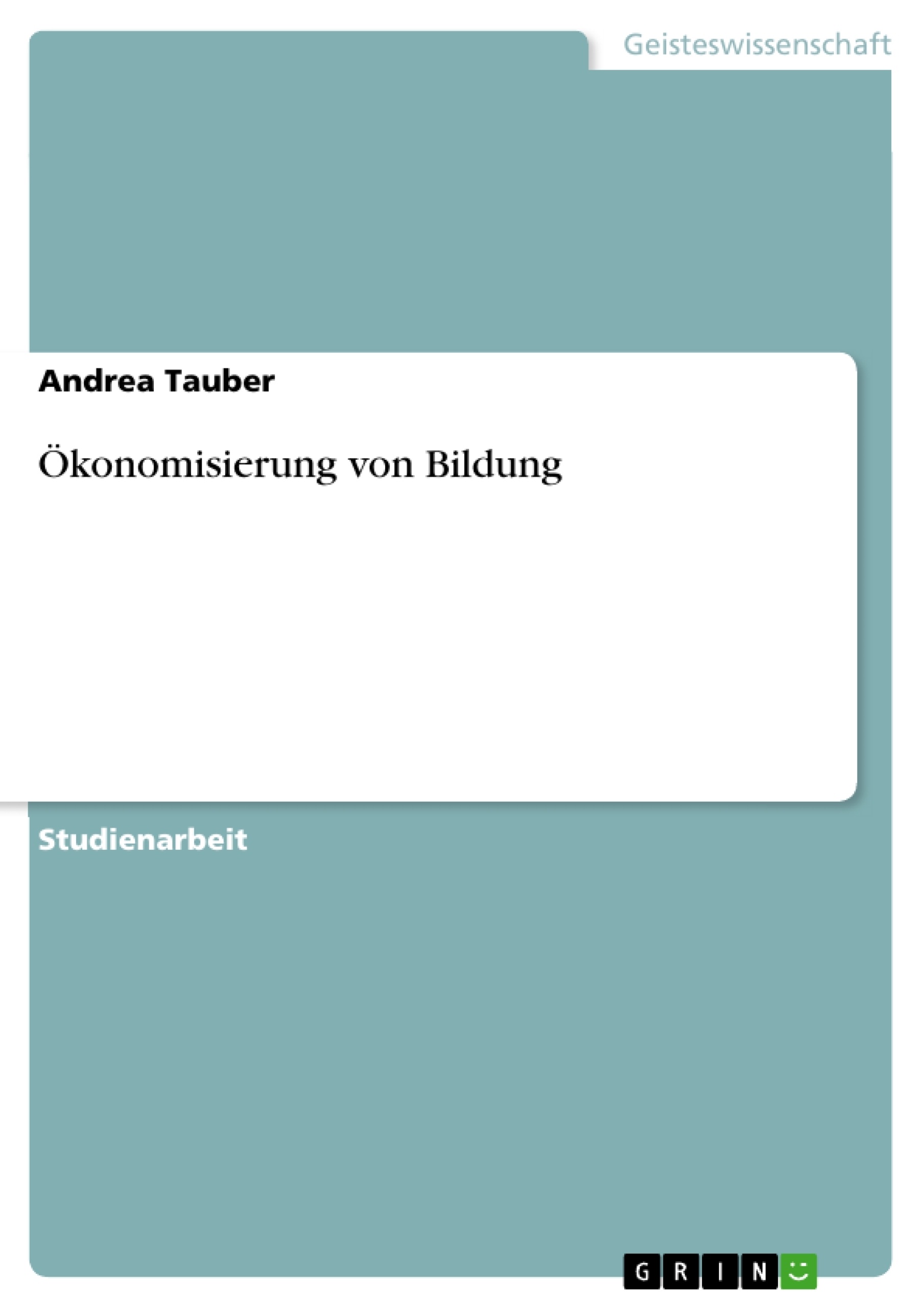Seit der Veröffentlichung der ersten PISA Studie des Jahres 2000 wurde in Deutschland ein öffentlicher bildungspolitischer sowie pädagogischer Diskurs in Gang getreten. Ein Aufschrei ging durch das einstige Land der Dichter und Denker, weil mittlerweile 15 jährige deutsche Schüler/Innen im internationalen Vergleich zu schlecht abschnitten. Wie sollte die Bildungspolitik nun mit dieser Blamage umgehen? Kein anderes Land, das an der PISA Studie teilgenommen hatte, ließ sich von den Testergebnissen derart unter Druck setzen, wie es in Deutschland der Fall war. Öffentliche Debatten gingen durch die Presse, in Talkshows wurden sogenannte „Experten“ zu Rate gezogen und jeder Laie avancierte plötzlich zum Kritiker des Deutschen Bildungssystems. In dem PISA Test wurde allerdings nicht nach abrufbarem Wissen gefragt, sondern aufgrund der internationalen Vergleichbarkeit, sollten SuS aus bestimmten Texten heraus, unterschiedliche Fragen beantworten. Gelernte Inhalte verloren plötzlich an Relevanz. Vielmehr ging es darum, dass SuS nach Ende der Pflichtschulzeit bestimmte Kompetenzen vorweisen konnten. Juliane Hammermeister lehnt die Schlüsselkompetenzen der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ab, da diese ihrer Meinung nach „Ausdruck neoliberaler Hegemonie“ sind (Hammermeister 2010: 94). Der sich vollzogene Paradigmenwechsel von der Input-Orientierung auf Lehrpläne hin zu einer Output-Orientierung auf sogenannte Bildungsstandards hin diene ausschließlich der zukünftigen Verwertbarkeit der SuS auf dem Arbeitsmarkt (vgl. ebenda: 92f.).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildung
- Ökonomisierung von Bildung
- Wandlung des Bildungsbegriffs
- Gegenwärtige Situation
- Humankapital
- Employability
- Ökonomisierung von Bildungsinhalten
- Ökonomisierung von Bildungsdienstleistungen
- Ökonomisierung von Bildungsinstitutionen und pädagogischen Beziehungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Ökonomisierung von Bildung und das Konzept der Employability. Sie beleuchtet die Entwicklung des Bildungsbegriffs im Kontext der ökonomischen Interessen und analysiert die Auswirkungen dieser Entwicklung auf Bildungsinhalte, -dienstleistungen, -institutionen und pädagogische Beziehungen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Ökonomisierung von Bildung zu erlangen und ihre Bedeutung für die Gestaltung des Bildungssystems zu erörtern.
- Entwicklung und Wandel des Bildungsbegriffs
- Einfluss ökonomischer Interessen auf die Gestaltung von Bildung
- Konzepte wie Humankapital und Employability im Kontext der Bildungsökonomie
- Dimensionen der Ökonomisierung von Bildung: Bildungsinhalte, -dienstleistungen, -institutionen und pädagogische Beziehungen
- Bedeutung der Ökonomisierung für die Zukunft des Bildungssystems
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Ökonomisierung von Bildung im Kontext der PISA-Studie und des öffentlichen Diskurses in Deutschland dar. Sie beleuchtet die Kritik an den Schlüsselkompetenzen der OECD und den Paradigmenwechsel von Input- zu Outputorientierung in der Bildung. Außerdem wird die Leitfrage der Ausarbeitung formuliert: Was ist unter Ökonomisierung von Bildung zu verstehen?
- Bildung: Dieses Kapitel analysiert den Bildungsbegriff und seine vielfältigen Facetten. Es zeigt auf, dass Bildung nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Denkweise, Eigenschaften, sozialen Umgangsformen und bewussten Handlungen verbunden ist. Die Abhängigkeit von Bildung vom Elternhaus und die Steuerung durch Politik und Wirtschaft werden ebenfalls thematisiert.
- Ökonomisierung von Bildung: Wandlung des Bildungsbegriffs: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln der Ökonomisierung von Bildung und zeigt auf, wie der Bildungsbegriff im Laufe der Zeit eine Veränderung erfuhr. Die Einführung der Mittelschule und die Schulreform von 1964 werden als Beispiele für die wachsende Bedeutung der Wirtschaft im Bildungssystem genannt. Der klassische Bildungsbegriff, der den Selbstzweck des Menschen im Vordergrund sah, wurde durch einen ökonomisch geprägten Bildungsbegriff ersetzt, der die berufliche Ausbildung in den Mittelpunkt stellte.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokusgebiete der Ausarbeitung sind Ökonomisierung von Bildung, Bildungsbegriff, Employability, Humankapital, Bildungspolitik, Bildungsstandards, PISA-Studie, OECD, und Chancenungleichheit.
- Arbeit zitieren
- Andrea Tauber (Autor:in), 2013, Ökonomisierung von Bildung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/215071