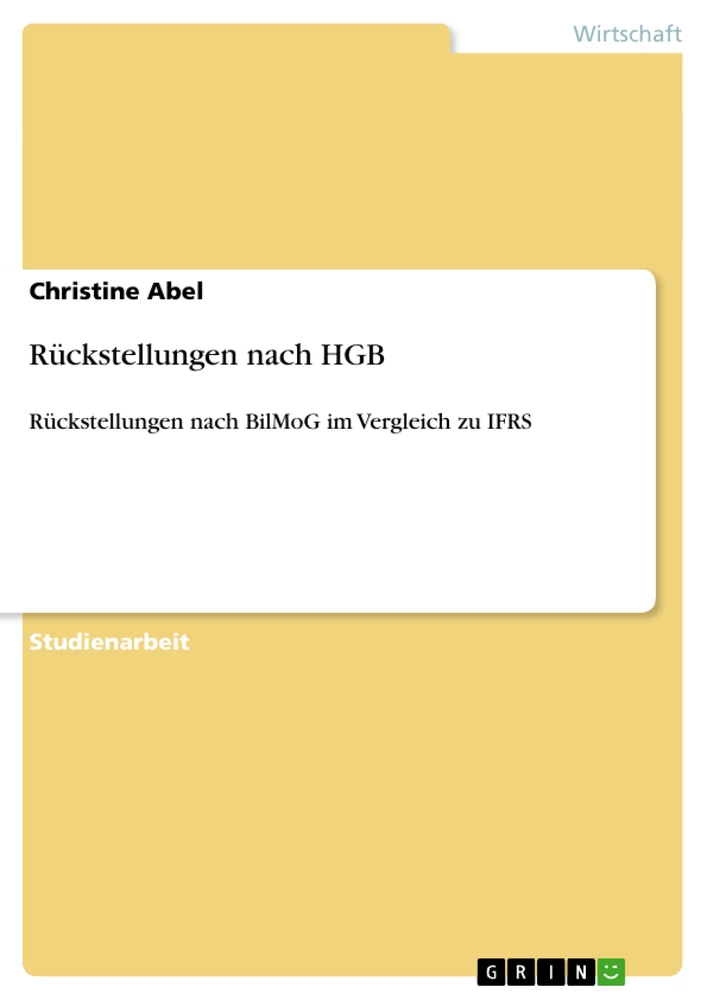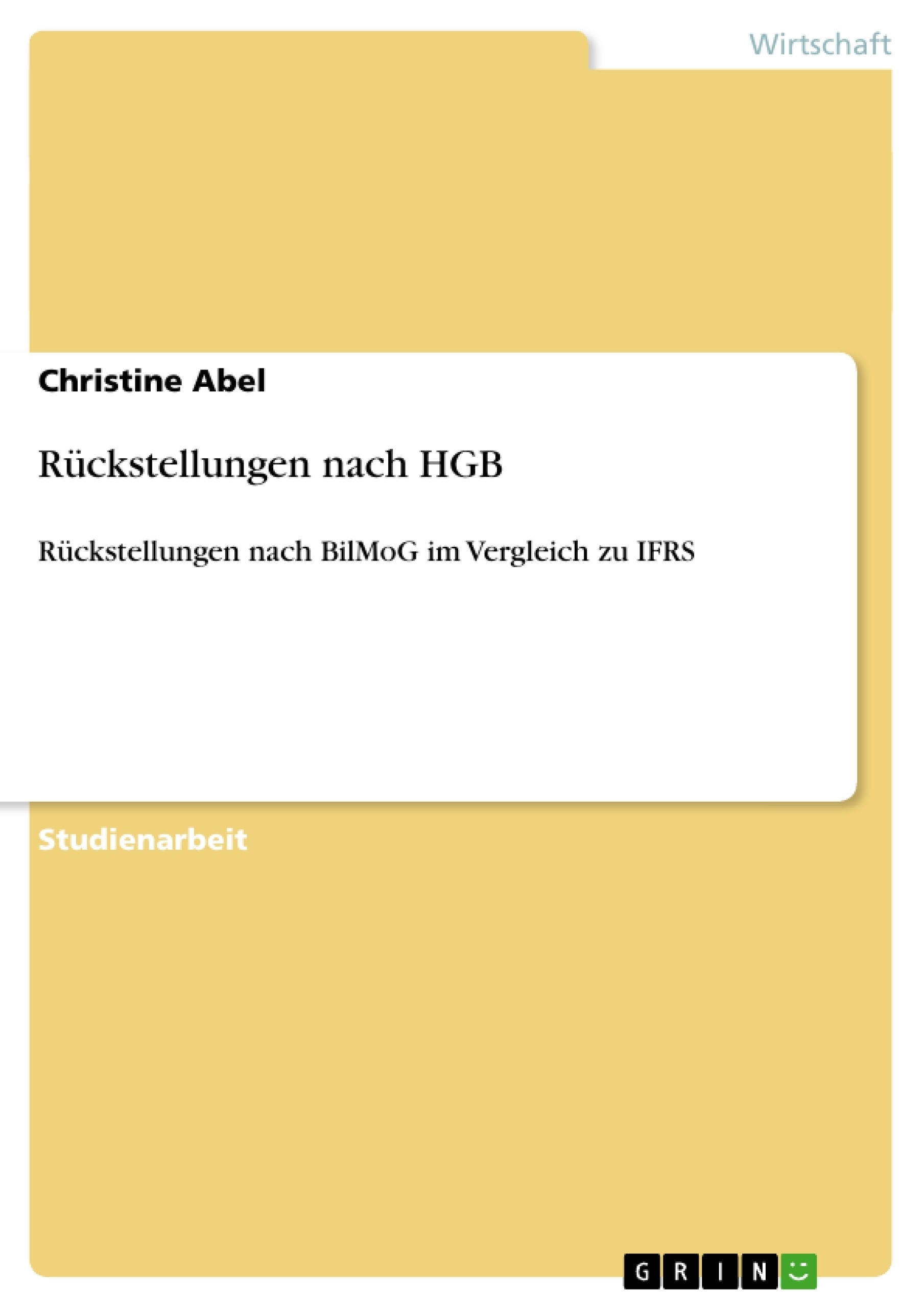Untersuchungsgang:
Es ist das Ziel dieser Arbeit aufzuzeigen, welche Rückstellungen vor Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsrechts in der Einzelbilanz bilanziert werden mussten oder konnten und in welcher Höhe dies zu geschehen hatte und wie sich die Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes hierauf auswirkt.
Damit kann am Ende der Arbeit die Frage beantwortet werden, ob es mit Einführung des BilMoG gelungen ist mit den Änderungen im Bereich der Rückstellungen die gewünschte höhere Information für alle Adressaten des Jahresabschlusses zu erreichen und ob es gelungen ist, das deutsche Handelsrecht in diesem Bereich an die IFRS anzunähern.
Begonnen wird diese Arbeit mit einer theoretischen Grundlagendarstellung der Rückstellungen. Begrifflichkeiten werden erklärt und aufgezeigt, warum die unterschiedlichen Bilanztheorien Einfluss auf den Rückstellungsbegriff laut HGB haben. Dann wird aufgezeigt wie sich die Rückstellungen von anderen Passivposten der Bilanz abgrenzen.
Es wird dargestellt, welche Rückstellungen nach HGB vor der Modernisierung bilanziert werden durften oder mussten und wie die Voraussetzungen für einen Ansatz waren.
Der nächste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Rückstellungen nach HGB nach der Modernisierung. Es wird aufgezeigt welche Rückstellungen jetzt nicht mehr bilanziert werden dürfen und welche Vorschriften bei dem Ansatz der Rückstellungen nun zugrunde liegen. Außerdem wird darauf eingegangen, welche Regelungen in nach IFRS für die Rückstellungen maßgeblich sind. Steuerliche Aspekte werden angesprochen, denn sie unterscheiden sich oftmals von den Regelungen im HGB.
Auch auf die Übergangsregelungen vom alten Recht zum neuen Recht wird eingegangen.
Den Abschluss dieser Arbeit bilden eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen des BilMoG im Bereich der Rückstellungen im Vergleich zu den alten Regelungen und das Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Problemstellung
- II. Untersuchungsgang
- B. Das Bilanzmodernisierungsgesetz
- I. Grundlegendes zum BilMoG
- II. Zielsetzung des BilMoG
- III. Gegenstand und Auswirkungen des BilMoG
- C. Grundlagen zu den Rückstellungen
- I. Begriff und Arten von Rückstellungen
- II. Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die steuerliche Gewinnermittlung
- III. Bilanzauffassungen
- 1. Statische Bilanzauffassung
- 2. Dynamische Bilanzauffassung
- IV. Abgrenzung Rückstellungen zu anderen ähnlichen Passivposten
- V. Bildung und Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen
- D. Rückstellungen nach der Einführung des BilMoG mit Hinweisen zum Steuerrecht und IFRS
- I. Ansatz von Rückstellungen
- II. Bewertung von Rückstellungen
- III. Einzelfragen
- IV. Ausweis und Angaben im Anhang
- V. Übergangsregelungen
- E. Zusammenfassung
- F. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bilanzierung von Rückstellungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere im Kontext des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Grundlagen, der gesetzlichen Bestimmungen und der praktischen Anwendung von Rückstellungen zu vermitteln.
- Entwicklung der Bilanzierung von Rückstellungen im HGB
- Auswirkungen des BilMoG auf die Rückstellungsbilanzierung
- Abgrenzung von Rückstellungen zu ähnlichen Passivposten
- Bewertung und Ausweis von Rückstellungen
- Steuerrechtliche und IFRS-relevante Aspekte der Rückstellungsbilanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt die Problemstellung der Bilanzierung von Rückstellungen sowie den gewählten Untersuchungsgang. Es legt den Fokus auf die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit einer detaillierten Betrachtung der gesetzlichen Regelungen.
B. Das Bilanzmodernisierungsgesetz: Hier werden die grundlegenden Aspekte des BilMoG erläutert, einschließlich seiner Zielsetzung und Auswirkungen auf die Bilanzierung von Rückstellungen. Es wird der Kontext des Gesetzes im Rahmen der Harmonisierung des Bilanzrechts dargestellt und dessen Einfluss auf die Transparenz und Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen hervorgehoben. Der Abschnitt analysiert kritisch die Neuerungen und deren Auswirkungen auf die Praxis.
C. Grundlagen zu den Rückstellungen: Dieser Abschnitt liefert eine umfassende Darstellung der Grundlagen der Rückstellungsbilanzierung. Es werden die verschiedenen Arten von Rückstellungen definiert und deren Abgrenzung zu anderen Passivposten wie Verbindlichkeiten, Rücklagen und Wertberichtigungen präzise erklärt. Die statische und dynamische Bilanzauffassung wird im Detail erörtert und deren Einfluss auf die Bewertung von Rückstellungen aufgezeigt. Das Kapitel beleuchtet den Bildungsprozess und die Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen im Detail. Die Bedeutung der rechtzeitigen und korrekten Bildung von Rückstellungen für die wirtschaftliche Darstellung des Unternehmens wird hervorgehoben.
D. Rückstellungen nach der Einführung des BilMoG mit Hinweisen zum Steuerrecht und IFRS: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bilanzierung von Rückstellungen nach Inkrafttreten des BilMoG. Es vergleicht die Regelungen des HGB mit den steuerrechtlichen Vorschriften und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die verschiedenen Ansatz- und Bewertungsmethoden werden im Detail verglichen und die Unterschiede erläutert. Das Kapitel behandelt die Bewertung von Preis- und Kostensteigerungen, die Abzinsung, die Bewertungsmethode, und den Ausweis im Anhang. Die Übergangsregelungen für bereits bestehende Rückstellungen werden analysiert, um den Übergang vom alten zum neuen Recht zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Rückstellungen, Bilanzierung, HGB, BilMoG, IFRS, Steuerrecht, Bewertung, Abgrenzung, Passivposten, Pensionsrückstellungen, Aufwandsrückstellungen, ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste, Abzinsung, Handelsbilanz, Steuerbilanz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Bilanzierung von Rückstellungen nach dem BilMoG
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich umfassend mit der Bilanzierung von Rückstellungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), insbesondere im Kontext des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Sie untersucht die Grundlagen, gesetzlichen Bestimmungen und die praktische Anwendung von Rückstellungen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Rückstellungsbilanzierung im HGB, die Auswirkungen des BilMoG, die Abgrenzung zu ähnlichen Passivposten, die Bewertung und den Ausweis von Rückstellungen sowie steuerrechtliche und IFRS-relevante Aspekte.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung mit Problemstellung und Untersuchungsgang; Erläuterung des BilMoG mit Zielsetzung und Auswirkungen; Grundlagen zu Rückstellungen, inklusive Begriffsbestimmungen, Arten von Rückstellungen und Bilanzauffassungen; Detaillierte Betrachtung der Rückstellungsbilanzierung nach dem BilMoG mit Hinweisen zum Steuerrecht und IFRS; sowie eine Zusammenfassung und ein Fazit.
Welche Arten von Rückstellungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Arten von Rückstellungen, ihre Abgrenzung zu anderen Passivposten wie Verbindlichkeiten, Rücklagen und Wertberichtigungen. Der Bildungsprozess und die Inanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen werden detailliert erläutert.
Wie werden Rückstellungen nach dem BilMoG bilanziert?
Das Kapitel zu Rückstellungen nach dem BilMoG konzentriert sich auf Ansatz- und Bewertungsmethoden nach HGB, unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften und IFRS. Der Vergleich der Methoden, die Behandlung von Preis- und Kostensteigerungen, die Abzinsung und der Ausweis im Anhang werden detailliert beschrieben.
Welche Bedeutung haben das Steuerrecht und IFRS im Kontext der Rückstellungsbilanzierung?
Die Hausarbeit vergleicht die Regelungen des HGB mit den steuerrechtlichen Vorschriften und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Unterschiede in den Ansatz- und Bewertungsmethoden werden erläutert und die Relevanz für die Praxis hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Rückstellungen, Bilanzierung, HGB, BilMoG, IFRS, Steuerrecht, Bewertung, Abgrenzung, Passivposten, Pensionsrückstellungen, Aufwandsrückstellungen, ungewisse Verbindlichkeiten, drohende Verluste, Abzinsung, Handelsbilanz, Steuerbilanz.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Ziel der Hausarbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der Grundlagen, der gesetzlichen Bestimmungen und der praktischen Anwendung von Rückstellungen zu vermitteln.
Welche Übergangsregelungen werden behandelt?
Die Hausarbeit analysiert die Übergangsregelungen für bereits bestehende Rückstellungen, um den Übergang vom alten zum neuen Recht zu beleuchten.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Code der ursprünglichen Daten enthalten und zeigt die detaillierte Gliederung der Hausarbeit.
- Quote paper
- Christine Abel (Author), 2013, Rückstellungen nach HGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/214808