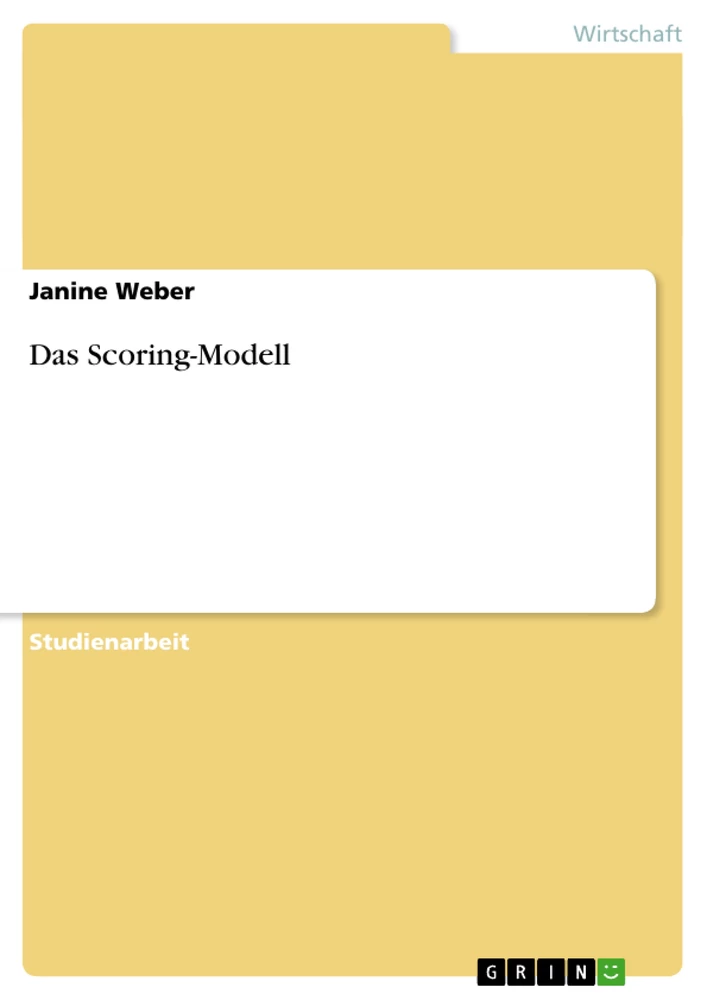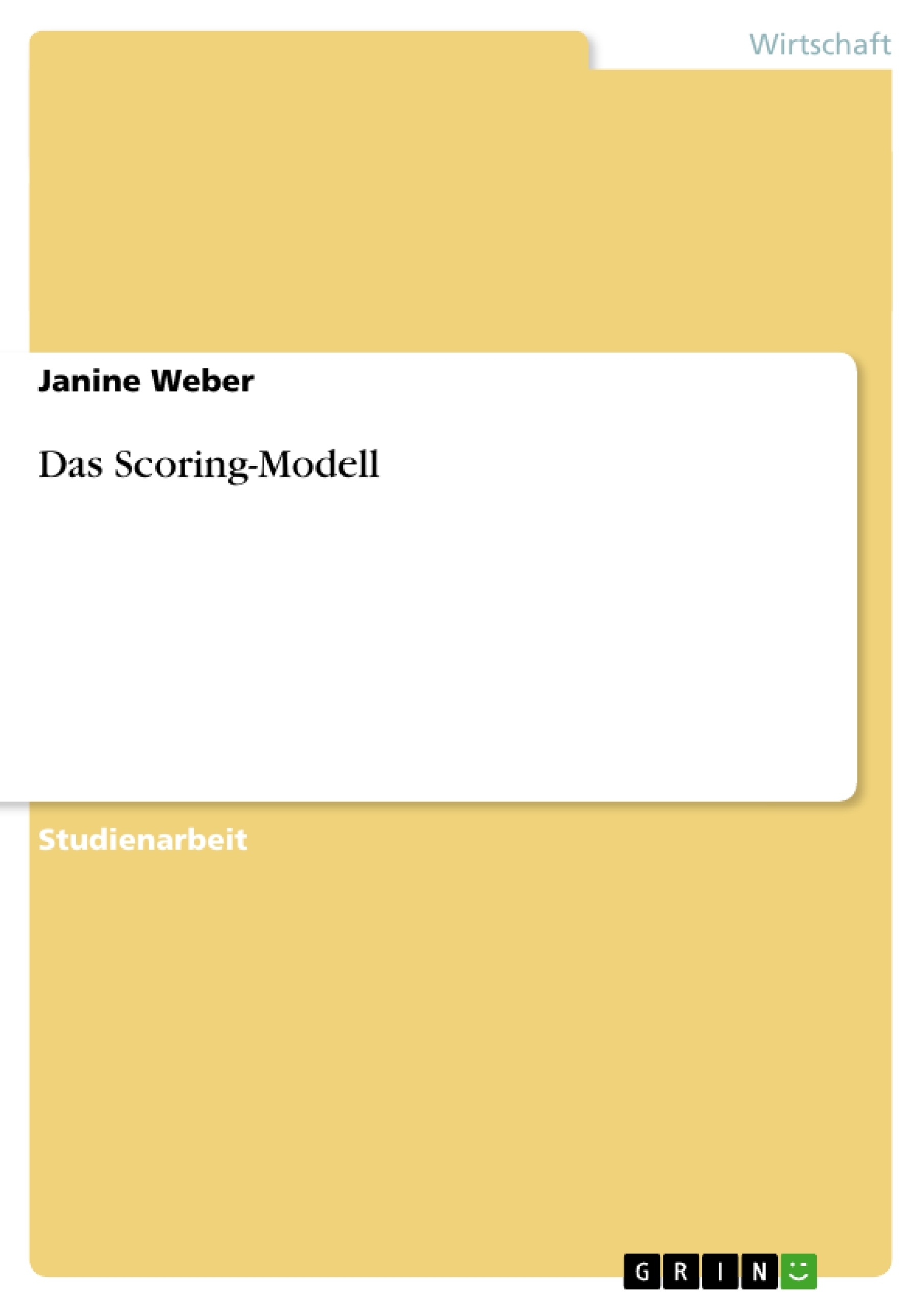Eine Arbeitshilfe für die systematische Auswahl von Alternativen ist das Punktbewertungsverfahren oder auch Nutzwertanalyse bzw. Scoring-Modell genannt. Wichtigstes Element für das Scoring (zu Deutsch punkten) ist die Scorecard (Zählkarte). Neben dem Einsatz als Entscheidungshilfe eignen sich Scorecards auch als qualitative Bewertungsverfahren für Potenzial- und Risikoanalysen, der Beurteilung von Produktideen und vielen weiteren Fragestellungen.
Bei dem Scoring Modell erfolgt ähnlich wie bei Checklisten eine Auflistung von Kriterien. Im Unterschied zu den Checklisten werden jedoch die Kriterien entsprechend ihrer Bedeutung für den Erfolg des neuen Produktes gewichtet. Daneben werden zu jedem Kriterium im voraus die möglichen Ausprägungen sowie die zugehörigen Punktwerte festgelegt. Die Gesamtbeurteilung entsteht dann durch Addition und Multiplikation der Punktwerte. Ausgewählt wird dann das Produkt mit der höchsten Gesamtpunktzahl.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einsatzgebiete und Voraussetzungen
- 3. Durchführung
- 3.1 Bestimmung des Zielsystems
- 3.2 Auswahl der Kriterien zur Beschreibung des Zielsystems
- 3.3 Bewertung der Intensität
- 3.4 Gewichtung von Kriterien und Kriteriengruppen
- 3.5 Ermittlung von Projektwerten
- 3.6 Rangordnung und Auswahl der bevorzugten Alternative
- 3.7 Sensitivitätsanalyse
- 4. Beispiel einer Produktbewertung
- 5. Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Dokument beschreibt das Scoring-Modell, eine Methode zur systematischen Auswahl von Alternativen, insbesondere im Kontext der Produktbewertung. Es erläutert die einzelnen Schritte des Verfahrens und bietet eine Anleitung zur praktischen Anwendung. Der Fokus liegt auf der methodischen Vorgehensweise und der Interpretation der Ergebnisse.
- Systematische Entscheidungsfindung durch Scoring-Modelle
- Definition und Gewichtung von Bewertungskriterien
- Ermittlung von Projektwerten und Rangordnung
- Durchführung von Sensitivitätsanalysen
- Anwendung des Modells in der Produktbewertung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt das Scoring-Modell (auch Nutzwertanalyse genannt) als Arbeitshilfe für die systematische Auswahl von Alternativen ein. Es hebt die Bedeutung der Scorecard hervor und beschreibt den Unterschied zu Checklisten durch die Gewichtung von Kriterien und die Festlegung von Punktwerten für deren Ausprägungen. Die Gesamtbewertung entsteht durch Addition und Multiplikation dieser Punktwerte, wobei die Alternative mit der höchsten Gesamtpunktzahl ausgewählt wird.
2. Einsatzgebiete und Voraussetzungen: Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung des Scoring-Modells, beispielsweise für die Bewertung von Produktideen und den Vergleich verschiedener Alternativen. Es betont die Notwendigkeit einer klaren Definition der Unternehmensziele und Motive, um ein geeignetes Zielsystem aufzustellen und einen Kriterienkatalog zu entwickeln, der als Grundlage für die Bewertung dient. Die Vorbereitung eines Kriterienkatalogs, analog zu einer Checkliste, wird als sinnvoll dargestellt.
3. Durchführung: Das Kapitel detailliert die Durchführung des Scoring-Modells als Teamaufgabe, um verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Es beschreibt die schrittweise Bestimmung des Zielsystems aus Unternehmensmotiven, die Auswahl präziser und eindeutiger Kriterien, die Bewertung der Intensität jedes Kriteriums mit entsprechenden Nutzwerten, die Gewichtung von Kriterien und Kriteriengruppen, die Ermittlung von Projektwerten durch Addition oder Multiplikation, die Bildung einer Rangordnung der Alternativen und die Durchführung einer Sensitivitätsanalyse zur Risikoabschätzung und Stabilität der Entscheidung.
4. Beispiel einer Produktbewertung: Dieses Kapitel verdeutlicht den Prozess anhand eines Beispiels der Produktbewertung, unterteilt in sechs Stufen. Es definiert Bewertungsgruppen wie Marktfähigkeit, Wachstumspotenzial und Entwicklungs-/Produktionsmöglichkeiten (genaue Details befinden sich im Anhang).
Schlüsselwörter
Scoring-Modell, Nutzwertanalyse, Produktbewertung, Kriteriengewichtung, Sensitivitätsanalyse, Entscheidungsfindung, Zielsystem, Scorecard, Alternativenbewertung.
Häufig gestellte Fragen zum Scoring-Modell zur Produktbewertung
Was ist das Scoring-Modell und wozu dient es?
Das Scoring-Modell, auch Nutzwertanalyse genannt, ist eine Methode zur systematischen Auswahl von Alternativen, insbesondere bei der Produktbewertung. Es hilft bei der Entscheidungsfindung durch die Gewichtung von Kriterien und die Zuweisung von Punktwerten, um eine objektive Rangordnung der Alternativen zu erstellen. Die Alternative mit der höchsten Punktzahl wird bevorzugt.
Welche Schritte umfasst die Durchführung des Scoring-Modells?
Die Durchführung gliedert sich in mehrere Schritte: 1. Bestimmung des Zielsystems basierend auf Unternehmensmotiven; 2. Auswahl präziser Bewertungskriterien; 3. Bewertung der Intensität jedes Kriteriums mit Nutzwerten; 4. Gewichtung der Kriterien und Kriteriengruppen; 5. Ermittlung von Projektwerten durch Addition oder Multiplikation; 6. Rangordnung der Alternativen; 7. Sensitivitätsanalyse zur Risikoabschätzung.
Welche Einsatzgebiete hat das Scoring-Modell?
Das Scoring-Modell eignet sich für die Bewertung von Produktideen, den Vergleich verschiedener Alternativen und generell für systematische Entscheidungsfindungen in Unternehmen. Es erfordert eine klare Definition der Unternehmensziele und Motive, um ein geeignetes Zielsystem und einen Kriterienkatalog zu entwickeln.
Wie werden Kriterien gewichtet und bewertet?
Die Kriterien werden anhand ihrer Bedeutung für das angestrebte Ziel gewichtet. Jedem Kriterium wird ein Nutzwert zugeordnet, der die Intensität seiner Ausprägung beschreibt. Die Gesamtbewertung einer Alternative ergibt sich aus der Addition oder Multiplikation der gewichteten Nutzwerte der einzelnen Kriterien.
Was ist die Sensitivitätsanalyse und warum ist sie wichtig?
Die Sensitivitätsanalyse untersucht die Stabilität der Entscheidung. Sie prüft, wie stark sich die Rangordnung der Alternativen verändert, wenn sich die Gewichte der Kriterien oder die Nutzwerte ändern. Dies hilft, Risiken und Unsicherheiten in der Entscheidung zu identifizieren.
Welche Kapitel beinhaltet das Dokument?
Das Dokument umfasst Kapitel zu Einleitung, Einsatzgebieten und Voraussetzungen, Durchführung (detailliert in sieben Unterkapitel unterteilt), einem Beispiel einer Produktbewertung und einer abschließenden Stellungnahme. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine strukturierte Übersicht.
Welche Schlüsselbegriffe sind mit dem Scoring-Modell verbunden?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Scoring-Modell, Nutzwertanalyse, Produktbewertung, Kriteriengewichtung, Sensitivitätsanalyse, Entscheidungsfindung, Zielsystem, Scorecard und Alternativenbewertung.
Wie unterscheidet sich das Scoring-Modell von einer Checkliste?
Im Gegensatz zu einer Checkliste berücksichtigt das Scoring-Modell die Gewichtung von Kriterien und die Zuweisung von Punktwerten für deren Ausprägungen. Die Gesamtbewertung entsteht durch Addition und Multiplikation dieser Punktwerte, während eine Checkliste lediglich die Anwesenheit oder Abwesenheit von Merkmalen erfasst.
Wo finde ich ein Beispiel für die Anwendung des Scoring-Modells?
Ein detailliertes Beispiel für die Anwendung des Scoring-Modells in der Produktbewertung wird im Dokument vorgestellt und in sechs Stufen unterteilt. Es beinhaltet Bewertungsgruppen wie Marktfähigkeit, Wachstumspotenzial und Entwicklungs-/Produktionsmöglichkeiten (genaue Details im Anhang).
- Quote paper
- Janine Weber (Author), 2003, Das Scoring-Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/21480