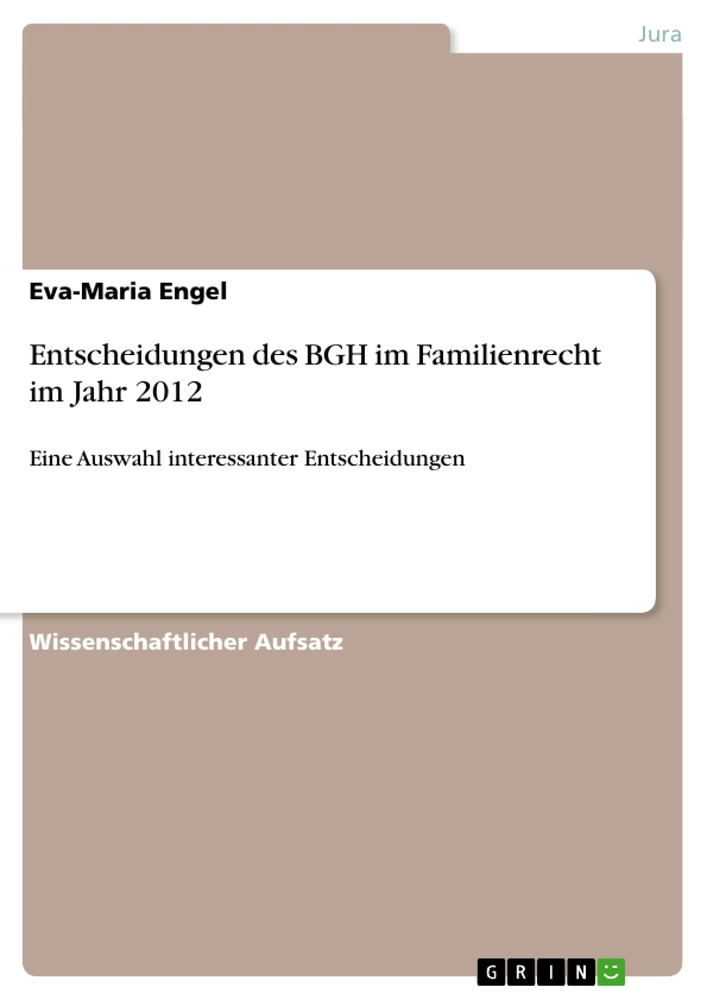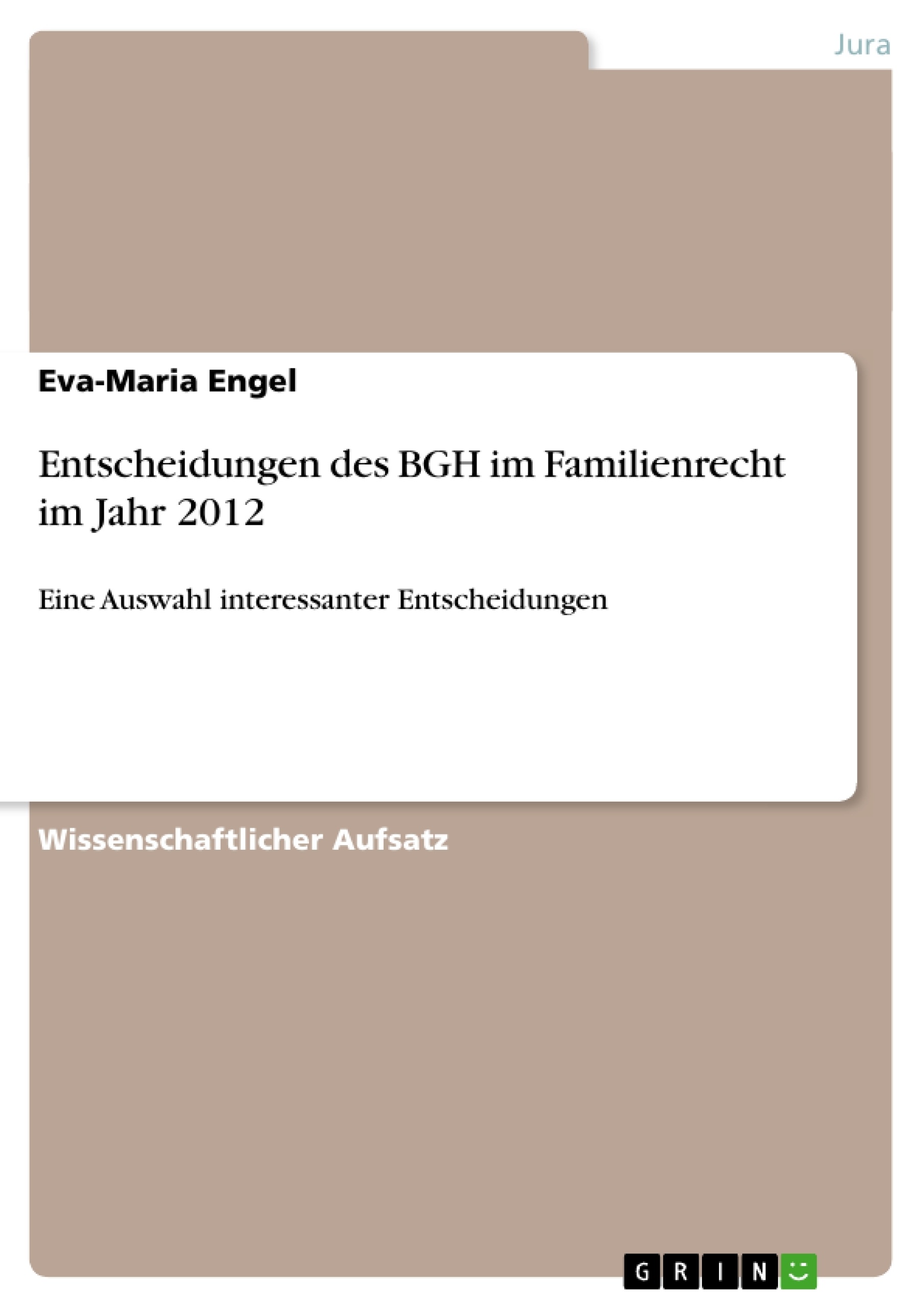Es werden 6 verschiedene Urteile aus dem Jahr 2012, meist zum Unterhaltsrecht und auch zur Ehefähigkeit und zum Verfahrensrecht vorgestellt und erläutert.
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Jahr 2012 zum Familienrecht
In dem folgenden Artikel werden wichtige Urteile des Jahres 2012 im Überblick dargestellt.
1. Entscheidung zur Ehefähigkeit
Es handelt sich um ein Urteil des BGH vom 11.04.2012 (AZ: XII ZR 99/10).
Zum Sachverhalt ist folgendes auszuführen:
Ein Paar war seit 30 Jahren partnerschaftlich verbunden. Ein wegen Demenz erkrankter Mann wurde in eine Klinik eingewiesen und kam später in ein Seniorenheim und von dort wieder nach Hause und wurde von der Partnerin gepflegt. Etwa zwei Monate nach der Rückkehr in die Wohnung heiratete das Paar, wobei der Standesbeamte ins Schlafzimmer des Kranken kam. Ein Jahr später wurde dort auch die kirchliche Trauung vollzogen.
Eine wegen wohl der Erbfolge zu kurz gekommene Nichte des Mannes wies die zuständige Behörde auf die Demenzerkrankung hin. Diese leitete daraufhin ein Eheaufhebungsverfahren ein. Amtsgericht und Oberlandesgericht gaben der Behörde Recht. Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied jedoch, die Ehe sei wirksam geschlossen.
Dies aus folgenden Gründen:
Nach § 1304 BGB kann, wer geschäftsunfähig ist, keine Ehe eingehen. Allerdings ist im Sinne dieser Vorschrift die Geschäftsfähigkeit unter Berücksichtigung des Artikels 1 Abs. 1 GG (Grundgesetz) verfassungsrechtlich zu prüfen und im Sinne einer garantierten Eheschließungsfreiheit muss die „Ehegeschäftsfähigkeit“ beurteilt werden. Kommt hier lediglich darauf an, ob derjenige, der heiratet, in der Lage ist, das Wesen der Ehe zu begreifen und insofern eine freie Willensentscheidung zu treffen. Im übrigen liegt es im pflichtgemäßen Ermessen der Verwaltungsbehörde, ob sie den Antrag auf Eheaufhebung stellt. Nach § 1316 Abs. 3 BGB soll dies nicht geschehen, wenn die Aufhebung der Ehe für einen Ehegatten eine so schwere Härte bedeutet, dass die Aufrechterhatlung der Ehe ausnahmsweise geboten erscheint. Liegt dieser Fall vor, so hat das Gericht den Aufhebungsantrag als unzulässig abzuweisen. Die Beurteilung dieser Frage ist der Beurteilung der Geschäftsfähigkeit sogar vorgegriffen. In diesem Fall sah der BGH einen Härtefall als gegeben an. Der Aufhebung der Ehe besteht dann kein öffentliches Interesse, wenn vom Standpunkt eines billig und gerecht denkenden Betrachters an der Aufhebung kein wesentliches Interesse beigemessen werden kann. Diesen Fall bejahte der BGH hier. Die Ehe war nicht zu dem Zweck geschlossen worden, in den Genuss staatlicher Leistungen oder anderer öffentlich-rechtlicher Vorteile zu kommen. Die Ehefrau wollte sich auch nicht bereichern, obwohl sie nun als Ehefrau größere Rechte als zuvor hatte. Diesem stand jedoch die fast 40 Jahre lange Partnerschaft der Eheleute gegenüber und die Pflege und Fürsorge seit Beginn der Demenz Erkrankung. Auch ein nachrangiges Erbrecht einer Nicht kann kein öffentliches Interesse einer Aufhebung begründen.
Im Gegenteil, der BGH bejahte hier das gravierende Interesse beider Ehegatten die Ehe zu erhalten. Die Ehefrau hat sich im Rahmen gelebter Solidarität für ihren Ehemann aufgeopfert, dies ist ein typischer Ausdruck dafür für eine Verwantwortungsgemeinschaft füreinander, § 1353 Abs. 1 S. 2 BGB. Die Ehefrau hat wegen der Pflegetätigkeit die eigene Erwerbstätigkeit aufgegeben. Das Erhaltungsinteresse an der Eheschließung überwiegt das staatliche Ordnungsinteresse. Deshalb war der Antrag als unzulässig zurückzuweisen.
Diese Entscheidung ist relevant für die Praxis, da es immer mehr Demenzkranke gibt.
2. Entscheidung BGH zum Verfahrensrecht vom 21.03.2003 (XII ZB 447/10)
Der BGH hat sich in dieser Entscheidung grundsätzlich zur sog. 2-Wochenfrist des § 137 Abs. 2 FamFG geäußert.
Hintergrund ist, dass Scheidungsfolgesachen im Rahmen eines Scheidungsverfahrens spätestens 14 Tage vor dem Verhandlungstermin anhängig gemacht werden müssen, anderenfalls kommen sie nicht mehr in den Verbund und können sich insbesondere nicht mehr verzögern, § 137 Abs. 2 FamFG.
In dem vom BGH geprüften Fall hatte ein Amtsrichter am 22.04.2010 Scheidungstermin bestimmt auf den 04.05.2010. Dem Anwalt des Ehemannes ging die Ladung am 26.04.2010 zu. Er bat zunächst – erfolglos – um Terminverlegung und stellte dann am 28.04.2010 Antrag auf nachehelichen Unterhalt. Ferner reichte ein Auskunftsantrag zum Zugewinnausgleich ein. Der Amtsrichter sprach im Termin die Scheidung aus und befasste sich nicht mit den Folgesachen, da diese nicht rechtzeitig in den Verbund gelangt seien. Sie wurden als selbständige Verfahren weitergeführt. Der Ehemann legte Beschwerde ein, verlangte die Aufhebung der Scheidung und erweiterte dann sein Auskunftsantrag zum Zugewinnausgleich zu Stufenantrag auf Auskunft und Zahlung. Das Oberlandesgericht gab der Beschwerde des Ehemannes statt. Von der Ehefrau wurde Rechtsbeschwerde zum BGH eingereicht. Dieser hatte jedoch keinen Erfolg und zwar aus folgenden Gründen:
Der BGH entschied, dass der Unterhalt eine Folgesache ist, der zum Güterrecht eingereichte Auskunftsantrag jedoch nicht. Grundsätzlich muss eine Folgesache nach § 137 Abs. 2 FamFG spätestens zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung beim Amtsgericht in der Scheidungssache anhängig gemacht worden sein. Der Amtsrichter muss jedoch so terminieren, dass die Ehegatten auch nach Zustellung der Ladung noch vermögensrechtliche Folgesache anhängig machen können. Regelmäßig sind zwar die Beteiligten in der Lage, Anträge frühzeitig bei Gericht einzureichen, die Parteien sind jedoch nicht daran gehindert, die Fristen auch auszuschöpfen. Dies setzt aber voraus, dass das Familiengericht den Termin zur Scheidung so bestimmt, dass die beteiligten Ehegatten auch nach der erhaltenen Ladung noch genügend Zeit hierfür verbleibt. Hierfür reicht die 14-Tagesfrist zwischen Zustellung der Ladung und Termin nicht aus, da von dem Ehegatten nicht verlangt werden kann, dass sie noch am Tag des Zugangs des Ladung Anträge in vermögensrechtlichen Folgesachen anfertigen und beim Familiengericht einreichen können. Hierfür muss ihnen eine angemessene Vorbereitungszeit zur Verfügung stehen. Der BGH sieht hierfür als angemessen eine Woche an, dies ergibt sich daraus, dass nach der alten Rechtslage vor Einführung des FamFG der Amtsrichter mit Wochenfrist zur Scheidung laden konnte, die Parteien daher früher mindestens eine Woche Zeit hatten, einen Folgesachenantrag zu formulieren und bei Gericht einzureichen. Der Amtsrichter muss daher darauf achten, dass zwischen Zustellung der Ladung und Termin ein Zeitraum von mindestens 3 Wochen liegt. Wird dies nicht beachtet, besteht ein Anspruch auf Terminsverlegung, alternativ können die Folgesachen in diesen Fällen noch zur mündlichen Verhandlung anhängig gemacht werden.
Der BGH entschied, dass ein reiner Antrag auf Auskunft im Zugewinn grundsätzlich keine taugliche Folgesache ist, weil er die Entscheidung über ihn nicht „für den Fall der Scheidung“ zu treffen ist. Durch die Erweiterung zum Stufenantrag war es zwar eigentlich eine taugliche Folgesache, dieser Antrag wurde jedoch zu spät in der II. Instanz eingereicht.
[...]
- Quote paper
- Eva-Maria Engel (Author), 2013, Entscheidungen des BGH im Familienrecht im Jahr 2012, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/214637