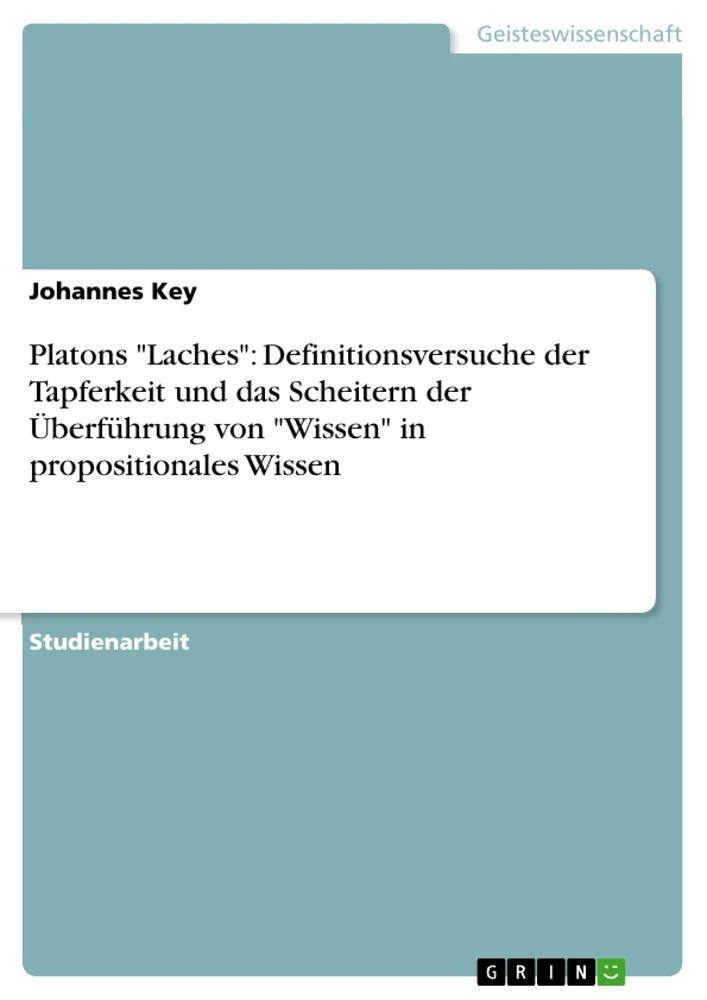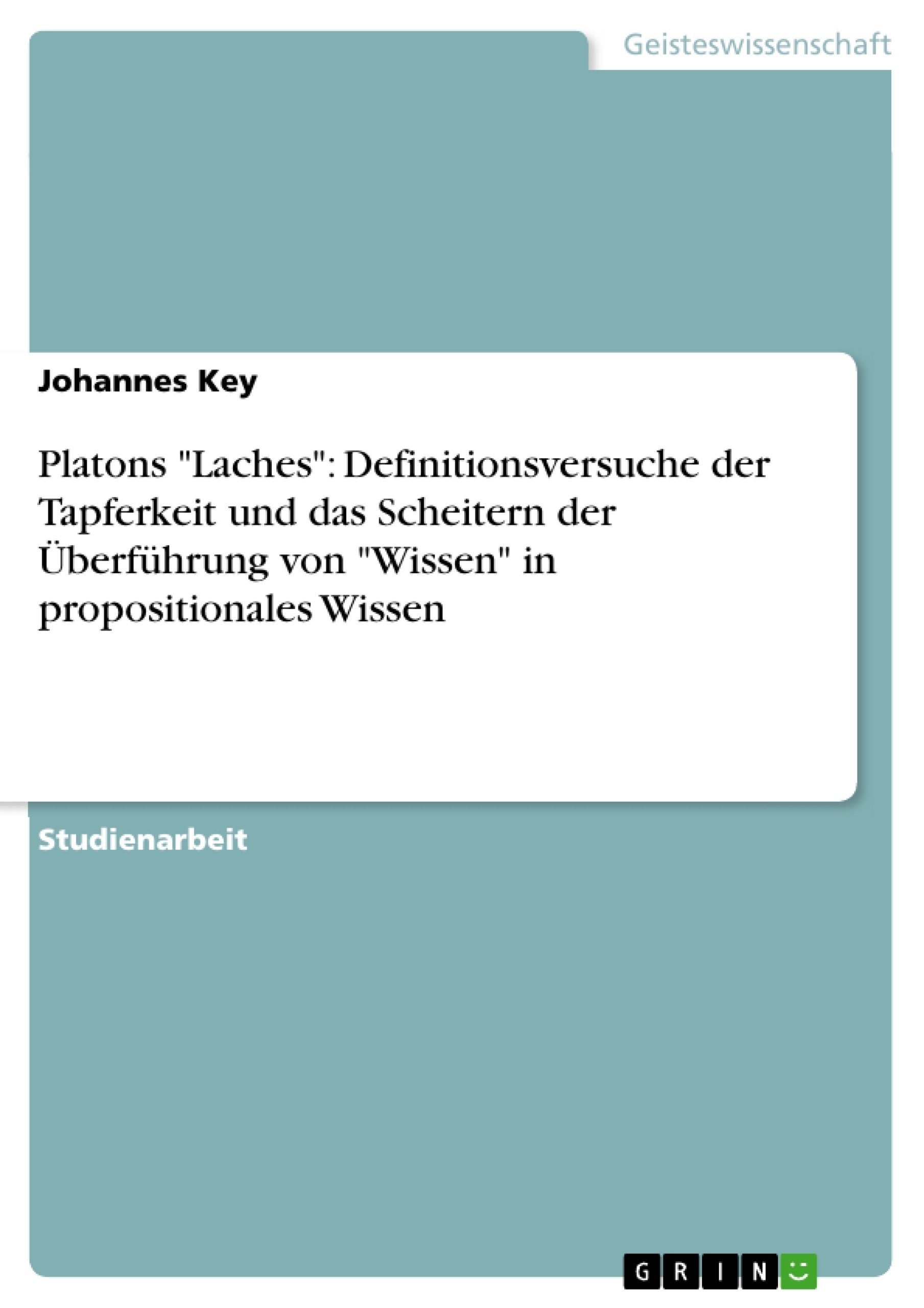Der Laches gilt in der Wirkgeschichte der Forschung als kaum bedeutend. Das muss nicht verwundern, werden doch die entwickelten Themen bspw. in der Politeia weiterentwickelt; außerdem endet dort der Definitionsversuch von Tapferkeit nicht in der Aporie. Merkwürdigerweise kann man aber aus diesem Definitionsdialog eben durch das aporetische Ende, mehr Erkenntnisse gewinnen als die sokratischen Aporien, die i. d. R. immer erkenntnisfördernd sind, sonst vermuten lassen. Es wird zu zeigen sein, dass durch die Aporie der Tapferkeitsdefinition auch das Verhältnis von implizitem und propositionalem Wissen, somit die Überführbarkeit von Wissen, problematisiert wird.
Die Arbeit soll jedoch zunächst den Dialog genauer darstellen. Ausgangspunkt wird die Rahmenhandlung resp. die szenische Dialogebene sein, die wichtige Voraussetzungen und Rückschlüsse für die diskursive Ebene bietet. Sodann sollen die Definitionsversuche und ihre Widerlegungen, die dazu führen, dem Gemeinsamen der Tapferkeit stetig näher zu kommen, genauer betrachtet werden. Ebenso werden die Antworten auf ihre formal-logische Gestalt, die sich ebenfalls stetig einer Definition nähern, geprüft werden müssen. Anschließend wird die Untersuchung formaler Schwierigkeiten zwischen sokratischem Anspruch der Was-ist-X-Frage und den Antworten der Gesprächspartner aufschlussreich sein für das Problem, implizites Wissen in propositionales zu überführen. Letzteres soll abschließend skizziert werden, um die Aporie des Definitionsdialoges über das Scheitern der Definitionen hinaus zu interpretieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorbemerkungen
- Gesprächsverlauf und Argumentation
- Rahmenhandlung: Exposition
- Diskursive Dialogebene
- Erster Anlauf eines Definitionsversuchs
- Definitionen des Laches
- Definition des Nikias
- Probleme der Definitionsversuche
- Rettungsversuche der Definitionen
- Rückschlüsse aus der Aporie für propositionales Wissen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Platons Dialog „Laches“, der sich mit Definitionsversuchen von Tapferkeit auseinandersetzt und in einer Aporie endet. Ziel ist es, die Erkenntnisse zu beleuchten, die sich trotz des aporetischen Endes gewinnen lassen, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von implizitem und propositionalem Wissen. Die Arbeit untersucht den Dialogverlauf, die Definitionsversuche und deren Widerlegungen, sowie die formal-logischen Schwierigkeiten der sokratischen Was-ist-X-Frage.
- Analyse des Gesprächsverlaufs im Laches-Dialog
- Untersuchung der Definitionsversuche von Tapferkeit und deren Widerlegungen
- Formal-logische Schwierigkeiten der sokratischen Methode
- Das Verhältnis von implizitem und propositionalem Wissen
- Interpretation der Aporie im Kontext der Wissensübertragung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der Laches-Dialog wird in der Forschung oft als unbedeutend angesehen, da seine Themen in späteren Platonischen Werken weiterentwickelt werden und der Dialog in einer Aporie endet. Die Arbeit argumentiert jedoch, dass gerade die Aporie wichtige Erkenntnisse über das Verhältnis von implizitem und propositionalem Wissen liefert. Sie kündigt eine detaillierte Darstellung des Dialogs an, beginnend mit der Rahmenhandlung und den Definitionsversuchen, um schließlich die Problematik der Überführbarkeit von Wissen zu untersuchen.
Vorbemerkungen: Dieser Abschnitt klassifiziert den Laches-Dialog als platonischen Frühdialog und Tugenddialog, der typischerweise das Wesen von Begriffen untersucht, die einem praktischen Problem zugrunde liegen. Es wird die Methode Sokrates erläutert, die darin besteht, den zugrundeliegenden Begriff zu definieren, um das Problem besser lösen zu können. Der Laches-Dialog ist ein „aporetischer Definitionsdialog“, da er in einer Aporie endet, ohne eine zufriedenstellende Definition zu finden. Sokrates' Methode wird im Kontext der Was-ist-X-Frage und des Unterschieds zwischen implizitem und propositionalem Wissen erläutert. Sokrates Ziel ist es, das Scheinwissen der Gesprächspartner aufzudecken und sie zur Selbstaufklärung zu führen.
Gesprächsverlauf und Argumentation: Dieser Abschnitt gliedert sich in die Rahmenhandlung (Exposition) und die diskursive Dialogebene. Die Rahmenhandlung beschreibt den Kontext des Dialogs: Lysimachos und Melesias suchen Rat bei Laches und Nikias bezüglich der Erziehung ihrer Söhne. Die diskursive Ebene behandelt die eigentlichen Definitionsversuche von Tapferkeit durch Laches und Nikias und deren Widerlegung durch Sokrates. Der Abschnitt wird die verschiedenen Ansätze und deren Schwächen detailliert untersuchen.
Probleme der Definitionsversuche: Dieser Teil analysiert die Schwierigkeiten, auf die die Gesprächspartner bei ihren Versuchen stoßen, Tapferkeit zu definieren. Die Analyse konzentriert sich auf die logischen und philosophischen Probleme der vorgeschlagenen Definitionen und erklärt, warum sie den Anforderungen Sokrates' nicht genügen.
Rettungsversuche der Definitionen: Hier werden die Versuche der Gesprächspartner untersucht, ihre anfänglichen Definitionen von Tapferkeit zu retten oder zu verbessern, nachdem Sokrates deren Mängel aufgezeigt hat. Die Analyse konzentriert sich auf die Strategien, die verwendet werden, um die Einwände Sokrates zu begegnen und die damit verbundenen Herausforderungen.
Rückschlüsse aus der Aporie für propositionales Wissen: Dieser Abschnitt untersucht die Schlussfolgerungen, die aus der Aporie des Dialogs gezogen werden können, insbesondere in Bezug auf das Verhältnis zwischen implizitem und propositionalem Wissen. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, wie implizites Wissen in propositionales Wissen überführt werden kann, und die Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben.
Schlüsselwörter
Platon, Laches, Tapferkeit, Definition, Aporie, Sokratische Methode, implizites Wissen, propositionales Wissen, Was-ist-X-Frage, Tugend, Erziehung.
Häufig gestellte Fragen zum Platon-Dialog "Laches"
Was ist der Gegenstand der Analyse in diesem Dokument?
Dieses Dokument analysiert Platons Dialog "Laches", der sich mit Definitionsversuchen von Tapferkeit auseinandersetzt und in einer Aporie endet. Der Fokus liegt auf den Erkenntnissen, die sich trotz des aporetischen Ausgangs gewinnen lassen, insbesondere bezüglich des Verhältnisses von implizitem und propositionalem Wissen.
Welche Themen werden im "Laches"-Dialog behandelt?
Der Dialog befasst sich mit Definitionsversuchen von Tapferkeit, den formal-logischen Schwierigkeiten der sokratischen Was-ist-X-Frage, und dem Verhältnis von implizitem und propositionalem Wissen. Er untersucht, wie Wissen übermittelt und verstanden wird und die Herausforderungen bei der Überführung von implizitem in propositionales Wissen.
Wie ist der Dialog aufgebaut?
Der Dialog ist in mehrere Abschnitte gegliedert: Einleitung, Vorbemerkungen, Gesprächsverlauf und Argumentation (inklusive Rahmenhandlung und diskursiver Dialogebene mit verschiedenen Definitionsversuchen), Probleme der Definitionsversuche, Rettungsversuche der Definitionen und Rückschlüsse aus der Aporie für propositionales Wissen. Schließlich folgt eine Zusammenfassung und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Methode wendet Sokrates im "Laches"-Dialog an?
Sokrates verwendet seine bekannte sokratische Methode, die darin besteht, den zugrundeliegenden Begriff (hier: Tapferkeit) zu definieren, um das Problem besser lösen zu können. Er stellt Fragen, um das Scheinwissen der Gesprächspartner aufzudecken und sie zur Selbstaufklärung zu führen. Die Methode führt im "Laches" zu einer Aporie, einer unauflösbaren Widersprüchlichkeit.
Welche Schwierigkeiten treten bei den Definitionsversuchen von Tapferkeit auf?
Die Gesprächspartner (Laches und Nikias) stoßen auf logische und philosophische Probleme bei ihren Versuchen, Tapferkeit zu definieren. Ihre Definitionen genügen den Anforderungen Sokrates' nicht, da sie entweder zu eng oder zu weit gefasst sind oder innere Widersprüche aufweisen.
Welche Rolle spielt die Aporie im "Laches"-Dialog?
Die Aporie, das Scheitern, eine zufriedenstellende Definition von Tapferkeit zu finden, ist kein negatives Ergebnis. Die Analyse argumentiert, dass die Aporie wichtige Erkenntnisse über das Verhältnis von implizitem und propositionalem Wissen liefert und die Schwierigkeiten bei der Überführung von implizitem in explizites Wissen aufzeigt.
Was ist der Unterschied zwischen implizitem und propositionalem Wissen im Kontext des "Laches"-Dialogs?
Der Dialog beleuchtet den Unterschied zwischen implizitem Wissen (praktisches, intuitives Wissen) und propositionalem Wissen (explizites, artikuliertes Wissen). Ein zentrales Thema ist die Frage, wie implizites Wissen in propositionales Wissen überführt werden kann und welche Herausforderungen damit verbunden sind.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis des "Laches"-Dialogs wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Platon, Laches, Tapferkeit, Definition, Aporie, Sokratische Methode, implizites Wissen, propositionales Wissen, Was-ist-X-Frage, Tugend und Erziehung.
Warum ist der "Laches"-Dialog trotz seines aporetischen Endes wichtig?
Der Dialog wird oft als unbedeutend angesehen, da seine Themen in späteren platonischen Werken weiterentwickelt werden. Die Analyse argumentiert jedoch, dass gerade die Aporie wichtige Erkenntnisse über Wissen und dessen Übermittlung liefert und somit einen wertvollen Beitrag zur platonischen Philosophie leistet.
- Quote paper
- Johannes Key (Author), 2011, Platons "Laches": Definitionsversuche der Tapferkeit und das Scheitern der Überführung von "Wissen" in propositionales Wissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/214589