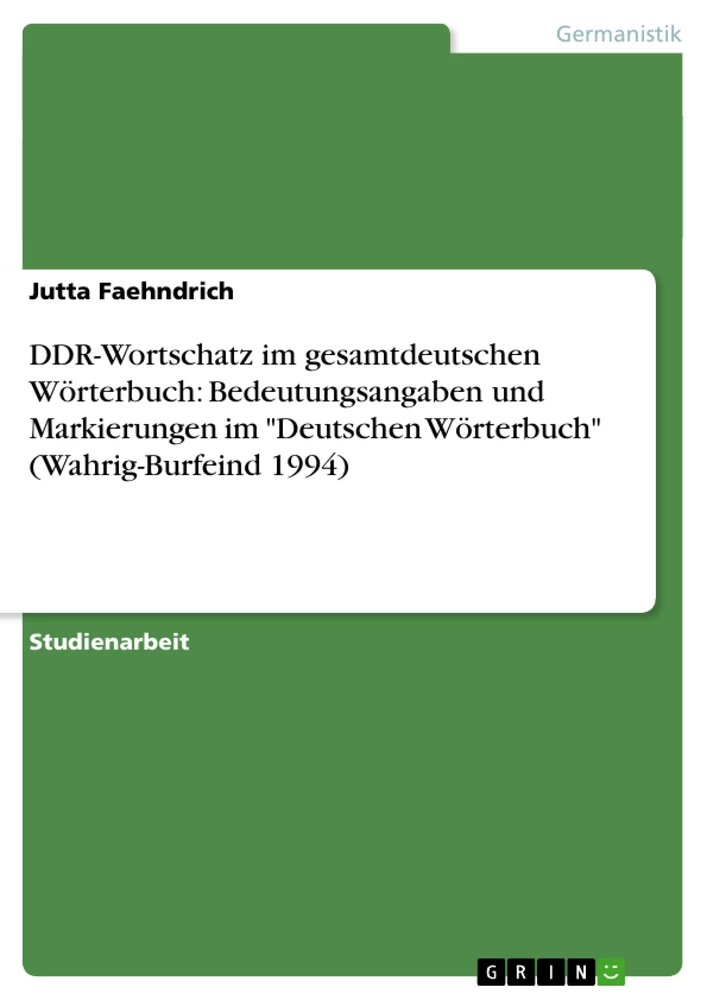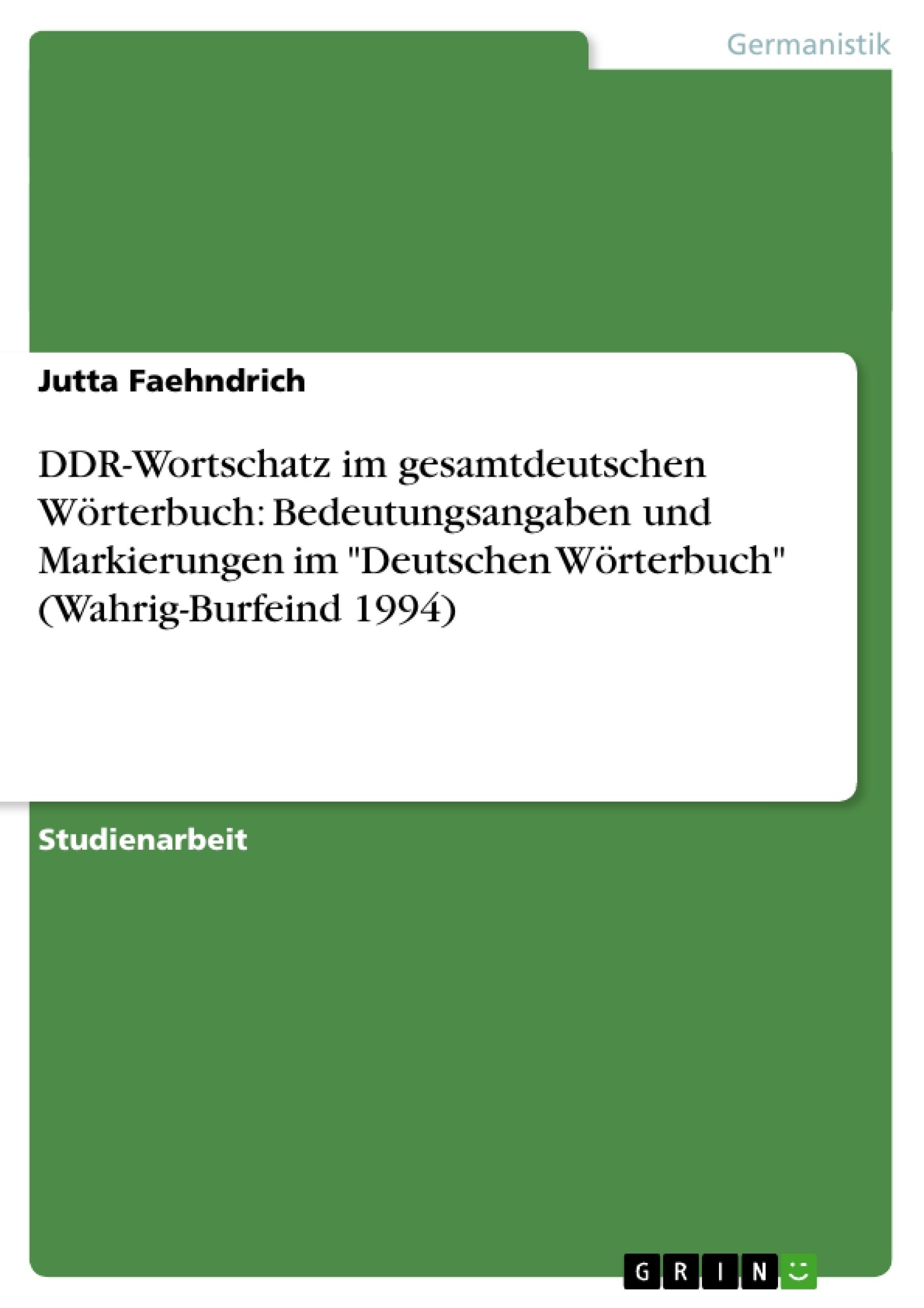Seit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1949 gab es
Wörterbücher und Lexika für beide deutsche Staaten, obwohl die Sprache, über die
Auskunft gegeben werden sollte, doch eigentlich die gleiche war. Nach der letzten
gemeinsamen Ausgabe von 1947 wurde auch der DUDEN (d.i. der Rechtschreibduden),
das deutsche Wörterbuch schlechthin, in eine Ost- und Westausgabe aufgespalten - 1951
erschien die erste Ausgabe des Leipziger Dudens, 1955 die erste Mannheimer Ausgabe.
Sowohl im Westen als auch im Osten erschienen eigene Großwörterbücher, so in der DDR
das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 1 und in der BRD das sechsbändige
Duden-Großwörterbuch2. Die Gründe für die Existenz verschiedener Nachschlagewerke zu
Lexemen der deutschen Sprache in Ost und West liegen wohl zum einen darin, daß für die
politische Führung der DDR ein eigenes Wörterbuch Zeichen für die staatliche
Eigenständigkeit war, andererseits aber auch ein Wörterbuch Mittel zur Propagierung der
politischen Ansichten eines Staates ist. Schaut man sich z.B. die Wörterbuchartikel zu den
Lexemen 'Kommunismus' und 'Kapitalismus' in einem BRD- und einem DDR-Wörterbuch
an, so wird man schnell feststellen, daß auf beiden Seiten der Mauer Wörterbücher auch
politische Einstellungen transportiert haben. Zum dritten ist die Existenz getrennter
Nachschlagewerke auch dadurch begründet, daß es in beiden deutschen Staaten eine Reihe
von Lexemen gab, die entweder nur in einem der beiden Staaten existierten oder in beiden
Staaten unterschiedliche Bedeutung hatten.
Mit der Auflösung der alten DDR und dem Beitritt des Staates zur Bundesrepublik hat
zwar die Trennung der Wörterbücher aufgehört zu existieren, nicht aber die Lexeme, die
spezifisch sind und waren für die DDR und für das heutige Ostdeutschland. Natürlich
werden Bezeichnungen für Dinge und Institutionen, die es nur in der DDR gab, heute
lediglich bei der Erzählung und Wiedergabe von Vergangenem verwendet, doch gibt es
darüber hinaus auch Lexeme, die dem westdeutschen Sprachnutzer fremd vorkommen,
weil sie in der DDR geprägt wurden und von den Ostdeutschen natürlich nach wie vor
verwendet werden - man ändert seinen Alltagssprachgebrauch nicht schlagartig wenn
das politische System sich wandelt. [...]
1Klappenbach/Steinitz (Hrsg.), Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, Berlin (Ost) 1978
2Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden, herausgegeben unter der Leitung
von Günther Drosdowski, Mannheim 1976-1981
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verschiedene Arten der Markierung von DDR-/ostdeutschem Wortschatz im Deutschen Wörterbuch (Wahrig-Burfeind)
; Bedeutungsangabe im Präsens ; Bedeutungsangabe im Präteritum als zweite oder weitere Bedeutung - regionale Markierung oder Sprachvariante? - Markierung
(= mitteldeutsch) - Uneinheitliche Markierungen wie <zu Zeiten der zwei deutschen Staaten>, <in Ostblockländern>, <in sozialistischen Ländern>, <früher> etc.
- Zu den Bedeutungsangaben
- Im Wahrig-Burfeind nicht erfaßte Polysemie bei Verwendung des gleichen Lexems im Ost- und Westsprachgebrauch (sog. "Falsche Freunde"); Vergleich mit Eintragungen zum gleichen Lexem im Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (HDG)
- Unterschiede bei den Bedeutungsangaben zum gleichen Lexem des DDR-/ostdeutschen Wortschatzes in den Wörterbüchern (HDG, KSE und Wahrig-Burfeind)
- Lexeme, die mir im ostdeutschen Sprachgebrauch als spezifisch auffallen, im Wahrig-Burfeind aber nicht entsprechend gekennzeichnet oder nicht enthalten sind
- Lexeme, die mir spezifisch ostdeutsch erscheinen, aber im Wahrig-Burfeind nicht gekennzeichnet sind.
- Im Wahrig-Burfeind nicht aufgeführte, vereinzelt jedoch im HDG und/oder KSE enthaltene Lexeme, die mir aus dem Alltagsgebrauch in Ostdeutschland bekannt sind
- Wendungen und andere Elemente des Sprachgebrauchs, die mir Ost-/DDR-spezifisch erscheinen.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Markierung und Bedeutungserklärung von DDR-/ostdeutschen Lexemen im Deutschen Wörterbuch von Renate Wahrig-Burfeind (1994). Der Fokus liegt auf der Betrachtung aus der Perspektive eines Sprachnutzers aus Westdeutschland, der im Osten lebt. Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Markierungsweisen im Wörterbuch und vergleicht diese mit dem tatsächlichen Sprachgebrauch im Osten Deutschlands.
- Analyse der Markierung von DDR-spezifischem Wortschatz im Wahrig-Burfeind.
- Vergleich der Wörterbucheinträge mit dem tatsächlichen Sprachgebrauch in Ostdeutschland.
- Untersuchung der konzeptionellen Prinzipien des Wahrig-Burfeind bezüglich der Kennzeichnung ostdeutscher Lexemen.
- Identifizierung von Diskrepanzen zwischen Wörterbuch und Realität.
- Betrachtung der Entwicklung des deutschen Wortschatzes nach der Wiedervereinigung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die historische Entwicklung von Wörterbüchern in Ost- und Westdeutschland nach 1949, die Aufspaltung des Duden und die Herausgabe separater Großwörterbücher. Sie erläutert die Gründe für diese Entwicklung, die sowohl politische als auch sprachliche Aspekte umfasste. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung der Markierung und Bedeutungserklärung von DDR-/ostdeutschen Lexemen im Wahrig-Burfeind Wörterbuch (1994) aus der Perspektive eines Sprachnutzers, der aus Westdeutschland stammt und im Osten Deutschlands lebt. Die methodische Vorgehensweise wird dargelegt, die sich auf den Vergleich von Alltagssprache und Wörterbucheinträgen konzentriert.
Verschiedene Arten der Markierung von DDR-/ostdeutschem Wortschatz im Deutschen Wörterbuch (Wahrig-Burfeind): Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Arten der Markierung von DDR-spezifischem Wortschatz im Wahrig-Burfeind Wörterbuch. Es beschreibt die Entwicklung der Markierung "
Uneinheitliche Markierungen wie <zu Zeiten der zwei deutschen Staaten>, <in Ostblockländern>, <in sozialistischen Ländern>, <früher> etc.: Dieses Kapitel befasst sich mit den uneinheitlichen Markierungen im Wahrig-Burfeind Wörterbuch, die zur Kennzeichnung von DDR-spezifischem Wortschatz verwendet werden. Es analysiert die unterschiedlichen Ansätze und ihre Auswirkungen auf das Verständnis des Wortschatzes und erörtert die Gründe für die Inkonsistenz.
Zu den Bedeutungsangaben: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutungsangaben für Lexemen, die sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland verwendet wurden, jedoch unterschiedliche Bedeutungen aufwiesen (sog. "Falsche Freunde"). Es vergleicht die Eintragungen im Wahrig-Burfeind mit denen in anderen Wörterbüchern wie dem HDG (Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache) und der KSE und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den jeweiligen Bedeutungserklärungen.
Lexeme, die mir im ostdeutschen Sprachgebrauch als spezifisch auffallen, im Wahrig-Burfeind aber nicht entsprechend gekennzeichnet oder nicht enthalten sind: Dieses Kapitel präsentiert Lexeme, die der Autorin im ostdeutschen Sprachgebrauch als spezifisch auffielen, aber im Wahrig-Burfeind nicht entsprechend gekennzeichnet oder gar nicht enthalten sind. Es unterteilt diese Lexeme in solche, die zwar im Sprachgebrauch vorhanden sind, aber ohne Markierung im Wahrig-Burfeind vorkommen, und solche die im Wahrig-Burfeind gar nicht aufgeführt sind, aber in anderen Wörterbüchern wie HDG oder KSE zu finden sind. Darüber hinaus werden auch Wendungen und andere sprachliche Elemente des ostdeutschen Sprachgebrauchs betrachtet.
Schlüsselwörter
DDR-Wortschatz, ostdeutscher Sprachgebrauch, Wahrig-Burfeind Wörterbuch, Lexem, Markierung, Bedeutungserklärung, Sprachwandel, Wiedervereinigung, gesamtdeutsches Wörterbuch, Sprachvariation, regionaler Sprachgebrauch, "Falsche Freunde".
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse der Markierung und Bedeutungserklärung von DDR-/ostdeutschen Lexemen im Deutschen Wörterbuch von Wahrig-Burfeind
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Markierung und Bedeutungserklärung von DDR- und ostdeutschem Wortschatz im Deutschen Wörterbuch von Renate Wahrig-Burfeind (1994). Der Fokus liegt auf der Perspektive eines Sprachnutzers aus Westdeutschland, der im Osten lebt, und vergleicht die Wörterbucheinträge mit dem tatsächlichen Sprachgebrauch in Ostdeutschland.
Welche Aspekte des Wahrig-Burfeind Wörterbuchs werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des Wahrig-Burfeind Wörterbuchs, darunter die unterschiedlichen Arten der Markierung von DDR-spezifischem Wortschatz (z.B. "
Wie wird die Methode der Untersuchung beschrieben?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz. Sie vergleicht die im Wahrig-Burfeind Wörterbuch gefundenen Markierungen und Bedeutungsangaben mit dem tatsächlichen Sprachgebrauch in Ostdeutschland aus der Sicht eines Westdeutschen, der im Osten lebt. Dies beinhaltet die Identifizierung von Diskrepanzen zwischen Wörterbuch und Realität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Verschiedene Arten der Markierung von DDR-/ostdeutschem Wortschatz im Deutschen Wörterbuch (Wahrig-Burfeind), Uneinheitliche Markierungen, Zu den Bedeutungsangaben, Lexeme, die mir im ostdeutschen Sprachgebrauch als spezifisch auffallen, im Wahrig-Burfeind aber nicht entsprechend gekennzeichnet oder nicht enthalten sind, und Fazit.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt konkrete Beispiele von Lexemen und Wendungen, die im ostdeutschen Sprachgebrauch spezifisch sind, aber im Wahrig-Burfeind unterschiedlich markiert oder gar nicht enthalten sind. Es werden auch "falsche Freunde" – Wörter mit unterschiedlicher Bedeutung in Ost und West – analysiert und mit Einträgen in anderen Wörterbüchern verglichen.
Welche Wörterbücher werden im Vergleich zum Wahrig-Burfeind herangezogen?
Die Arbeit vergleicht die Einträge des Wahrig-Burfeind Wörterbuchs mit denen des Handwörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache (HDG) und der KSE (kein genauer Titel genannt), um Unterschiede in den Bedeutungsangaben und der Markierung von DDR-/ostdeutschem Wortschatz aufzuzeigen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Markierung und Bedeutungserklärung von DDR-/ostdeutschem Wortschatz im Wahrig-Burfeind Wörterbuch zu analysieren und die konzeptionellen Prinzipien des Wörterbuchs in Bezug auf die Kennzeichnung ostdeutscher Lexemen zu untersuchen. Sie möchte Diskrepanzen zwischen Wörterbuch und Realität aufzeigen und die Entwicklung des deutschen Wortschatzes nach der Wiedervereinigung betrachten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: DDR-Wortschatz, ostdeutscher Sprachgebrauch, Wahrig-Burfeind Wörterbuch, Lexem, Markierung, Bedeutungserklärung, Sprachwandel, Wiedervereinigung, gesamtdeutsches Wörterbuch, Sprachvariation, regionaler Sprachgebrauch, "Falsche Freunde".
- Quote paper
- Jutta Faehndrich (Author), 1996, DDR-Wortschatz im gesamtdeutschen Wörterbuch: Bedeutungsangaben und Markierungen im "Deutschen Wörterbuch" (Wahrig-Burfeind 1994), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/21445