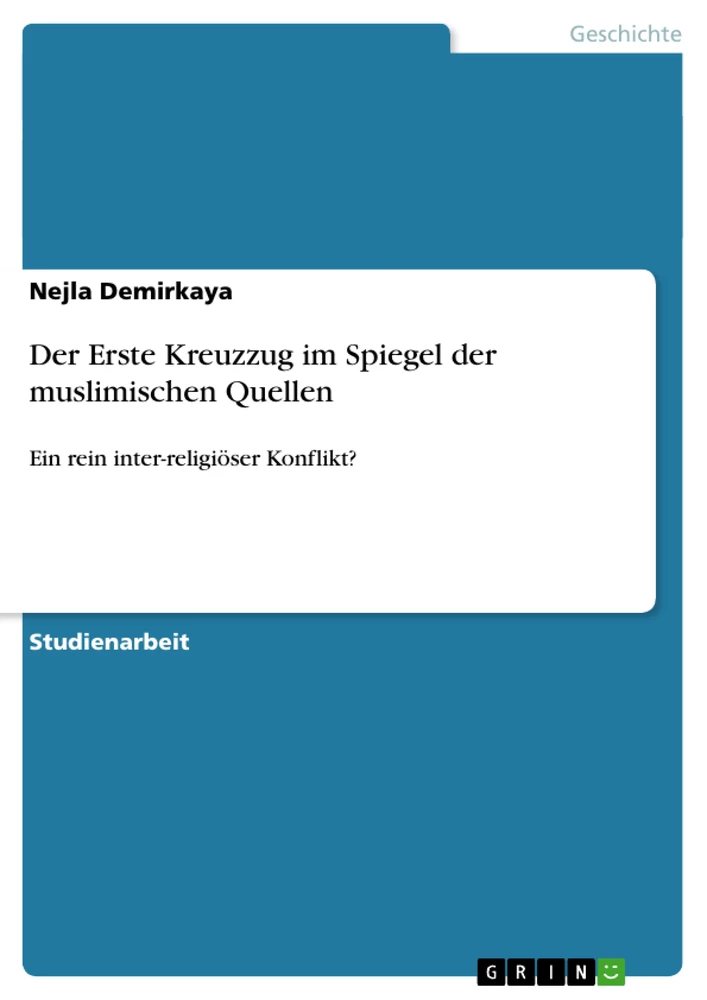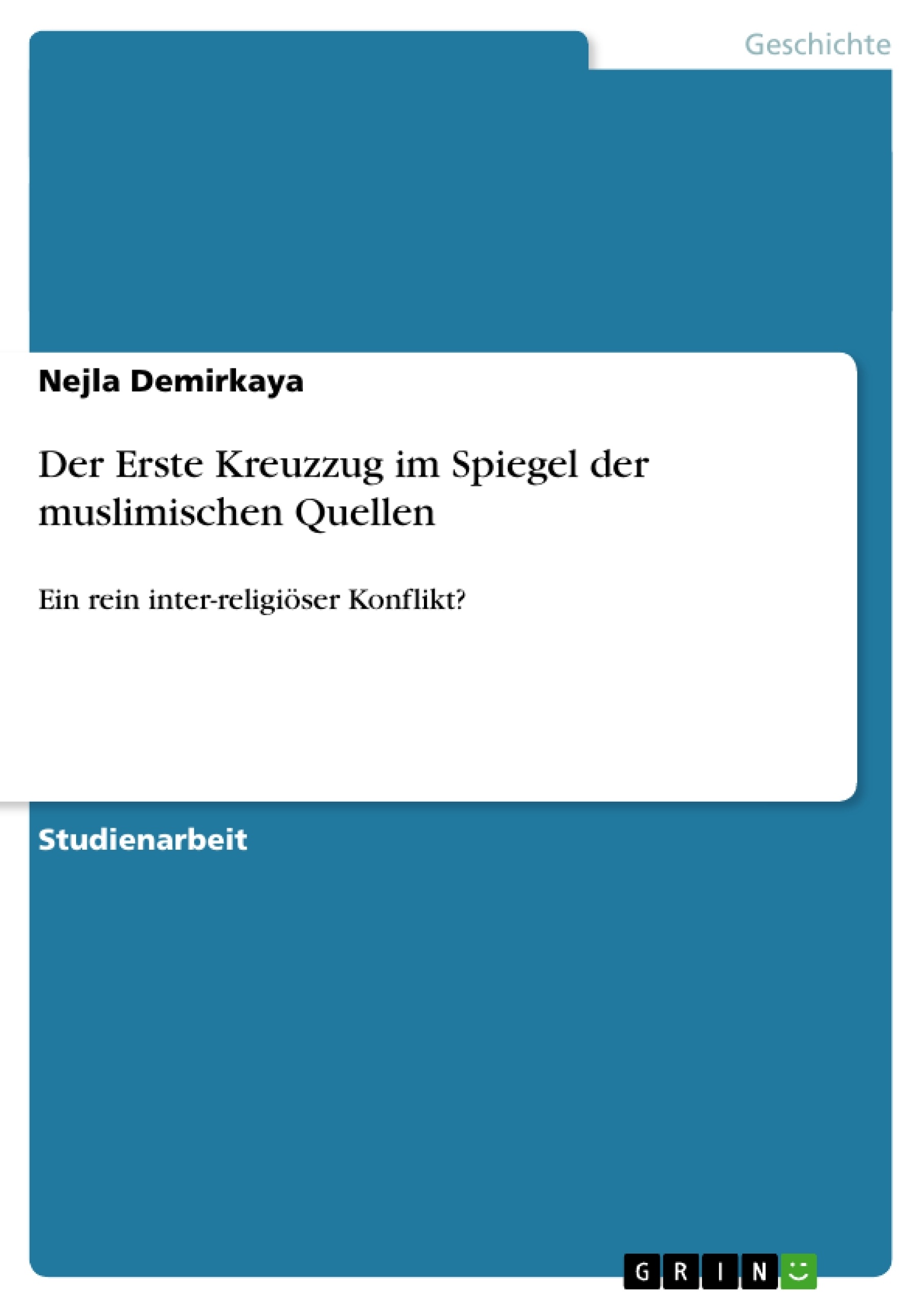Die Epoche der Kreuzzüge stellt eines der faszinierendsten und medial präsentesten Kapitel des Mittelalters dar. Die Darstellungen, z.B. in Sachbüchern und Dokumentationen, legen dabei ihren Fokus hauptsächlich auf die Sicht der Kreuzfahrer. Doch wie nahmen die „heidnischen Besatzer“, die muslimischen Herrscher und Bewohner ehemals christlicher Territorien in der Levante, die Invasion durch die bewaffneten Pilger wahr? Ihre Perspektive, obgleich schon seit dem vorletzten Jahrhundert in der Wissenschaft beachtet, dringt erst seit kurzer Zeit vermehrt in die Gesamtdarstellungen der Kreuzzüge sowie in das allgemeine Bewusstsein vor und soll im Rahmen dieser Arbeit anhand einiger Quellenbeispiele, bestehend aus Chroniken, Gedichten, Erinnerungen und einem juristischen Werk, dargelegt werden. Weitgehend unbeachtet bleiben dagegen nach wie vor die Konflikte, die nicht inter-, sondern intra-religiös ausgetragen wurden; den Hintergründen und konkreten Auswirkungen dieser internen Machtkämpfe unter den Muslimen widmen sich die folgenden Seiten unter Zuhilfenahme der muslimischen Quellen. Aufgrund seines Charakters als der erste und mit Abstand erfolg- und folgenreichste seiner Art soll der Erste Kreuzzug den Rahmen für die Auseinandersetzung mit obigen Fragestellungenstellen.
1. Einleitung
Die Epoche der Kreuzzüge stellt eines der faszinierendsten und medial präsentesten Kapitel des Mittelalters dar. Die Darstellungen, z.B. in Sachbüchern und Dokumentationen, legen dabei ihren Fokus hauptsächlich auf die Sicht der Kreuzfahrer. Doch wie nahmen die „heidnischen Besatzer“, die muslimischen Herrscher und Bewohner ehemals christlicher Territorien in der Levante, die Invasion durch die bewaffneten Pilger wahr? Ihre Perspektive, obgleich schon seit dem vorletzten Jahrhundert in der Wissenschaft beachtet, dringt erst seit kurzer Zeit vermehrt in die Gesamtdarstellungen der Kreuzzüge sowie in das allgemeine Bewusstsein vor und soll im Rahmen dieser Arbeit anhand einiger Quellenbeispiele, bestehend aus Chroniken, Gedichten, Erinnerungen und einem juristischen Werk, dargelegt werden. Weitgehend unbeachtet bleiben dagegen nach wie vor die Konflikte, die nicht inter-, sondern intra-religiös ausgetragen wurden; den Hintergründen und konkreten Auswirkungen dieser internen Machtkämpfe unter den Muslimen widmen sich die folgenden Seiten unter Zuhilfenahme der muslimischen Quellen. Aufgrund seines Charakters als der erste und mit Abstand erfolg- und folgenreichste seiner Art soll der Erste Kreuzzug den Rahmen für die Auseinandersetzung mit obigen Fragestellungen stellen. Einen wertvollen Beitrag zu diesem Thema liefert Carole Hillenbrand mit ihrer Monographie „The Crusades - Islamic Perspectives“, in welcher sie auf Grundlage ausgewählter Quellen muslimischer Herkunft die zeitgenössische Mentalität, die un- und mittelbaren Reaktionen der Welt des Islam auf das Eindringen der Kreuzfahrer nachzuvollziehen versucht. Eine zum Einstieg ins Thema geeignete Überblicksdarstellung bietet zudem Axel Havemanns Aufsatz mit dem Titel „Heiliger Kampf und Heiliger Krieg - Die Kreuzzüge aus muslimischer Perspektive“. Darin legt er den Schwerpunkt auf die Rolle des Dschihad während der Kreuzzüge, ein Thema, welchem Emmanuel Sivan ein erhellendes Buch mit dem Titel „L’Islam et la Croisade - Idéologie et Propagande dans les Réactions Musulmanes aux Croisades“ gewidmet hat. Zunächst erfolgt eine zwar grobe, zum Verständnis der Arbeit jedoch unerlässliche Darstellung über die Situation der islamischen Welt am Vorabend der Ankunft der Franken, in welcher die Hintergründe der inner-muslimischen Konflikte dargelegt werden. Der Übersichtlichkeit und Ergänzung der im späteren Kapitel erneut behandelten Ereignisse des Ersten Kreuzzuges halber folgt anschließend eine chronologische Erläuterung der markantesten Stationen der Kreuzzugsbewegung ab ihrem Beginn von Konstantinopel aus. Bevor ich daraufhin auf die muslimischen Reaktionen und die Sicht betreffs der Ursprünge und des Verlaufs sowie der Gründe für den Erfolg des Kreuzzuges eingehe, liefere ich grundsätzliche Informationen bezüglich der Quellen, welche für die Deutung der Inhalte hilfreich sind. Ein abschließender Exkurs soll klären, inwiefern das heutzutage so strittig diskutierte Konzept des Dschihad schon zum Zeitpunkt des Ersten Kreuzzugs von Bedeutung war.
2. Zur Lage der islamischen Welt am Ende des 11. Jahrhunderts
Als die Kreuzfahrer sich nach Kleinasien, Syrien und Palästina aufmachten, betraten sie politisch wie religiös in viele Fragmente gespaltene Länder, in welchen teilweise nahezu anarchische Zustände herrschten. Unmittelbar nach dem Tod Malik Schahs, unter dessen Herrschaft das Imperium der Seldschuken seine größte Ausdehnung erreichte hatte, und seines mächtigen Wesirs Nizam al-Mulk im Jahr 1092 setzte eine Zersplitterung des Reiches ein. Erbstreitigkeiten zwischen den Verwandten des Sultans führten zu einer weiteren Dezentralisierung der Macht, welche schon zu seinen Lebzeiten nicht ausschließlich in den Händen eines Einzelnen lag; Mitglieder der Dynastie waren seit jeher für die Regierungsgeschäfte der verschiedenen Provinzen verantwortlich, ein Umstand, der den Zerfall des Großseldschukischen Reiches in sich zumeist feindselig gegenüberstehende Territorien beschleunigte[1]. Kurz darauf, im Jahr 1094, kam es auch im zweiten Kernreich der islamischen Welt zu folgenschweren Todesfällen: Die des ägyptischen Kalifen al-Mustansir und seines Wesirs, al-Dschamali. Existierten zuvor bereits Spannungen zwischen den Schiiten und Sunniten[2], welche sich immer wieder in Gebietskämpfen entluden, so verschärfte sich die Situation mit dem Fehlen dieser seit Jahrzehnten in der politischen Landschaft etablierten Führungsgestalten noch weiter[3]. Der byzantinische Kaiser Alexios Komnenos, dessen Imperium nach der Schlacht von Manzikert 1071 und der darauffolgenden Gründung des Sultanats der Rum-Seldschuken massive territoriale Verluste erlitten hatte, war sich der fragilen Situation in Kleinasien und Syrien sowie der vielfältigen Feindschaften zwischen den muslimischen Anführern bewusst; daher liegt die Vermutung nahe, dass er mit seinen Hilfsappellen an die lateinische Christenheit in Europa die Gunst der Stunde zu nutzen gedachte[4]. Im Mittelpunkt der Nachfolgekonflikte um das Großseldschukische Reich standen der älteste Sohn Malik Schahs, Berk-Yaruq, sowie des letzteren Onkel, Tutusch. Aus diesen Konflikten ging 1094 Berk-Yaruq als Sultan hervor. Dem Tod Tutuschs im Jahr 1095 folgte ein jahrelanger blutiger Bruderstreit zwischen dessen beiden Söhnen Radwan und Duqaq, denen je die Regentschaft über die Städte Aleppo und Damaskus zugekommen war. Die Stadt Nicäa, deren Belagerung und Eroberung einen markanten Punkt im Verlauf des Ersten Kreuzzuges darstellt, war 1077 durch die Rum-Seldschuken dem Byzantinischen Reich abgenommen worden. Ein Jahr später fiel das unter fatimidischer Herrschaft stehende Jerusalem in die Hände der Seldschuken. Der Expansionsdrang Süleymans, dem Begründer des Sultanats der Rum-Seldschuken, führte zum Krieg zwischen den türkischen Reichen, welcher im Tod Süleymans 1086 und der Vereinnahmung Antiochias endete. Süleymans Sohn Kilitsch Arslan, zuvor ein jahrelang Gefangener des gegnerischen Sultans, stellte nach dem Tode Malik Schahs mit seiner Rückkehr in die Hauptstadt Nicäa das Reich seines Vaters wieder her. Letzterer hatte das eroberte Antiochia seinem Sklaven Yaghi-Siyan unterstellt, der einer der wenigen von ihm eingesetzten Herrscher sein würde, die nach den turbulenten Machtstreitigkeiten unter den Türken zum Zeitpunkt des Ersten Kreuzzuges noch ihren ursprünglichen Posten innehatten. Dem fatimidischen Ägypten, nun unter der Fuchtel des Wesirs al-Afdal, ehrgeiziger Sohn seines Vorgängers al-Dschamali, war als Folge der aggressiven Expansionspolitik der Türken von seinen Gebieten nur ein schmaler Küstenstreifen in Syrien geblieben – ein Zustand, den die Fatimiden nicht lange hinnahmen. Hinter all den verschiedenen Fürsten, Statthaltern und militärischen Befehlshabern, die die muslimische Levante beherrschten, standen letztlich das Großseldschukische Sultanat, die Rum-Seldschuken und das Ägypten der Fatimiden; drei Supermächte, denen, wie sich im Folgenden zeigen wird, eine effektive Zusammenarbeit gegen den gemeinsamen Feind unmöglich war.
3. Chronik der wichtigsten Stationen des Ersten Kreuzzuges
Die Kreuzfahrer trafen nach ihrem Aufbruch von Konstantinopel zusammen mit Einheiten der byzantinischen Armee im Mai 1097 in Gestalt der Rum-Seldschuken zum ersten Mal auf ihre Feinde, deren Hauptstadt Nicäa nun einer mehrwöchigen Belagerung durch die europäischen Invasoren standhalten musste. Schließlich verlor ihr Sultan Kilitsch Arslan, der der türkischen Garnison der Stadt mit seiner großen Armee aus Ost-Anatolien zu Hilfe gekommen war. Nach einem weiteren Monat erbitterten Widerstands gaben sich die vom flüchtigen Sultan und seiner Armee zurückgelassenen Türken am 19. Juni der Übermacht der Franken geschlagen, woraufhin Nicäa nach zwanzig Jahren zurück in das Byzantinische Reich eingegliedert wurde. Auch der letzte Versuch Kilitsch Arslans, den christlichen Invasoren Einhalt zu gebieten, scheiterte: In der Schlacht von Doryläum am 1. Juli 1097 unterlagen er und seine Truppen, und zwar wie auch schon in Nicäa vermutlich hauptsächlich deshalb, weil er seine Gegner schlicht unterschätzte; auch begegnete ihm erstmals eine Art religiösen Eifers, der die Kreuzfahrer in ihrem Kampf unterstützte und zu ihren Siegen beigetragen haben mochte[5]. Auf ihrem Weg südwärts gen Jerusalem stand den Kreuzfahrern eine große Hürde bevor: Die schon damals uralte und als Machtgarant umkämpfte Stadt Antiochia, deren Einnahme für den erfolgreichen Verlauf der Bewegung von den Kreuzfahrern zutreffenderweise als unabdingbar eingeschätzt wurde[6]. Der Statthalter Yaghi-Siyan schickte seine beiden Söhne auf diplomatische Mission in die anderen großen Städte der Region, um Hilfe zu erbitten. Die Belagerung der Stadt begann im Oktober 1097. Trotz der vorausschauenden Organisation breitete sich schon bald der Hunger aus, weshalb Ende Dezember eine Expedition aufbrach, nach Lebensmitteln zu suchen. Diese Mission erwies sich als Misserfolg, denn in einem chaotischen Kampf mit den Truppen Duqaqs von Damaskus, welcher die Hilfsappelle Yaghi-Siyans erhört hatte, verlor das Kontingent zahlreiche Männer sowie die erbeuteten Lebensmittel. Die vor Antiochia verbliebene Armee musste derweil eine Niederlage vorallem moralischer Natur hinnehmen; in einem durch die türkische Garnison initiierten Kampf verlor Adémar, der Botschafter des Papstes und geistlicher Führer des Kreuzzuges, sein Banner mit dem Abbild der Jungfrau Maria an die Türken, ein eher symbolischer als materieller Verlust[7]. Im Februar 1098 bedrohte die übermächtig scheinende Armee Radwan von Aleppos die Belagerer, und es ist wohl allein ihrem taktischen Genie geschuldet, dass sie dennoch einen spektakulären Sieg haben davontragen können. Hätte der gegenseitige Hass der beiden Brüder Duqaq und Radwan eine Allianz nicht verhindert, so hätte der Kreuzzug in Antiochia gewiss zu seinem Ende gefunden[8]. Schließlich waren es ein oder mehrere Verräter innerhalb der Mauern Antiochias, die die Stadt zu Fall brachten. Kurz vor der Ankunft Kerbogas, des Atabegs von Mosul, dessen Armee sich aus Muslimen unterschiedlichster Herkunft zusammensetzte, drangen die Kreuzfahrer Anfang Juni in die Stadt ein und richteten ein Blutbad an. Die nun ihrerseits von Kerbogas zahlenmäßig überlegener Armee Belagerten litten Hunger, erschwerend kam ein Mangel an Pferden hinzu. Das Auffinden der vermeintlichen Heiligen Lanze in der St.-Petrus-Grotte stärkte die Kampfmoral der eingeschlossenen Christen und trug somit zu ihrem Sieg gegen die Muslime am 28. Juni bei[9]. Aus den folgenden Wirren um die Herrschaft über Antiochia ging Bohemund von Tarent als erstes Oberhaupt des Fürstentums Antiochia hervor, des zweiten Kreuzfahrerstaates, nachdem Balduin von Boulogne nur wenige Monate zuvor zum ersten Grafen von Edessa ernannt worden war. Eines der nächsten Ziele auf syrischem Boden, Ma’arrat al-Nu’man, war niemals eine Stadt von außerordentlicher Größe oder sonstiger Bedeutsamkeit[10] und bleibt vor allem aufgrund des auf die nur wenige Wochen andauernde Belagerung im Winter 1098 folgenden Massakers in Erinnerung. In den Monaten darauf gingen die Kreuzfahrer erstmals friedliche Beziehungen mit ihren eigentlichen Feinden, den Muslimen ein. So boten ihnen die Munqidhiten freies Geleit durch ihr Territorium sowie Nahrung und für den Kampf dringend benötigte Pferde an. Die arabische Dynastie wird die westlichen Eindringlinge kaum als Freunde angesehen haben; jedoch eilte den Franken bereits der Ruf zerstörerischer Barbarei voraus, weshalb ein möglichst konfliktfreies Vorbeischleusen an ihrer Hauptstadt Shaizar angebracht schien. Hinzu kam die Feindschaft zu den Seldschuken, welche die Kreuzfahrer mit den Munqidhiten teilten[11] und Letztere dazu bewogen haben mag, in den Christen bis zu einem gewissen Grad Verbündete zu sehen. Im Juni 1099 erreichten die verbliebenen Kreuzfahrer nach drei entbehrungs- und verlustreichen Jahren die Heilige Stadt Jerusalem und sahen sich nun den Fatimiden gegenüber, mit denen es zuvor aufgrund ihres gemeinsamen Hasses gegenüber den Türken zu politischen Annäherungen gekommen war, welche jedoch letztendlich scheiterten. Am 15. Juli gelang den von religiösem Eifer überwältigten Kreuzfahrern die Stürmung der Schutzmauer; die daraufhin stattfindende blutige Plünderung sei eines der „außergewöhnlichsten und entsetzlichsten Ereignisse des Mittelalters“[12]: Kaum ein muslimischer Bewohner überlebte das Massaker. Der Sieg der Christen blieb jedoch nicht unangefochten: Die Armee des ägyptischen Wesirs al-Afdal nahte heran. Bei Askalon konnten die Kreuzfahrer am 12. August 1099 jedoch einmal mehr einen triumphalen Sieg davontragen, welcher das Ende des Ersten Kreuzzuges markiert.
[...]
[1] Holt, P.M.: The Age of the Crusades. The Near East from the eleventh century to 1517, New York 1986, S. 11.
[2] Sowohl das sunnitische Kalifat der Abbasiden mit Sitz in Bagdad als auch das schiitische Kalifat der Fatimiden in Kairo legitimierten ihren Führungsanspruch der islamischen Welt mit ihren historischen Verbindungen zum Propheten Mohammed. Tughrul Beg, das Oberhaupt der Seldschuken-Dynastie und sunnitischer Muslim, eroberte 1055 Bagdad aus den Händen der schiitischen Buyiden, worauf er vom Kalifen mit dem Titel des Sultan belohnt wurde.
[3] Asbridge, Crusade, S. 132.
[4] France, John: Victory in the East. A military history of the First Crusade, Cambridge 1996, S. 156.
[5] France, Victory, S. 185.
[6] Asbridge, Thomas: The First Crusade. A new history, London 2004, S. 157.
[7] Ebd., S. 173.
[8] Ebd., S. 186.
[9] Asbridge, Crusade, S. 240.
[10] Siehe Hillenbrand, Perspectives, S. 59 oder France, Victory, S. 311.
[11] Asbridge, Crusade, S. 278.
[12] Ebd., S. 316.
- Quote paper
- Nejla Demirkaya (Author), 2012, Der Erste Kreuzzug im Spiegel der muslimischen Quellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/214359