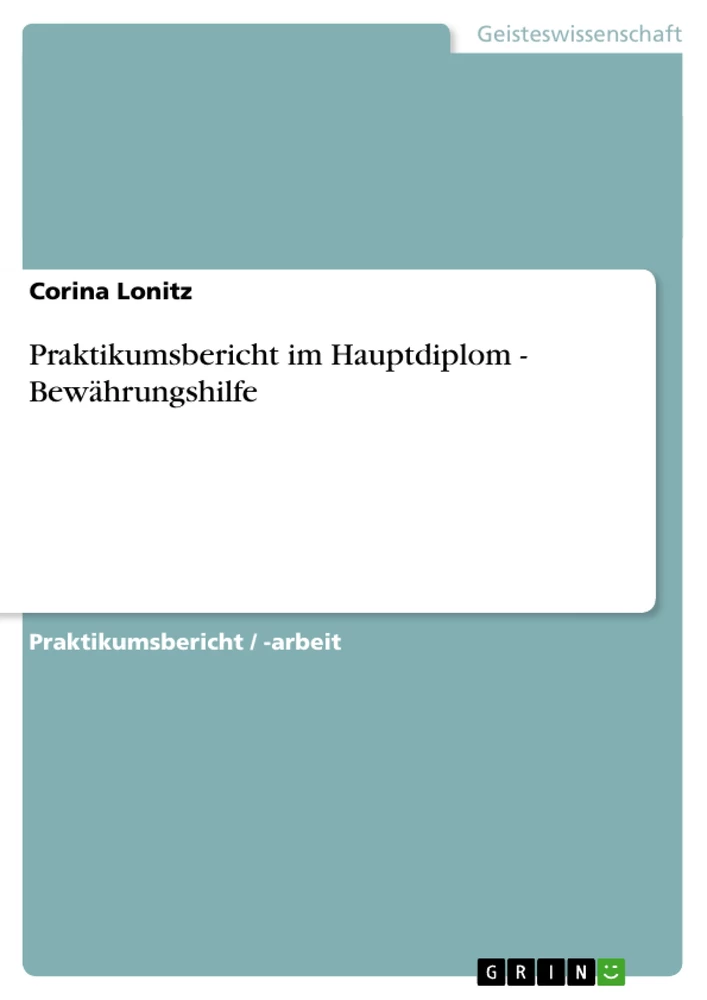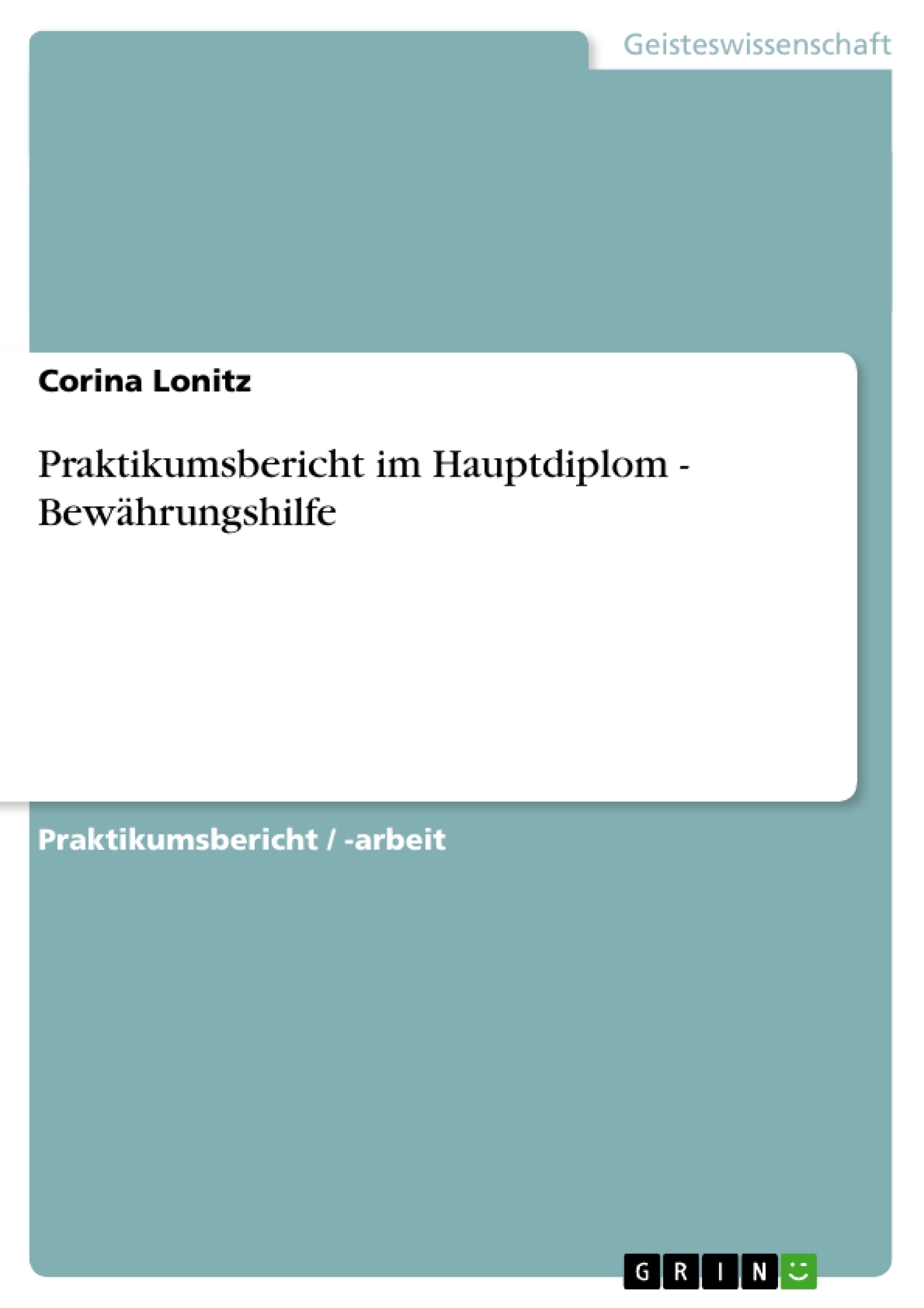Der vorliegende Praktikumsbericht unterteilt sich im wesentlichen in 2
verschiedene Abschnitte.
Zu Beginn der Arbeit steht das Tätigkeitsfeld der Bewährungshilfe im
Vordergrund, um das vergangene Praktikum theoretisch zu reflektieren. Dazu
wird ein kurzer Einblick in die historische Entwicklung der Bewährungshilfe
gegeben, um das Wachstum dieses Tätigkeitsbereiches darzustellen. Da die
Bewährungshilfe innerhalb der verschiedenen Bundesländer unterschiedlich
institutionell eingegliedert ist, wird im Anschluß daran auf die Position der
Bewährungshilfe innerhalb des Justizsystems in Sachsen eingegangen. Damit
die Bewährungshilfe überhaupt tätig werden kann, bedarf es einiger gesetzlicher
Rahmenbedingungen, die im Jugendstrafrecht anders als im
Erwachsenenstrafrecht sind. Aus diesem Grund ist der Punkt 3.3 nochmals in
zwei Abschnitte unterteilt. Aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen lassen
sich die Aufgaben und Pflichten der Bewährungshilfe ableiten. Daraus geht das
sogenannte doppelte Mandat hervor, denn die Aufgaben beinhalten einerseits
Hilfe und Betreuung und andererseits Kontrolle und Überwachung.
Im nächstgrößeren Teil der Arbeit wird ein Themenbereich aufgegriffen, der
durch eine kritische Reflexion des Praktikums sichtbar wurde. Die weitere
Vorgehensweise ergibt sich daher aus den konkreten Fragestellungen, die unter
Punkt 4 formuliert wurde und im folgenden beantwortet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Die Bewährungshilfe
- Die historische Entwicklung der Bewährungshilfe
- Die Position der Bewährungshilfe innerhalb des Justizsystems am Beispiel Sachsen
- Gesetzliche Rahmenbedingungen für die Bewährungshilfe
- Im JGG
- Im StGB
- Die Aufgaben und Pflichten der Bewährungshilfe
- Hilfe und Betreuung
- Die Bewährungshilfe als Kontroll- und Überwachungsmechanismus
- Weitere Aufgaben der Sozialen Dienste der Justiz: Führungsaufsicht und Gerichtshilfe
- Kritische Reflexion des Praktikums
- Qualitätssicherung im non – profit – Bereich
- Begriffsbestimmungen
- Normen und Standards
- Was ist ISO?
- ISO Standards im non – profit – Bereich
- Diskussion pro und contra Qualitätssicherung
- Qualitätssicherung durch Neustrukturierung der Sozialen Dienste der Justiz
- Schlußwort
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Praktikumsbericht reflektiert die Erfahrungen der Autorin während eines Praktikums im Sozialen Dienst der Justiz in Chemnitz. Die Arbeit zielt darauf ab, die Tätigkeit der Bewährungshilfe theoretisch zu beleuchten und durch eine kritische Reflexion des Praktikums zu ergänzen.
- Historische Entwicklung der Bewährungshilfe
- Position der Bewährungshilfe im Justizsystem Sachsens
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und Aufgaben der Bewährungshilfe (JGG und StGB)
- Das „doppelte Mandat“ der Bewährungshilfe (Hilfe und Kontrolle)
- Qualitätssicherung im non-profit-Bereich der Sozialen Dienste der Justiz
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Der Bericht beschreibt die Struktur des Praktikums, gegliedert in Orientierungs-, Fallbezogenen Lern- und Ablösungsphase. Die Orientierungsphase umfasste das Kennenlernen der Dienststelle, Verwaltungspraxis, gesetzlicher Grundlagen und sozialpädagogischer Inhalte wie Anamneseerhebung, Erstellung von Diagnosen und Behandlungsplänen, kriminologische Überlegungen und praktische Hilfestellungen.
Einleitung: Die Einleitung strukturiert den Bericht in zwei Abschnitte: einen theoretischen Teil zur Bewährungshilfe und einen kritischen Reflexionsteil des Praktikums. Sie skizziert die historische Entwicklung der Bewährungshilfe, ihre institutionelle Einbettung in Sachsen und die relevanten gesetzlichen Grundlagen (JGG und StGB), um das doppelte Mandat von Hilfe und Kontrolle zu verdeutlichen.
Die Bewährungshilfe: Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung der Bewährungshilfe, beginnend im 19. Jahrhundert mit christlich motivierter Reintegrationsarbeit. Er beschreibt die Verlagerung vom Vergeltungs- hin zum Präventionsgedanken im Strafrecht und die daraus resultierende Entwicklung ambulanter Straffälligenhilfe. Weiterhin werden die Position der Bewährungshilfe im sächsischen Justizsystem, die gesetzlichen Grundlagen (JGG und StGB) und die Aufgaben der Bewährungshilfe (Hilfe, Betreuung, Kontrolle, Überwachung) detailliert dargestellt.
Kritische Reflexion des Praktikums: Dieser Abschnitt widmet sich der Qualitätssicherung im Non-Profit-Bereich, definiert relevante Begriffe und diskutiert Normen und Standards, insbesondere ISO-Standards. Die Diskussion beleuchtet Argumente für und gegen Qualitätssicherung und betrachtet die Möglichkeiten zur Qualitätssicherung durch Neustrukturierung der Sozialen Dienste der Justiz.
Schlüsselwörter
Bewährungshilfe, Justizsystem Sachsen, Jugendstrafrecht (JGG), Strafgesetzbuch (StGB), Resozialisierung, Prävention, Kontrolle, Betreuung, Qualitätssicherung, Non-Profit-Bereich, Sozialpädagogik.
Häufig gestellte Fragen zum Praktikumsbericht: Bewährungshilfe in Sachsen
Was ist der Inhalt des Praktikumsberichts?
Der Bericht dokumentiert die Erfahrungen der Autorin während eines Praktikums im Sozialen Dienst der Justiz in Chemnitz. Er besteht aus einem theoretischen Teil über die Bewährungshilfe und einer kritischen Reflexion des Praktikums. Der Bericht behandelt die historische Entwicklung der Bewährungshilfe, ihre Rolle im sächsischen Justizsystem, die gesetzlichen Grundlagen (JGG und StGB), ihr "doppeltes Mandat" (Hilfe und Kontrolle) und die Qualitätssicherung im Non-Profit-Bereich der Sozialen Dienste der Justiz.
Welche Themen werden im Bericht behandelt?
Die zentralen Themen sind: die historische Entwicklung der Bewährungshilfe, ihre Position im sächsischen Justizsystem, die gesetzlichen Rahmenbedingungen (JGG und StGB), die Aufgaben der Bewährungshilfe (Hilfe, Betreuung, Kontrolle), das "doppelte Mandat" der Bewährungshilfe, und die Qualitätssicherung im Non-Profit-Bereich der Sozialen Dienste der Justiz, einschließlich der Diskussion von ISO-Standards.
Wie ist der Bericht strukturiert?
Der Bericht ist gegliedert in ein Vorwort, eine Einleitung, ein Kapitel über die Bewährungshilfe, ein Kapitel zur kritischen Reflexion des Praktikums, ein Schlusswort, einen Anhang und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird zusammengefasst und die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte werden explizit genannt.
Welche Phasen umfasste das Praktikum?
Das Praktikum umfasste drei Phasen: die Orientierungsphase (Kennenlernen der Dienststelle, Verwaltungspraxis, gesetzlicher Grundlagen und sozialpädagogischer Inhalte), die fallbezogene Lernphase und die Ablösungsphase.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden behandelt?
Der Bericht behandelt die gesetzlichen Grundlagen der Bewährungshilfe im Jugendgerichtsgesetz (JGG) und im Strafgesetzbuch (StGB).
Was ist das "doppelte Mandat" der Bewährungshilfe?
Das "doppelte Mandat" bezieht sich auf die gleichzeitige Aufgabe der Bewährungshilfe, sowohl Hilfe und Betreuung als auch Kontrolle und Überwachung von straffälligen Personen zu leisten.
Welche Aspekte der Qualitätssicherung werden diskutiert?
Der Bericht diskutiert die Qualitätssicherung im Non-Profit-Bereich, definiert relevante Begriffe, behandelt Normen und Standards (insbesondere ISO-Standards) und erörtert Argumente für und gegen Qualitätssicherung sowie Möglichkeiten zur Verbesserung durch Neustrukturierung der Sozialen Dienste der Justiz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Bericht?
Schlüsselwörter sind: Bewährungshilfe, Justizsystem Sachsen, Jugendstrafrecht (JGG), Strafgesetzbuch (StGB), Resozialisierung, Prävention, Kontrolle, Betreuung, Qualitätssicherung, Non-Profit-Bereich, Sozialpädagogik.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, der Bericht enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel: Vorwort, Einleitung, Bewährungshilfe, Kritische Reflexion des Praktikums.
- Arbeit zitieren
- Corina Lonitz (Autor:in), 2002, Praktikumsbericht im Hauptdiplom - Bewährungshilfe, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/21384