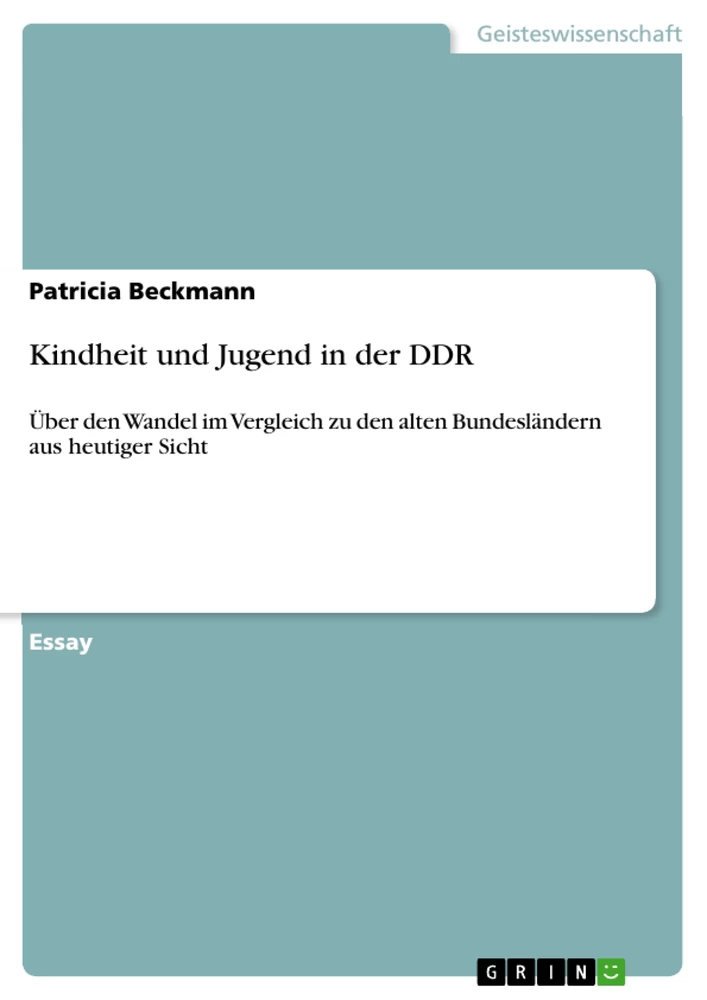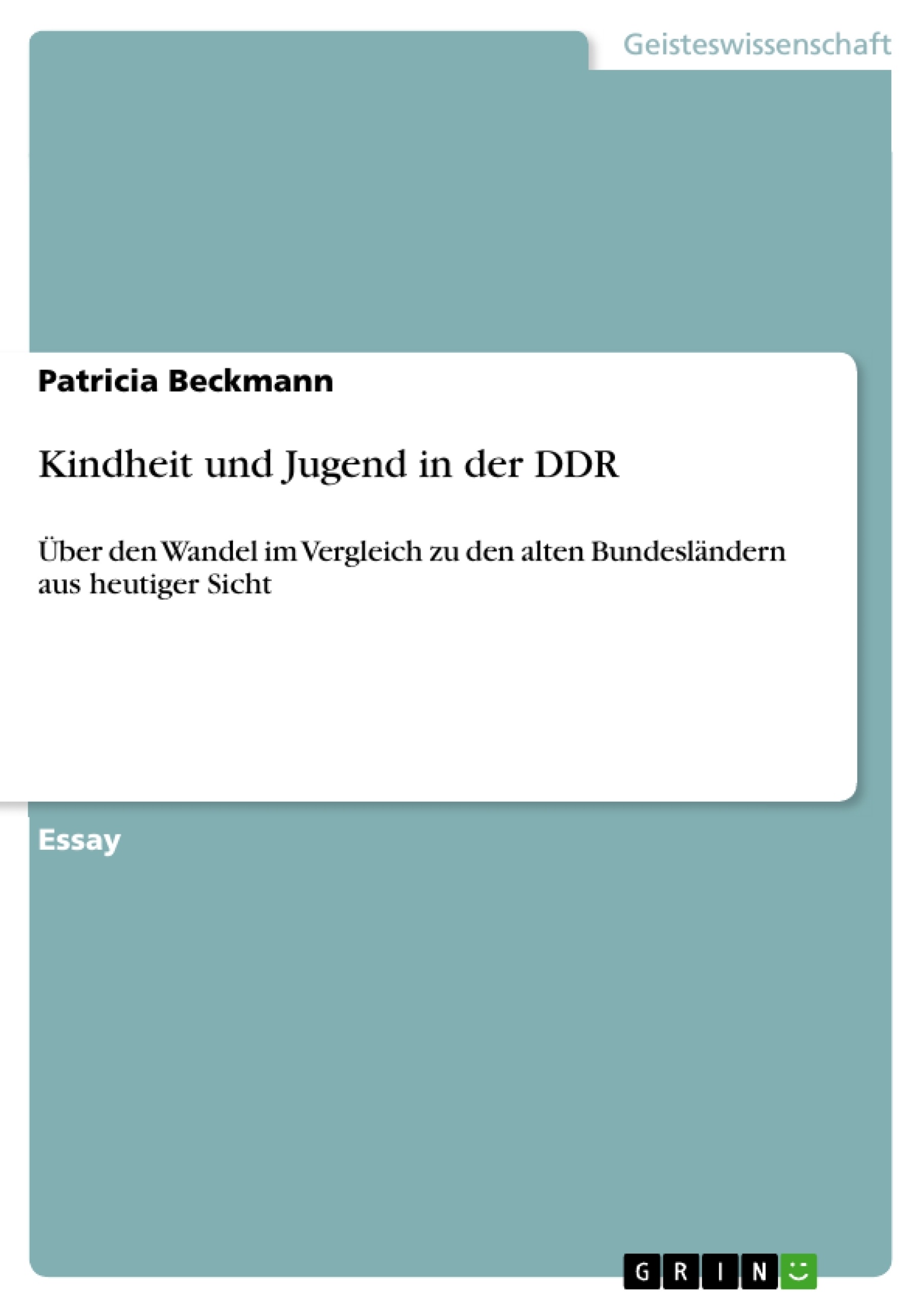Der „autoritär-vormundschaftliche DDR Staat“ (Neunter Jugendbericht, S. 25), der auf umfassende Integration und Erziehung aller Mitglieder der Gesellschaft unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei der SED setzte und den Kampf gegen den kapitalistischen Klassenfeind führte (vgl. Neunter Jugendbericht, S. 26), nutzte gesellschaftlich weitreichende Felder, wie das Bildungssystem, den außerschulischen und vorberuflichen Bereich/Freizeit, sowie indirekt die Instanz der Familie, um direkt und kontrolliert auf Bildung, Erziehung und Sozialisation der DDR-Kinder und -Jugendlichen Einfluss zu haben.
Das Bildungssystem der DDR mit dem ganzheitlichen Konzept der Arbeitserziehung zielte „auf die Einübung der jungen Generation in die sozialistische Arbeitsgesellschaft“ (Neunter Jugendbericht, S. 24). Kinder und Jugendliche galten als „Nachwuchspotential der Werkstätigen in der sozialistischen Produktion“ (Neunter Jugendbericht, S. 24). So wurde der jungen Generation in der Schule Disziplin, Ordnung und Zuverlässigkeit vermittelt, mit dem Ziel, dass sich die allseitig gebildeten Persönlichkeiten der Sache des Sozialismus verschreiben (vgl Neunter Jugendbericht, S. 24). Durch Krippe oder Kindergarten schon gewöhnt an Anpassung und Unterordnung, hatten viele Jungen und Mädchen aber auch Freude am Lernen. „Die für jeden garantierte Perspektive auf einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz verhinderte zumeist im großen Stil schulische Frustrationen“ (Neunter Jugendbericht, S. 25). Der DDR Staat beabsichtigte hierbei die Entwicklung von Individualität und Eigensinn selbstbewusster-kritischer Menschen nicht (vgl Neunter Jugendbericht, S. 25).
Schule und Ausbildungsplatz waren in einer bildungspolitischen Phase für die Rekrutierung einer neuen Sozialstruktur und einer sie repräsentierenden Führungselite instrumentalisiert worden (vgl Neunter Jugendbericht, S. 25). Das Bildungssystem hat effizient zum Aufbau und zur Reproduktion seiner Macht und Funktionselite beigetragen. So wurde „bei den männlichen Jugendlichen die Vergabe eines attraktiven Studienplatzes zunehmend von einer Verpflichtungserklärung für einen dreijährigen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee abhängig gemacht“ (Neunter Jugendbericht, S. 26).
„Kindheit und Jugend in der DDR waren systematisch durch die spezifisch politisch-ideologischen Funktionen der FDJ und ihrer Pionierorganisationen geprägt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Der „autoritär-vormundschaftliche DDR Staat“
- Kindheit und Jugend in der DDR
- Ein Vergleich von 1992
- Freizeitverhalten 2006
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht den Wandel von Sozialisationskontexten für Kinder und Jugendliche zwischen 1945 und der Gegenwart, insbesondere im Vergleich zwischen der DDR und den alten Bundesländern. Die Analyse fokussiert auf die Entwicklungen in den Lebensphasen Kindheit und Jugend und deren Einfluss auf die Familienstrukturen und das Freizeitverhalten.
- Sozialisation in der DDR
- Vergleich DDR und alte Bundesländer
- Rolle der Familie
- Bedeutung von Gleichaltrigen
- Entwicklung des Freizeitverhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
Der „autoritär-vormundschaftliche DDR Staat“: Dieses Kapitel beschreibt den umfassenden Einfluss des DDR-Staates auf die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Das Bildungssystem, die FDJ und die Familie wurden instrumentalisiert, um die junge Generation im Sinne des Sozialismus zu erziehen und zu integrieren. Die garantierte Arbeitsplatzsicherheit verhinderte zwar Frustrationen, doch individuelle Entwicklung und kritisches Denken wurden nicht gefördert. Das Bildungssystem diente der Rekrutierung einer neuen Führungselite, wie die Kopplung von Studienplätzen an den Wehrdienst verdeutlicht.
Kindheit und Jugend in der DDR: Dieses Kapitel analysiert die prägende Rolle der FDJ und der Pionierorganisationen. Obwohl die FDJ zahlreiche Freizeitaktivitäten anbot und gesellschaftliche Werte vermittelte, führte die latente Indoktrination und die Machtstrukturen zu Anpassungsdruck und Einschüchterung. Trotz der hohen Partizipationsrate bildeten sich zunehmend informelle Gruppen und Jugendszenen als Gegenpol zu den staatlichen Institutionen. Die Familie agierte eher als komplementäre Struktur zur staatlichen Ideologie, mit einem familienzentrierten Lebensstil, geprägt von autoritären Eltern-Kind-Beziehungen. Gegen Ende der DDR nahm die Gewalt in Familien zu, was auch auf die Spannungen im politischen und beruflichen Kontext zurückzuführen ist.
Ein Vergleich von 1992: Dieses Kapitel vergleicht die Situation von Kindern und Jugendlichen in den neuen und alten Bundesländern im Jahr 1992. Die Familie spielte in beiden Teilen Deutschlands eine zentrale Rolle, jedoch zeigte sich eine stärkere Familienorientierung in den neuen Bundesländern, mit früheren Lebensereignissen wie Heirat und Kinderkriegen. Eltern in den alten Bundesländern investierten mehr und länger in ihre Kinder, wobei generell mehr in Söhne als in Töchter investiert wurde. Gleichaltrige waren ebenfalls wichtig, jedoch waren Jugendliche in den neuen Bundesländern weniger in Vereinen und Cliquen organisiert, was auf eine Organisationsmüdigkeit nach der durchorganisierten DDR-Jugend zurückgeführt wird. Freizeitaktivitäten waren in den neuen Bundesländern durch weniger finanzielle Möglichkeiten und weniger freie Zeit eingeschränkt.
Freizeitverhalten 2006: Dieses Kapitel analysiert die Freizeitaktivitäten von Jugendlichen im Jahr 2006. Im Gegensatz zu den kurzfristigen Unterschieden nach der Wende zeigen sich 2006 kaum Unterschiede zwischen Ost und West. Bildungsniveau und soziale Schicht spielen eine größere Rolle als die regionale Herkunft. Es werden vier Gruppen von Freizeitverhalten identifiziert: „kauflustige Familienmenschen“, „Technikfreaks“, „kreative Freizeitelite“ und eine Gruppe mit Fokus auf Fernsehen, Videos und Computerspielen. Der Medienkonsum wird durch das Bildungsniveau der Eltern beeinflusst. Die Bedeutung von Gleichaltrigen bleibt bestehen, jedoch ist die Cliquenzugehörigkeit in den neuen Bundesländern geringer als in den alten, wobei sich dieser Unterschied im Laufe der Jahre verringert.
Schlüsselwörter
Sozialisation, Kindheit, Jugend, DDR, Bundesrepublik Deutschland, Familie, Gleichaltrige, FDJ, Freizeitverhalten, Bildungssystem, Sozialisationskontexte, politische Indoktrination, Eltern-Kind-Beziehung, gesellschaftlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Sozialisation von Kindern und Jugendlichen in der DDR und der Bundesrepublik
Was ist der Gegenstand dieses Essays?
Der Essay untersucht den Wandel von Sozialisationskontexten für Kinder und Jugendliche in Deutschland zwischen 1945 und der Gegenwart. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen der DDR und den alten Bundesländern, wobei die Entwicklungen in Kindheit und Jugend sowie deren Einfluss auf Familienstrukturen und Freizeitverhalten analysiert werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Sozialisation in der DDR, ein Vergleich zwischen DDR und alten Bundesländern, die Rolle der Familie, die Bedeutung von Gleichaltrigen und die Entwicklung des Freizeitverhaltens.
Wie wird die Sozialisation in der DDR dargestellt?
Das Kapitel über den „autoritär-vormundschaftlichen DDR-Staat“ beschreibt den umfassenden staatlichen Einfluss auf die Sozialisation. Bildungssystem, FDJ und Familie wurden instrumentalisiert, um die junge Generation im Sinne des Sozialismus zu erziehen. Obwohl Arbeitsplatzsicherheit bestand, wurden individuelle Entwicklung und kritisches Denken nicht gefördert. Die Rolle der FDJ und der Pionierorganisationen, inklusive ihrer Indoktrination und des daraus resultierenden Anpassungsdrucks, wird ebenfalls analysiert. Die Familie fungierte als komplementäre Struktur zur staatlichen Ideologie, oft geprägt von autoritären Eltern-Kind-Beziehungen.
Wie wird der Vergleich zwischen DDR und alten Bundesländern gestaltet?
Der Vergleich von 1992 zeigt Unterschiede in der Familienorientierung (stärker in den neuen Bundesländern), den elterlichen Investitionen in Kinder und die Organisation von Jugendlichen in Vereinen und Cliquen (weniger in den neuen Bundesländern). Finanzielle Möglichkeiten und Freizeit waren in den neuen Bundesländern eingeschränkter.
Welche Erkenntnisse liefert die Analyse des Freizeitverhaltens im Jahr 2006?
Im Jahr 2006 zeigen sich kaum regionale Unterschiede zwischen Ost und West. Bildungsniveau und soziale Schicht sind wichtiger als die regionale Herkunft. Vier Gruppen von Freizeitverhalten werden identifiziert: „kauflustige Familienmenschen“, „Technikfreaks“, „kreative Freizeitelite“ und eine Gruppe mit Fokus auf Medienkonsum. Der Einfluss des Bildungsniveaus der Eltern auf den Medienkonsum wird hervorgehoben. Die Bedeutung von Gleichaltrigen bleibt bestehen, jedoch ist die Cliquenzugehörigkeit in den neuen Bundesländern geringer.
Welche Kapitel umfasst der Essay?
Der Essay beinhaltet Kapitel zu: „Der ‚autoritär-vormundschaftliche DDR Staat‘“, „Kindheit und Jugend in der DDR“, „Ein Vergleich von 1992“ und „Freizeitverhalten 2006“.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Essay?
Schlüsselwörter sind Sozialisation, Kindheit, Jugend, DDR, Bundesrepublik Deutschland, Familie, Gleichaltrige, FDJ, Freizeitverhalten, Bildungssystem, Sozialisationskontexte, politische Indoktrination, Eltern-Kind-Beziehung und gesellschaftlicher Wandel.
- Quote paper
- Patricia Beckmann (Author), 2013, Kindheit und Jugend in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/213294