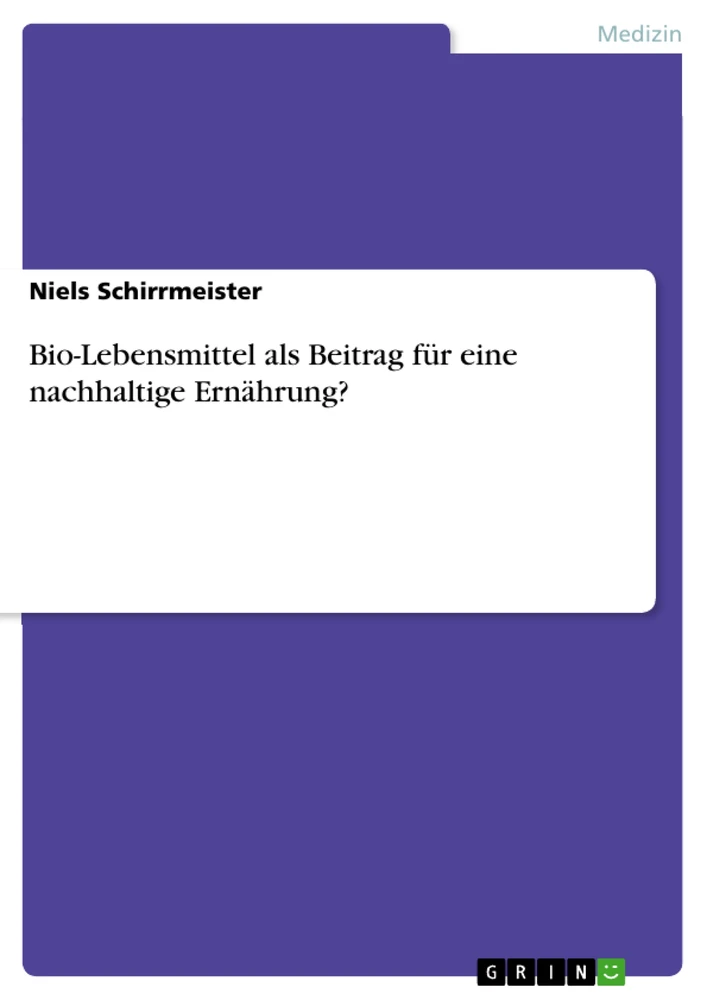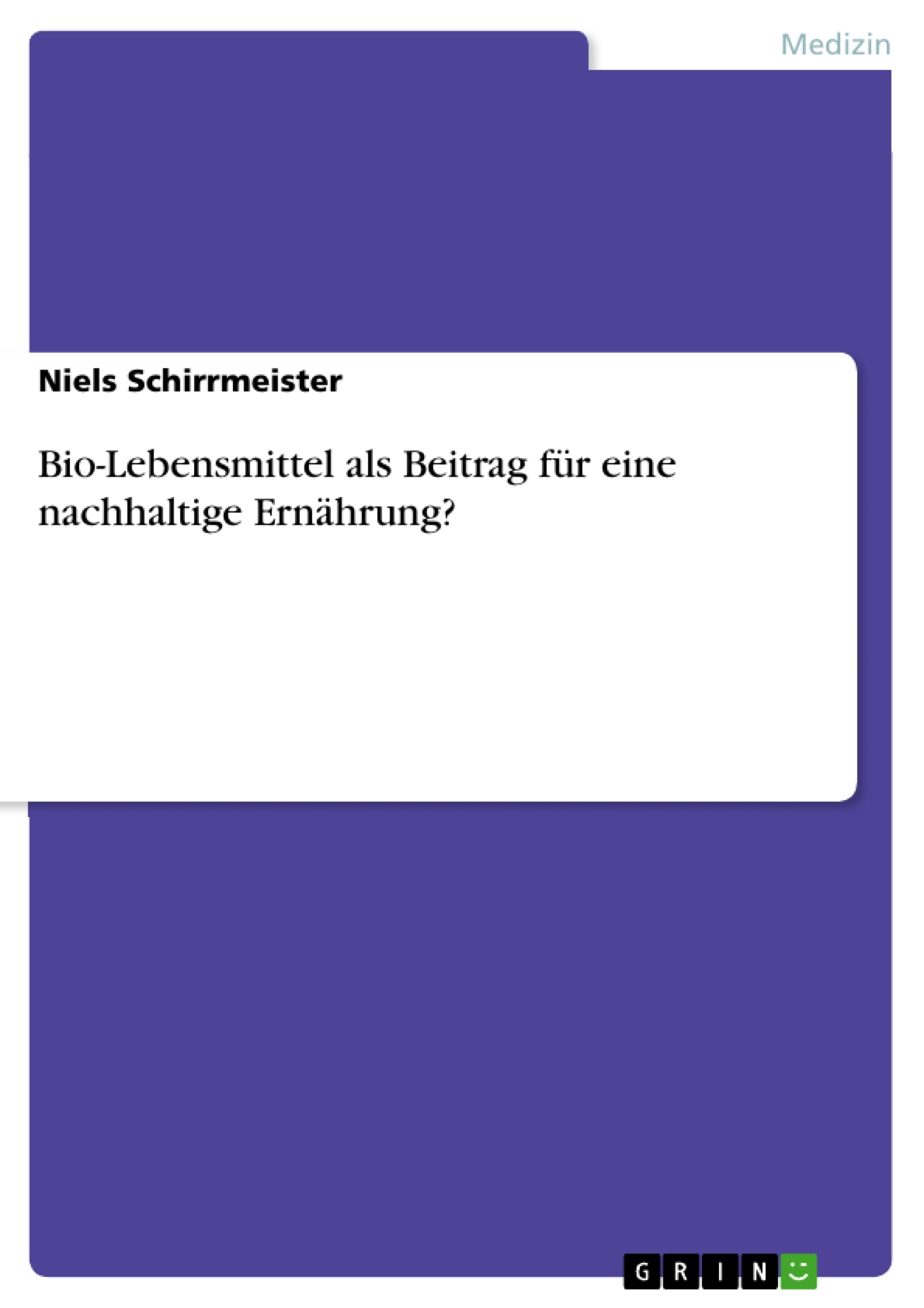Das Ernährungsverhalten der Menschen in den Industrieländern hat sich gewandelt. Ging es noch vor 50 Jahren in vielen Industrieländern um die bloße Ernährungssicherung, so besteht heutzutage ein breites Angebot an Lebensmitteln, das in dieser Vielfalt nie zuvor da gewesen ist. Ermöglicht wird dies durch eine hoch effiziente Landwirtschaft und einer modernen Lebensmittelindustrie. Doch der gestiegene Bedarf an Lebensmitteln kann fast ausschließlich durch Massenproduktion gedeckt werden. Dies hat unkalkulierbare Auswirkungen auf die Natur und den Menschen. Bodenerosion, Trinkwasserbelastung, Pflanzenschutz- und Arzneimittelrückstände, Massentierhaltung, Zentralisierung und Konzentrierung von Betrieben sowie schlechte Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern sind nur einige Folgen der Massenproduktion von Lebensmitteln. Aufgrund der nur schwer abzuschätzenden Langzeitfolgen und der Gefahr, dass zukünftige Generationen diesen Wohlstand nicht mehr ausschöpfen können und des gegenwärtigen Raubbaus an der Natur hat sich das Leitbild einer nachhaltigen Ernährung entwickelt. Dieses Leitbild wird durch verschiedene Modelle erklärt beziehungsweise ergänzt, in dem die positiven Auswirkungen einer nachhaltigen Ernährungsweise beziehungsweise die negativen Folgen der Produktion auf Masse in den verschiedenen Bereichen wie, der Gesellschaft, Natur, Wirtschaft, Politik und des einzelnen Menschen analysiert werden kann.
Spätestens seit der ersten Öko-Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 im Jahre 1991 sind Bio-Lebensmittel fest im europäischen Markt integriert. Dies hat zu zahlreichen wissenschaftlichen Aktivitäten geführt, um die Frage zu beantworten, wodurch sich Bio-Lebensmittel von konventionell hergestellten Lebensmitteln unterscheiden. (Mayer-Miebach, 2010)
Ob Bio-Lebensmittel ernährungsphysiologisch wertvoller sind oder im Sinne des Leitbildes einer nachhaltigen Ernährung ökonomisch, soziale und/oder ökologische Auswirkungen haben, soll in dieser Arbeit anhand eines ausgewählten Modells näher recherchiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen von Bio-Lebensmitteln
- Rechtliche Grundlagen
- Das gesetzliche Bio-Siegel/Logo
- Kontrolle und Zertifizierung
- Die Öko-Anbauverbände
- Ökologischer/biologischer Landbau
- Bio-Lebensmittel verarbeitende Betriebe
- Zum Verständnis des Konzepts der Nachhaltigkeit
- Internationales Konzept der Nachhaltigkeit
- Gesellschaftliche Leitbilder zur Nachhaltigkeit auf nationaler und regionaler Ebene
- Nachhaltige Ernährung und Ernährungsökologie
- Das Modell der vier Dimensionen nachhaltiger Ernährung
- Bio-Lebensmittel unter Betrachtung der vier Dimensionen nachhaltiger Ernährung
- Ökonomische Dimension
- Marktanteile ökologischer Betriebe
- Preisgestaltung und -entwicklung von Lebensmitteln
- Warum sind Bio-Lebensmittel teurer als konventionelle Lebensmittel?
- Regionale/Lokale Vermarktungsnetze für Bio-Lebensmittel
- Gute ökologische Herstellungspraxis
- Gesundheitliche Dimension
- Ernährungsphysiologische Qualität von Bio-Lebensmitteln
- Nitratgehalt
- Mykotoxingehalt
- Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln
- Mikrobiologische Qualität von Fleischerzeugnissen
- Rückstände von Tierarzneimitteln
- Ökologische Dimension
- Beispiele für nachhaltiges Handeln im ökologischen Landbau
- Viren als Pflanzenschutzmittel
- Baculoviren
- Apfelwicklergranulovirus (CpGV)
- Weitere biologische Pflanzenschutzmittel
- Bodenfruchtbarkeit und Düngung
- Fruchtfolge und mechanische Unkrautregulierung
- Biodiversität und Agrobiodiversität
- Ökologische/biologische Tierhaltung
- Emissions-, Ressourcen- und Energieverbrauch
- Soziale Dimension
- Einfluss der Politik auf die Bio-Wirtschaft
- Genetisch veränderte Organismen (GVO)
- Fairer Handel
- Innovative Bio-Betriebe
- Schulbauernhöfe
- Soziale Landwirtschaft (Social Farming)
- Fazit
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Standards für Bio-Lebensmittel
- Die vier Dimensionen nachhaltiger Ernährung (ökonomisch, gesundheitlich, ökologisch, sozial)
- Bewertung von Bio-Lebensmitteln hinsichtlich der Nachhaltigkeitsdimensionen
- Beispiele für nachhaltige Produktions- und Vermarktungsformen im Bio-Bereich
- Die Rolle von Politik und Konsumenten bei der Förderung nachhaltiger Ernährung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Bio-Lebensmittel einen Beitrag zu einer nachhaltigen Ernährung leisten können. Sie untersucht die Bedeutung des Konzepts der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Lebensmittelproduktion und analysiert die Rolle von Bio-Lebensmitteln in diesem Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung in die Thematik und beleuchtet die Herausforderungen im Bereich der Lebensmittelproduktion und -versorgung im Kontext zunehmender globaler Nachfrage. Die folgenden Kapitel befassen sich mit den rechtlichen Grundlagen von Bio-Lebensmitteln, den Standards der ökologischen Produktion und dem Konzept der Nachhaltigkeit im Allgemeinen.
Kapitel 5 stellt das Modell der vier Dimensionen nachhaltiger Ernährung vor, das als analytisches Instrument zur Bewertung von Bio-Lebensmitteln dient. Die Kapitel 6.1 bis 6.4 analysieren die ökonomische, gesundheitliche, ökologische und soziale Dimension von Bio-Lebensmitteln anhand konkreter Beispiele und Studien.
Schlüsselwörter
Bio-Lebensmittel, Nachhaltigkeit, Ernährung, Ökologischer Landbau, Gesundheit, Umwelt, Soziales, Wirtschaft, EU-Öko-Verordnung, Fairer Handel, Biodiversität, Genetisch veränderte Organismen (GVO), Regionale Vermarktung.
- Quote paper
- Niels Schirrmeister (Author), 2013, Bio-Lebensmittel als Beitrag für eine nachhaltige Ernährung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/212629