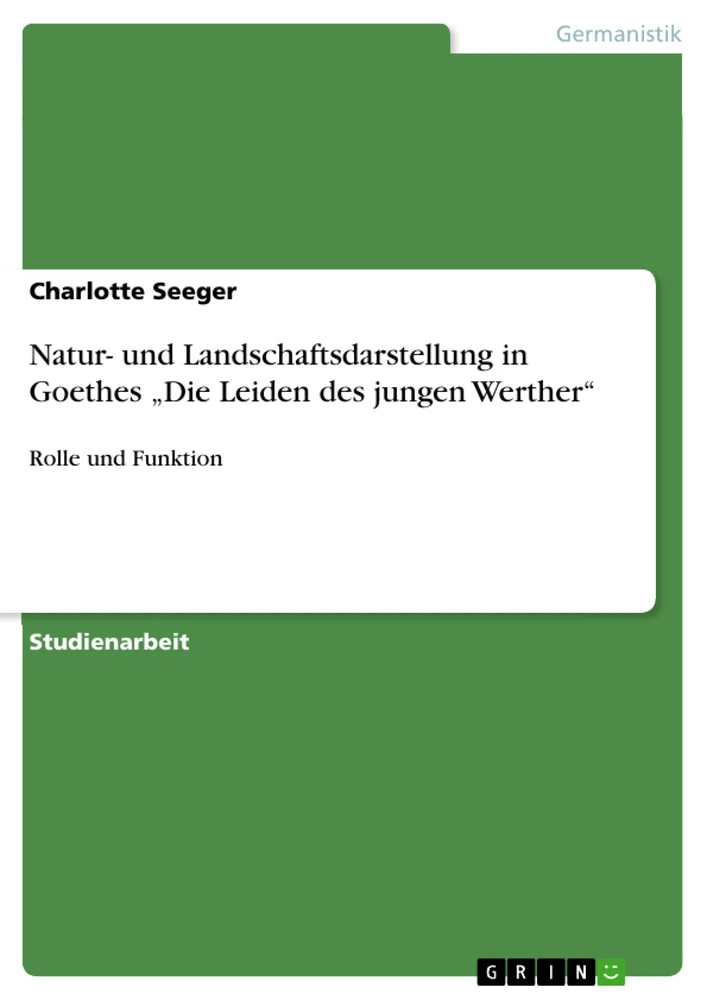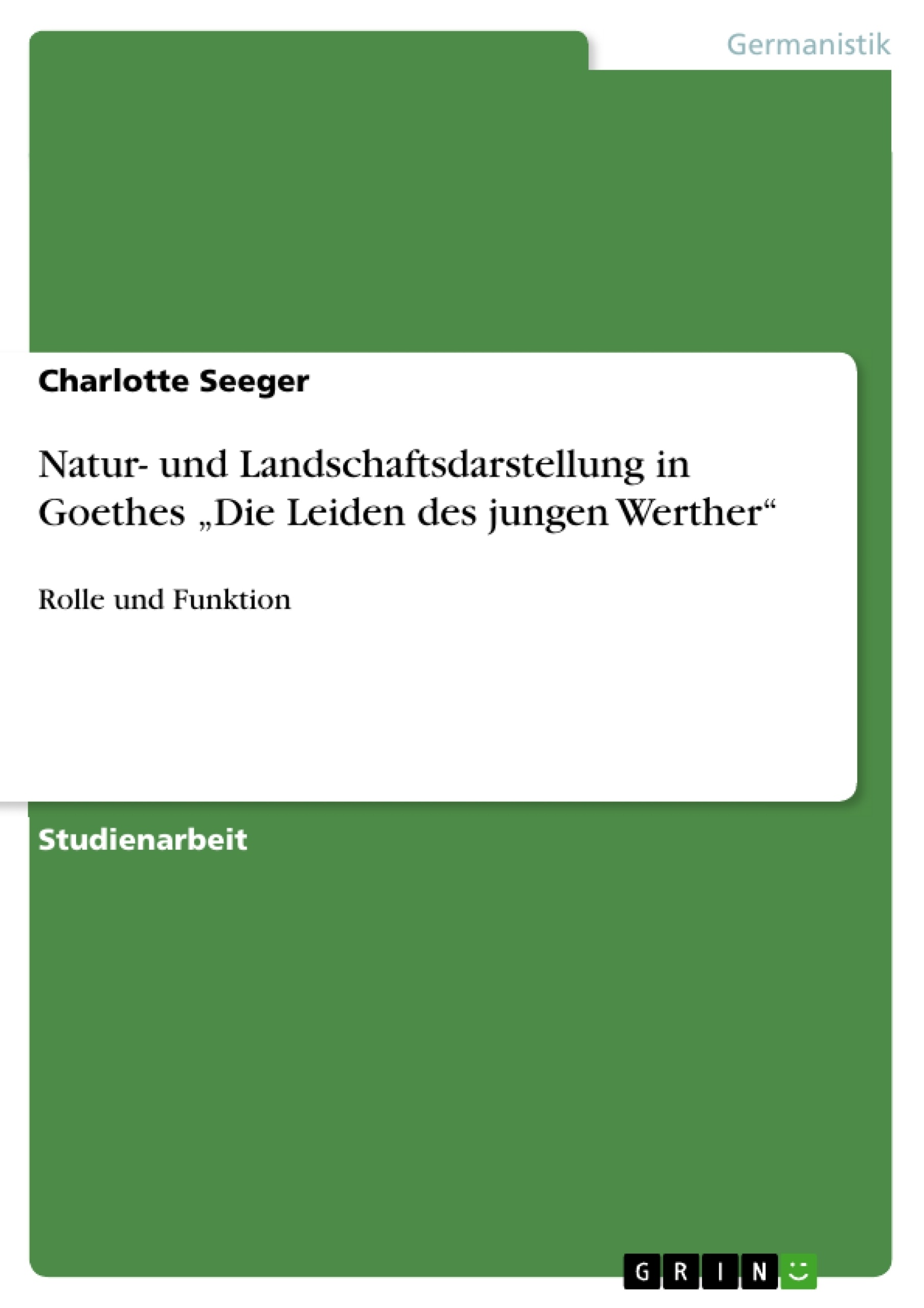Die Rolle der Natur- und Landschaftsbeschreibungen in Goethes „Leiden des jungen Werther“ bildet eines der meist rezipierten Themen innerhalb der Wertherforschung. In der Ambiguität der verschiedenen Natur- und Landschaftsdarstellungen und ihrer Funktion für den Roman liegt das besondere Interesse der Wissenschaft.
Die Art der Natur- und Landschaftsdarstellung im 18. Jahrhundert ist stark abhängig von den verschiedenen literarischen und geistesgeschichtlichen Strömungen zur Wertherzeit. Diese bewirken stark schwankende Einstellungen bezüglich der ästhetischen Funktion der Natur im literarischen Werk. Während noch in der Barockzeit und der ihr nachfolgenden Aufklärung, die Natur lediglich als vom Menschen zu beherrschende und zu zähmende Naturgewalt , sowie als allegorisch-moralische Verschlüsselung einer tatsächlichen Realität, kommt mit einer sich langsam entwickelnden empfindsamen Geisteshaltung ein verändertes Naturgefühl auf.
Das Naturbild bekommt somit eine gänzlich eigene Bedeutung und bleibt frei von belehrenden Absichten. Mit der empfindsamen Lyrik von Friedrich Gottlieb Klopstock erfährt die Natur eine regelrechte Beseelung, die in einer pietistisch-pantheistischen Naturnähe gipfelt. Es entwickelt sich eine Naturästhetik, die auch den jungen Goethe inspiriert. Ihm wird bewusst, dass die Natur neben Grausamkeiten auch viele Schönheiten in sich birgt, eine Ambivalenz, die er schließlich auch in seinen Werken vermittelt.
Thema der Arbeit soll die Funktion der Natur- und Landschaftsbeschreibungen in Goethes „Leiden des jungen Werthers“ sein, mit dem Ziel die Rolle der Natur für den Handlungsverlauf und die Charakterisierung Werthers herauszuarbeiten. Zunächst soll die Ambivalenz der Naturbeschreibungen analysiert werden und im Anschluss die wichtigsten Parallelisierungen zwischen der Natur und Werthers Lebensverlauf. Letztlich soll die Wichtigkeit der Natur- und Landschaftsdarstellungen für den inneren und äußeren Verlauf des Romans herausgestellt und die Signifikanz dieser für die Deutung der Wertherfigur bewiesen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ambivalenz der Natur- und Landschaftsbeschreibungen
- Der Brief vom 10. Mai 1771
- Der Brief vom 18. August 1771
- Briefe vom 3. November und 12. Dezember 1772
- Parallelisierungen des werther'schen Seelenzustands
- Die Jahres- und Tageszeiten
- Homer und Ossian
- Die Nussbäume im Pfarrersgarten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Funktion von Natur- und Landschaftsbeschreibungen in Goethes „Leiden des jungen Werthers“. Ziel ist es, die Rolle der Natur für den Handlungsverlauf und die Charakterisierung Werthers zu untersuchen.
- Die Ambivalenz der Naturbeschreibungen
- Die Parallelisierung der Natur mit Werthers Seelenzuständen
- Die Signifikanz der Naturdarstellung für die Deutung der Wertherfigur
- Die Bedeutung der Natur für den inneren und äußeren Verlauf des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Ambivalenz der Naturbeschreibungen. Anhand ausgewählter Briefe wird gezeigt, wie die Natur einerseits Ruhe und Zufriedenheit, andererseits jedoch auch Qual und Unruhe symbolisieren kann. So wird im Brief vom 10. Mai Werthers Freude über die Natur und seine Sehnsucht nach Vollkommenheit dargestellt. Der Brief vom 18. August zeigt jedoch, wie Werthers positive Naturerfahrungen durch sein Leid verstärkt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Naturdarstellung, Empfindsamkeit, Seelenzustand, Ambivalenz, Landschaftsbeschreibung und Charakterisierung im Kontext von Goethes „Leiden des jungen Werthers“. Insbesondere werden die literarischen und geistesgeschichtlichen Strömungen der Wertherzeit, wie die Aufklärung und die Empfindsamkeit, beleuchtet.
- Quote paper
- Charlotte Seeger (Author), 2011, Natur- und Landschaftsdarstellung in Goethes „Die Leiden des jungen Werther“, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/212350