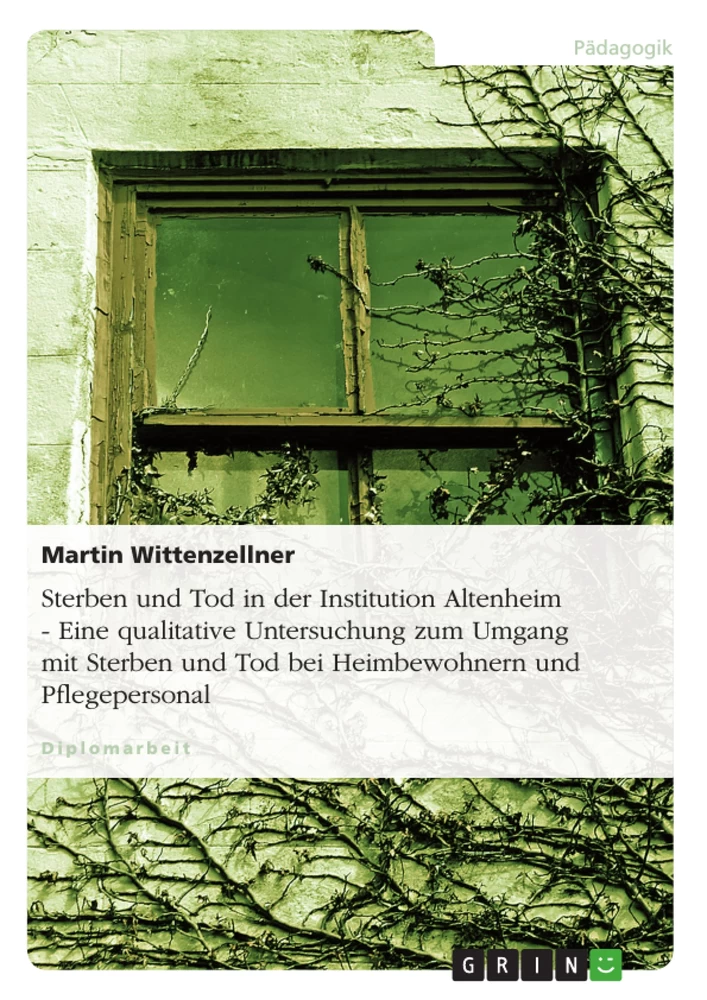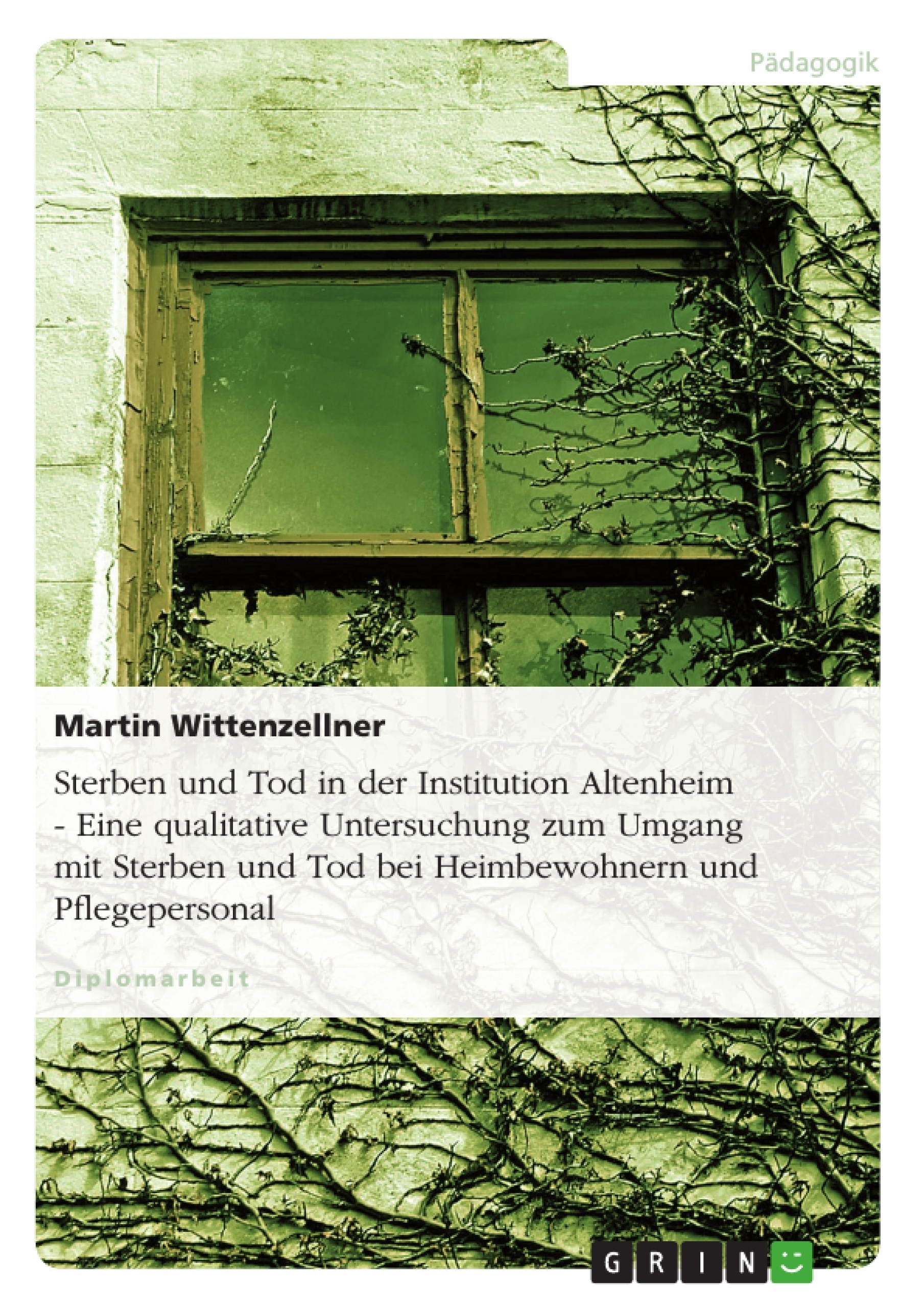Die Tatsache, dass die Versorgung Sterbender in enormem Maße an den Anstrengungen des institutionellen Personals ausgerichtet ist, führt häufig zu Problemen. Nicht nur die unzureichenden Rahmenbedingungen wie Personalknappheit und damit einherschreitender Zeitmangel, sondern auch Unsicherheiten seitens der Angehörigen und der professionellen Helfer erschweren die Situation im Altenheim (vgl. ZWETTLER 2001).
So hat sich der Personalschlüssel in den Altenheimen in den letzten Jahren zwar erhöht, ein Optimum wurde dadurch jedoch noch nicht erreicht. In Zeiten leerer Kassen scheint dieses Problem beinahe unlösbar. Vergessen werden sollte aber nicht, dass es nicht nur um die ältere Generation in der Gesellschaft geht, sondern auch um unsere Zukunft.
Häufig, so auch die Meinung von Kostrzewa und Kutzner (2002), stehen die professionellen Pfleger, die sich beruflich mit Sterben und Tod auseinandersetzen müssen, nicht nur unter Zeitdruck, sondern sind auch unzureichend vorbereitet. Die Folge sind, wie erwähnt, Unsicherheit und ebenso Angst in Bezug auf die Richtigkeit des eigenen Handelns und Verhaltens, auch im Gespräch mit Sterbenden.
Das pädagogische Anliegen dieser Arbeit ist es, diese Ängste und Unsicherheiten des Personals zu beleuchten und Vorschläge zu deren Behebung vorzubringen, damit die Belastungen für Pflegende und Sterbende vermindert werden können. In diesem Zusammenhang soll auch erforscht werden, welche Wünsche die Bewohner eines Altenheims haben und welche Ängste sie vor dem Sterben hegen.
Die Arbeit hat keinesfalls das Anliegen, eine ideale Art des Sterbens zu propagieren, allenfalls will sie unterstreichen, dass der Mensch im Sterben ein Recht auf Autonomie und Respekt besitzt. Auch wenn es das eigene Sterben im Sinne einer freien, individuellen Selbstbestimmung freilich nicht geben kann, so kann aber dem Recht des einzelnen nachgekommen werden, sein Sterben so weit wie nur irgend möglich selbst zu gestalten. Dies bietet im Altenheim die Chance, einerseits den Bewohnern eine positive Perspektive und den Sterbenden einen würdevollen Tod zu geben, andrerseits ermöglicht es den Pflegenden eine zufriedenstellende Sterbebetreuung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufbau der Arbeit
- 3. Tod und Sterben
- 3.1 Begriffliche Definitionen
- 3.2 Der Wandel im Umgang mit Sterbenden
- 4. Die Institution Altenheim als Sterbeort
- 4.1 Gründe für die Ausgliederung des Sterbens aus dem familiären Bereich in den Altenhilfebereich
- 4.2 Die Altenhilfeeinrichtungen in Deutschland
- 4.3 Die Institutionalisierung alter Menschen in Heimen
- 5. Sterbeverlauf und Bedürfnisstruktur Sterbender
- 5.1 Problemverständnis und Prozessverlauf beim Sterben
- 5.2 Bedürfnisse und Modelle der Bedürfnisbefriedigung von Sterbenden
- 6. Das Konfliktfeld Sterben und Institution
- 6.1 Institutionelle Vorgaben
- 6.2 Perspektive der Bewohner
- 6.3 Perspektive des Personals
- 7. Zusammenfassung des Theorieteils
- 8. Fragestellungen
- 9. Methodenteil
- 10. Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Mitarbeiterinterviews
- 11. Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Bewohnerinterviews
- 12. Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Umgang mit Sterben und Tod in Altenheimen aus der Perspektive der Bewohner und des Pflegepersonals. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Situation zu zeichnen und potentielle Konfliktfelder und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
- Der Wandel im Umgang mit Tod und Sterben im Laufe der Geschichte.
- Die Institution Altenheim als spezifischer Ort des Sterbens und die damit verbundenen Herausforderungen.
- Die Bedürfnisse Sterbender und die Möglichkeiten ihrer Bedürfnisbefriedigung.
- Konflikte zwischen institutionellen Vorgaben, den Bedürfnissen der Bewohner und den Erfahrungen des Personals.
- Belastungen und Ressourcen für das Pflegepersonal im Umgang mit Sterben und Tod.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Diplomarbeit ein, beschreibt die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodische Vorgehensweise.
3. Tod und Sterben: Dieses Kapitel beleuchtet den Tod und das Sterben aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Es liefert begriffliche Definitionen von Tod und Sterben, und diskutiert den Wandel im Umgang mit Sterbenden, von mittelalterlichen Vorstellungen bis zur modernen Verdrängung des Todes. Die Bedeutung von Würde im Sterbeprozess wird hervorgehoben.
4. Die Institution Altenheim als Sterbeort: Dieses Kapitel analysiert das Altenheim als Ort des Sterbens. Es untersucht die Gründe für die Verlagerung des Sterbens aus dem häuslichen Bereich in die Altenhilfe, beschreibt die Strukturmerkmale deutscher Altenheime (Bewohner- und Personalstruktur, Pflegequalität) und analysiert das Altenheim als „totale Institution“ nach Goffman.
5. Sterbeverlauf und Bedürfnisstruktur Sterbender: Dieses Kapitel beschreibt unterschiedliche Modelle des Sterbeverlaufs (Glaser & Strauss, Kübler-Ross, Kruse) und analysiert die Bedürfnisse Sterbender. Es stellt Hospizwesen und Palliativmedizin als Modelle der Bedürfnisorientierung vor.
6. Das Konfliktfeld Sterben und Institution: Hier werden die Spannungsfelder zwischen institutionellen Vorgaben, den Bedürfnissen der Bewohner und den Perspektiven des Personals beleuchtet. Es werden die Herausforderungen des Umgangs mit Sterben und Tod im institutionellen Kontext detailliert dargestellt.
Schlüsselwörter
Sterben, Tod, Altenheim, Pflegepersonal, Bewohner, Bedürfnisse Sterbender, Palliativmedizin, Hospiz, Institutionelle Vorgaben, Konflikte, Belastungen, qualitative Forschung, Inhaltsanalyse, Würde.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Umgang mit Sterben und Tod in Altenheimen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht den Umgang mit Sterben und Tod in Altenheimen aus der Perspektive der Bewohner und des Pflegepersonals. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Situation zu zeichnen und potentielle Konfliktfelder und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel im Umgang mit Tod und Sterben, die Institution Altenheim als spezifischer Ort des Sterbens, die Bedürfnisse Sterbender und Möglichkeiten ihrer Bedürfnisbefriedigung, Konflikte zwischen institutionellen Vorgaben, den Bedürfnissen der Bewohner und den Erfahrungen des Personals sowie Belastungen und Ressourcen für das Pflegepersonal.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, beginnend mit einer Einleitung und einem Überblick über den Aufbau. Weitere Kapitel befassen sich mit Tod und Sterben, dem Altenheim als Sterbeort, dem Sterbeverlauf und den Bedürfnissen Sterbender, dem Konfliktfeld Sterben und Institution, einer Zusammenfassung des Theorieteils, der Methodik, den Ergebnissen der Inhaltsanalysen von Mitarbeiter- und Bewohnerinterviews sowie einer abschließenden Diskussion der Ergebnisse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Darstellung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Die Kapitel selbst untersuchen den Wandel im Umgang mit Tod und Sterben, die Institution Altenheim als Ort des Sterbens, die Bedürfnisse Sterbender und die Konflikte zwischen institutionellen Vorgaben und den Bedürfnissen der Beteiligten.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet qualitative Forschungsmethoden, insbesondere die Inhaltsanalyse von Mitarbeiter- und Bewohnerinterviews. Dies ermöglicht eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den Perspektiven der verschiedenen Akteure.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sterben, Tod, Altenheim, Pflegepersonal, Bewohner, Bedürfnisse Sterbender, Palliativmedizin, Hospiz, Institutionelle Vorgaben, Konflikte, Belastungen, qualitative Forschung, Inhaltsanalyse, Würde.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die genaue Forschungsfrage wird in der Einleitung der Arbeit formuliert. Der Fokus liegt jedoch auf der umfassenden Untersuchung des Umgangs mit Sterben und Tod in Altenheimen und der Identifizierung von Konfliktfeldern und Verbesserungspotenzialen.
Welche theoretischen Modelle werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Modelle des Sterbeverlaufs (z.B. Glaser & Strauss, Kübler-Ross, Kruse) und analysiert die Bedürfnisse Sterbender im Kontext von Hospizwesen und Palliativmedizin. Das Konzept der „totalen Institution“ nach Goffman wird im Zusammenhang mit dem Altenheim diskutiert.
- Arbeit zitieren
- Martin Wittenzellner (Autor:in), 2003, Sterben und Tod in der Institution Altenheim - Eine qualitative Untersuchung zum Umgang mit Sterben und Tod bei Heimbewohnern und Pflegepersonal, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/21197