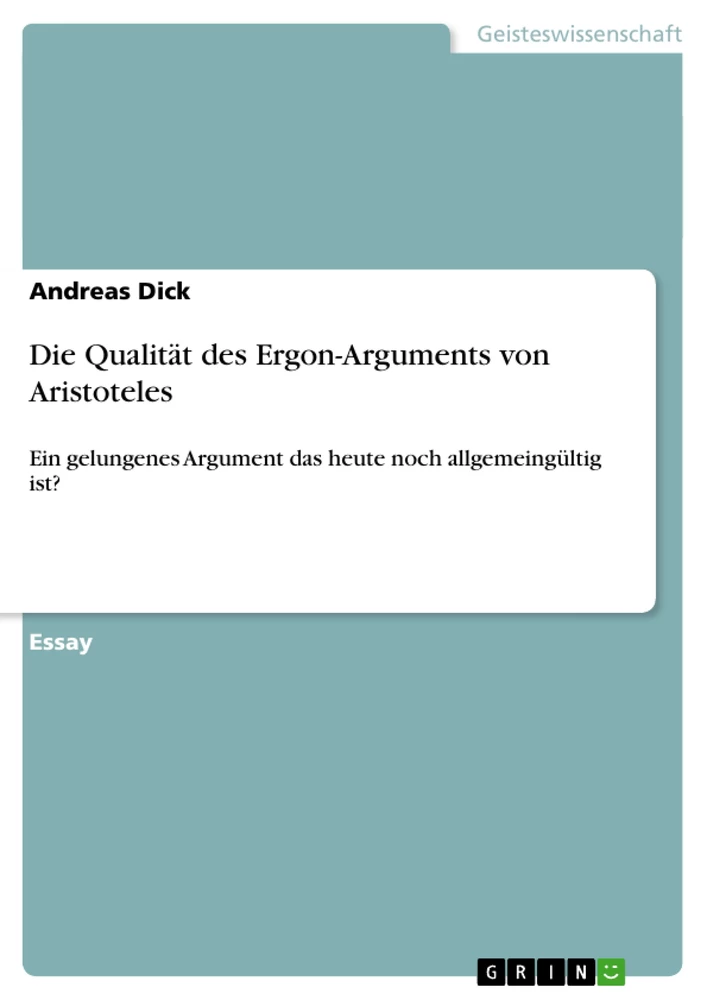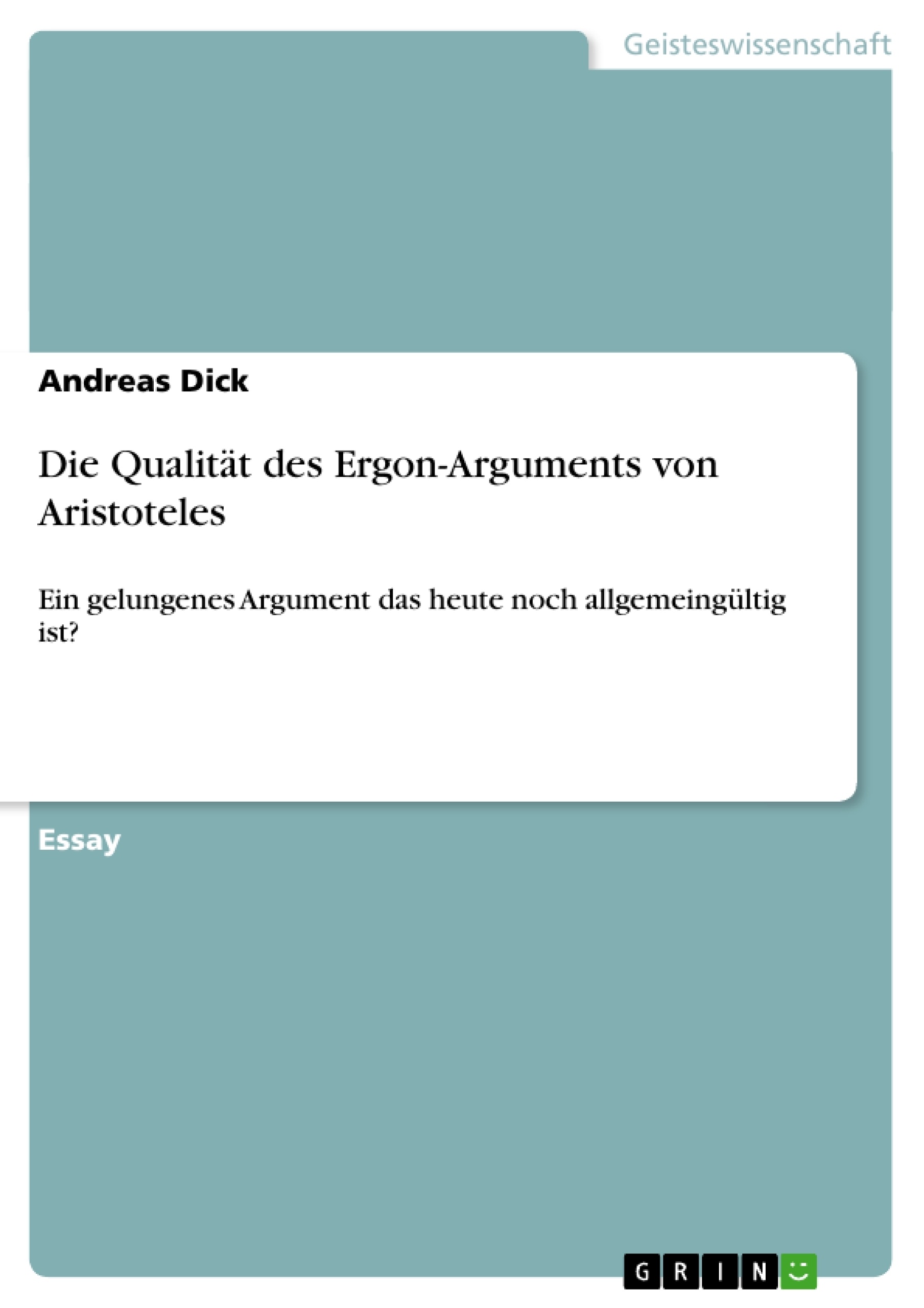In dem vorliegenden Essay soll eingangs aufgezeigt werden, wie Aristoteles in seinem Ergon-Argument vorgeht, um anschließend die Frage zu klären, ob und inwiefern das Argument ein nachvollziehbares und gelungenes Argument ist, oder ob es vielmehr ein Gedankenexperiment darstellt, dass auf keine klare Konklusion kommt. Am Ende soll die Frage aufgeworfen werden, wie nach Aristoteles mit Menschen mit geistiger Behinderung umzugehen ist. Sind diese, Menschen im definierten Sinne oder etwas anderes, dass von der Definition ausgeschlossen wird?
Am Anfang der Nikomachischen Ethik kommt Aristoteles auf den Schluss, dass auch der Mensch eine Funktion oder Aufgabe, also dass „Ergon“ hat, welches dazu dient ein gutes Leben im Sinne von einem tätigen Leben zu führen. Er versucht zu „erfassen, welches die dem Menschen eigentümliche Leistung ist.“ Dabei fängt er mit der grundsätzlichen Idee an, dass wenn der Flötenkünstler, der Bildhauer wie auch jeder Handwerker und Künstler seine Funktion daran festmacht, dass seine Arbeiten gut und wohlgelungen sein sollen, oder aber Körperteile wie die Augen, die Hände und Füße eine Funktion für den Menschen haben, so muss doch auch der Mensch an sich eine erweiterte Funktion haben, nach der er versucht sein Leben zu gestalten. Im Anschluss versucht Aristoteles dass zu bestimmen, was nur dem menschlichen Leben Eigen ist und versucht zuerst diejenigen Dinge auszuschließen, die der Mensch zum Beispiel, mit den Tieren und den Pflanzen gemein hat. In seiner Argumentationsstruktur trennt er schnell und klar die vegetative, die tierische und die rationale Seele voneinander ab. Hier kommt er auf den Schluss, dass das Leben des Sich-Ernährens und Wachsens nicht nur für den Menschen gilt, sondern auch für die Pflanzen sowie die Tiere. Das Leben der Wahrnehmung ist dem Menschen allerdings auch mit den Tieren eigen, so muss es also noch eine weitere Instanz geben, die den Menschen klar von den Tieren und den Pflanzen abtrennt, also die rationale Seele. Für den Menschen „bleibt schließlich nur das Leben als Wirken des rationalen Seelenteils.“
Das Ergon-Argument – Ein gelungenes Argument und heute noch Allgemeingültig?
In dem vorliegenden Essay soll eingangs aufgezeigt werden, wie Aristoteles in seinem Ergon-Argument vorgeht, um anschließend die Frage zu klären, ob und inwiefern das Argument ein nachvollziehbares und gelungenes Argument ist, oder ob es vielmehr ein Gedankenexperiment darstellt, dass auf keine klare Konklusion kommt. Am Ende soll die Frage aufgeworfen werden, wie nach Aristoteles mit Menschen mit geistiger Behinderung umzugehen ist. Sind diese, Menschen im definierten Sinne oder etwas anderes, dass von der Definition ausgeschlossen wird?
Am Anfang der Nikomachischen Ethik kommt Aristoteles auf den Schluss, dass auch der Mensch eine Funktion oder Aufgabe, also dass „Ergon“ hat, welches dazu dient ein gutes Leben im Sinne von einem tätigen Leben zu führen. Er versucht zu „erfassen, welches die dem Menschen eigentümliche Leistung ist.“[1] Dabei fängt er mit der grundsätzlichen Idee an, dass wenn der Flötenkünstler, der Bildhauer wie auch jeder Handwerker und Künstler seine Funktion daran festmacht, dass seine Arbeiten gut und wohlgelungen sein sollen, oder aber Körperteile wie die Augen, die Hände und Füße eine Funktion für den Menschen haben, so muss doch auch der Mensch an sich eine erweiterte Funktion haben, nach der er versucht sein Leben zu gestalten.[2] Im Anschluss versucht Aristoteles dass zu bestimmen, was nur dem menschlichen Leben Eigen ist und versucht zuerst diejenigen Dinge auszuschließen, die der Mensch zum Beispiel, mit den Tieren und den Pflanzen gemein hat. In seiner Argumentationsstruktur trennt er schnell und klar die vegetative, die tierische und die rationale Seele voneinander ab. Hier kommt er auf den Schluss, dass das Leben des Sich-Ernährens und Wachsens nicht nur für den Menschen gilt, sondern auch für die Pflanzen sowie die Tiere. Das Leben der Wahrnehmung ist dem Menschen allerdings auch mit den Tieren eigen, so muss es also noch eine weitere Instanz geben, die den Menschen klar von den Tieren und den Pflanzen abtrennt, also die rationale Seele. Für den Menschen „bleibt schließlich nur das Leben als Wirken des rationalen Seelenteils.“[3]
So kann man in der Argumentationsstruktur von Aristoteles einen Fehler vermuten. Er setzt verschiedene Begriffe von „Funktionen“ voraussetzt, die man aber im Allgemeinen nicht direkt und unmittelbar miteinander vergleichen kann. So bezieht er sich zum Beispiel auf die Funktion eines Handwerkers, dessen Funktion darin besteht, dass er seine berufliche Tätigkeit auch auf gute Weise erledigt. Ein anderes Beispiel ist die Funktion der Organe, so ist die Funktion des Auges, klar zu sehen und so die Umwelt optisch für den Menschen wahrzunehmen. Kann man nun die Grundlegende Aufgabe eines Handwerkers mit der biologischen Funktion der Augen vergleichen? Ist es legitim, von dem einen auf das jeweils andere zu schließen und zu Behaupten, dass wenn das eine, eine Funktion hat, so auch das andere? Hinzu kommt, dass Aristoteles noch einen Schritt weiter geht und aus den beiden genannten Beispielen ein drittes zu folgern versucht. So behauptet er, wenn es eine Funktion der Arbeit des Handwerkers und eine Funktion des Auges gibt, so müsse doch auch der Mensch an sich eine übergeordnete Funktion haben. Hier macht Aristoteles einen pars pro toto Fehlschluss. Er schließt also von einem Teil des Ganzen auf das Ganze selbst. Dies mag in vielen denkbaren Szenarien ein möglicher induktiver Schluss sein, jedoch führt diese Argumentationsstruktur schnell zu einem Widerspruch oder einer falschen Aussage. Ein Beispiel für einen klaren induktiven pars pro toto Fehlschluss wäre zum Beispiel wenn man von der Aussage „ein Dackel ist ein Hund“ darauf schließen würde, dass „Alle Hunde Dackel sind“. Wie hier klar wird, kommt man durch dieses Argument schnell in die Bredouille genau das Falsche auszusagen, was vorher nicht einmal ansatzweise intendiert war.
[...]
[1] [1097b 12-34]
[2] Vgl. [1097b 12-34]
[3] [1097b 34 1098a 17]
- Quote paper
- Andreas Dick (Author), 2012, Die Qualität des Ergon-Arguments von Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/211485