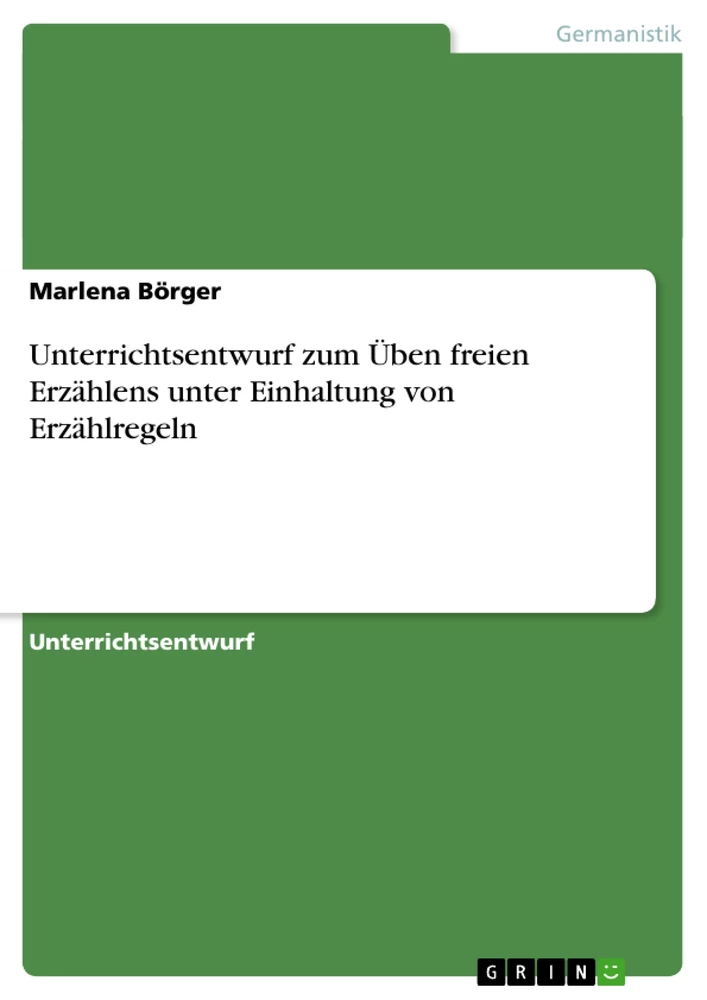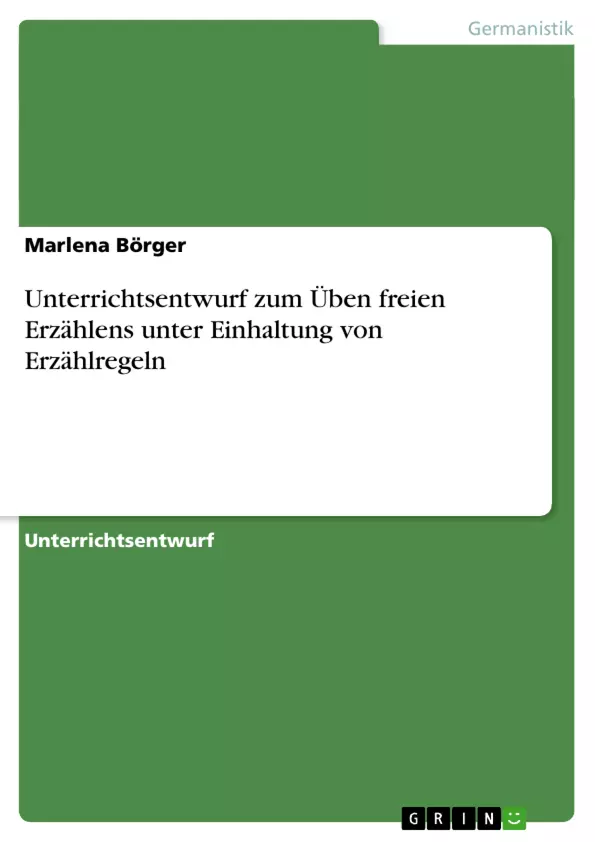1. Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe
1. Sequenz: Einführungsstunde in das Thema Lügengeschichten
• Die Kinder aktivieren ihr Vorwissen, indem sie Antworten auf die Frage „Woher kommen Geschichten“ sammeln.
• Wir lernen den Lügenbaron von Münchhausen kennen.
2. Sequenz: Wir lernen Reihum-Geschichten kennen
• Die Kinder sammeln durch Reihum-Geschichten erste bewusste Erfahrungen mit dem Erzählen von Geschichten, indem sie in Gruppenarbeit eigene Reihum-Geschichten erzählen und dabei an das Erzählte des Vorredners anknüpfen und somit die Geschichte weiter erzählen.
• Gruppenarbeit: Was macht gutes Erzählen und gutes Zuhören aus?
3. Sequenz: Wir lernen die Form von Lügengeschichten kennen und überlegen uns eigene Lügen
• Die Kinder sollen sich zur Einstimmung auf das Thema eigene Lügen überlegen, diese schriftlich notieren und vortragen.
• Die eigenen Lügen dienen für die Weiterarbeit als Ideenschatz für eigene Lügengeschichten.
4. Sequenz: Wir lernen eine Geschichte vom Lügenbaron kennen und lernen die
Erzählung mithilfe von Stichwortkärtchen und des „roten Fadens“ zu strukturieren
• Festhalten der am Vortag erarbeiteten Erzähl- und Zuhörregeln
• Die Kinder hören die Geschichte „Mein Ritt auf der Kanonenkugel“, arbeiten Schlüsselbegriffe heraus, halten diese auf Stichwortkärtchen fest und strukturieren sie mithilfe des „roten Fadens“.
5. Sequenz: Wir lernen die Geschichte „Mein Ritt auf der Kanonenkugel“ mithilfe der Stichwortkärtchen und des „roten Fadens“ nachzuerzählen
• Die Kinder üben unter Einbeziehung der Erzähl- und Zuhörregeln das strukturierte Nacherzählen der Geschichte und erhalten erste Rückmeldungen zu ihrer Geschichte.
6. Sequenz: Wir erfinden und erzählen eigene Lügengeschichten
7. Sequenz: Wir erzählen weitere Geschichten in unserer Erzählrunde
1. Einordnung der Stunde in die Unterrichtsreihe
1. Sequenz: Einführungsstunde in das Thema Lügengeschichten
- Die Kinder aktivieren ihr Vorwissen, indem sie Antworten auf die Frage „Woher kommen Geschichten“ sammeln.
- Wir lernen den Lügenbaron von Münchhausen kennen.
2. Sequenz: Wir lernen Reihum-Geschichten kennen
- Die Kinder sammeln durch Reihum-Geschichten erste bewusste Erfahrungen mit dem Erzählen von Geschichten, indem sie in Gruppenarbeit eigene Reihum-Geschichten erzählen und dabei an das Erzählte des Vorredners anknüpfen und somit die Geschichte weiter erzählen.
- Gruppenarbeit: Was macht gutes Erzählen und gutes Zuhören aus?
3. Sequenz: Wir lernen die Form von Lügengeschichten kennen und überlegen uns eigene Lügen
- Die Kinder sollen sich zur Einstimmung auf das Thema eigene Lügen überlegen, diese schriftlich notieren und vortragen.
- Die eigenen Lügen dienen für die Weiterarbeit als Ideenschatz für eigene Lügengeschichten.
4. Sequenz: Wir lernen eine Geschichte vom Lügenbaron kennen und lernen die Erzählung mithilfe von Stichwortkärtchen und des „roten Fadens“ zu strukturieren
- Festhalten der am Vortag erarbeiteten Erzähl- und Zuhörregeln
- Die Kinder hören die Geschichte „Mein Ritt auf der Kanonenkugel“, arbeiten Schlüsselbegriffe heraus, halten diese auf Stichwortkärtchen fest und strukturieren sie mithilfe des „roten Fadens“.
5. Sequenz: Wir lernen die Geschichte „Mein Ritt auf der Kanonenkugel“ mithilfe der Stichwortkärtchen und des „roten Fadens“ nachzuerzählen
- Die Kinder üben unter Einbeziehung der Erzähl- und Zuhörregeln das strukturierte Nacherzählen der Geschichte und erhalten erste Rückmeldungen zu ihrer Geschichte.
6. Sequenz: Wir erfinden und erzählen eigene Lügengeschichten
7. Sequenz: Wir erzählen weitere Geschichten in unserer Erzählrunde
2. Lernziele
2.1 Schwerpunktziel der Unterrichtsstunde
Die Kinder üben das freie Erzählen unter Einhaltung von Erzählregeln, indem sie eigene Lügengeschichten erfinden, diese erzählen und dazu Rückmeldungen erhalten.
2.2 Lernchancen der Unterrichtsstunde
Sachkompetenz
In der heutigen Unterrichtsstunde haben die Kinder die Möglichkeit, sachkompetenter zu werden, indem sie
- am Gespräch (Einstieg und Reflexion) sachbezogen teilnehmen.
Indikatoren: die Kinder sprechen frei, verständlich und in ganzen Sätzen; sie sprechen zum Thema; sie bringen ihr Vorwissen ein; sie bringen neue Aspekte ein und wiederholen das zuvor Gesagte nicht
- den Arbeitsauftrag verstehen und umsetzen.
Indikatoren: die Kinder überlegen sich eine eigene Lügengeschichte, indem sie sie mithilfe von Stichwortkärtchen und dem „roten Faden“ strukturieren und anschließend einem Partner vorstellen
- ihre Erzählkompetenz erweitern, indem sie ihre Geschichten erzählen.
Indikatoren: die Kinder erzählen sich in Partnerarbeit ihre Lügengeschichte und erhalten Rückmeldungen
Sozialkompetenz
In der heutigen Unterrichtsstunde haben die Kinder die Möglichkeit, sozialkompetenter zu werden, indem sie
- ihr Gesprächsverhalten schulen und gemeinsam in der Klasse reflektieren.
Indikatoren: die Kinder hören sich im Kreis und im Plenum gegenseitig zu; sie lassen sich gegenseitig ausreden; sie melden sich und rufen nicht in die Klasse; es wird ein freundlicher Ton verwendet
- soziale und kooperative Verhaltensweisen stärken und weiter ausbauen.
Indikator: die Kinder suchen sich mithilfe des Klammersystems einen Partner und erzählen sich gegenseitig ihre Lügengeschichten
Selbstkompetenz
In der heutigen Unterrichtsstunde haben die Kinder die Möglichkeit, selbstkompetenter zu werden, indem sie
- Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen.
Indikatoren: die Kinder überlegen sich eigenständig ihre Lügengeschichte und kennen die Vorgehensweise
- Anerkennung erfahren.
Indikatoren: jedes Kind erzählt seinen Fähigkeiten entsprechend die eigene Lügengeschichte; durch das Erzählen in der Partnerarbeit und der Präsentationsphase wird die Arbeit der Kinder gewürdigt; in der Reflexion erfüllt jedes Kind eine wichtige Rolle, indem es dem Erzähler Rückmeldungen gibt
3. Lernvoraussetzungen
3.1 Allgemeine Voraussetzungen des Lern- und Arbeitsverhaltens
Lerngruppe
Die Klasse besteht aus 28 Kindern, 13 Mädchen und 15 Jungen. Hiervon sind sieben Kinder türkischer, zwei mazedonischer und jeweils eines tamilischer, polnischer, portugiesischer und italienischer Herkunft. Z. und S. haben grammatikalische Schwierigkeiten und leichte sprachliche Probleme.
Die Klasse ist eine heterogene und aktive Lerngruppe, in der das Leistungsspektrum weit auseinander geht. Einige Kinder leben in schwierigen häuslichen Verhältnissen und haben mit familiären Problemen zu kämpfen.
Arbeitshaltung
Die Klasse steht dem Deutschunterricht aufgeschlossen gegenüber und es herrscht meist ein positives Lernklima in der Klasse. Die Kinder können konzentriert arbeiten, manche neigen aber gelegentlich zur Unaufmerksamkeit. Der Umgang untereinander ist weitestgehend positiv und durch gegenseitige Hilfe geprägt. Die Einhaltung der aufgestellten Klassenregeln fällt einigen Kindern noch schwer. Offene Arbeitsformen, wie Frei-, Werkstatt- und Projektarbeit, sind den Kindern vertraut. Die Kinder kennen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit und arbeiten gerne mit einem Partner oder in kleinen Gruppen zusammen. Sie verhalten sich meist kooperativ und hilfsbereit.
Kenntnis- und Entwicklungsstand
Seit Beginn ihrer Schulzeit erzählen die Kinder besonders im Erzählkreis gerne vom Wochenende. Einige wenige trauen sich jedoch selten, vor der gesamten Klasse Erzählbeiträge zu leisten.
Die Kinder kennen schriftliche Erzählungen. Sie wissen, dass ein Text durch eine Einleitung, zusammenhängende Ereignisfolgen sowie einem Schluss gekennzeichnet ist.
Das freie Geschichtenerzählen hingegen ist ihnen noch fremd und wird im Rahmen dieser Unterrichtseinheit eingeführt.
Vorerfahrungen im Hinblick auf die verwendeten Methoden
Seit der Mitte des ersten Schuljahres ist den Kindern bekannt, verschiedene Beiträge (z.B. Geschichten, Lernplakate) hinsichtlich Inhalt und Verbesserungstipps zu reflektieren.
Die Methode des Strukturierens mithilfe des „roten Fadens“ wird im Rahmen dieser Unterrichtseinheit mit den Kindern erarbeitet.
3.2 Individuelle Lernvoraussetzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Begründungszusammenhang und Überlegungen zur Sache
4.1 Begründung der Thematik
Durch die Lügengeschichten des Barons von Münchhausen haben die Kinder die Möglichkeit, sich mit dessen Charakter und seinen Handlungsweisen auseinanderzusetzen. Der Bezug zum Lügenbaron fördert die Motivation der Kinder, eigene Lügengeschichten zu erfinden.
Das Erzählen wird besonders gefördert, wenn man Kindern die Möglichkeit gibt, die Erfahrung zu machen, dass andere ihnen zuhören und sie die Aufmerksamkeit und die erzählbedingte Zuwendung anderer spüren (Claussen 2004, S. 7). Jemand, der gut fabulieren kann, erzielt damit eine positive Wirkung bei seinen Zuhörern, was sich wiederum stimulierend und motivierend für die Weiterentwicklung der Erzählfähigkeit auswirkt (vgl. Steinig/ Huneke 2004, S. 66).
4.2 Überlegungen zur Sache
„In der kommunikativen Deutschdidaktik hatte das mündliche Erzählen kaum einen eigenen Stellenwert“ (Bartnitzky, 2000, S. 34). Der Vorrang ist immer noch bei der Schriftlichkeit geblieben. Da sich der größte Teil des Sprachhandelns der Kinder im schulischen Leben überwiegend im mündlichen Bereich abspielt, sollte das Erzählen ein wichtiger Arbeits- und Förderbereich sein (vgl. ebd., S. 24).
Unter dem alltagssprachlichen Begriff „Erzählen“ werden unterschiedliche Formen von Äußerungen zusammengefasst. Ehlich unterscheidet zwischen dem „Erzählen 1“ und dem „Erzählen 2“. Das Erste bezieht sich auf alltagssprachliche Äußerungen, wie u. a. das Berichten, Mitteilen, Wiedergeben und das Erzählen im engeren Sinne. Das Erzählen im engeren Sinne wird mit „Erzählen 2“ bezeichnet und bezieht sich auf das Erzählen einer Geschichte und damit auf die heutige Stunde (vgl. Becker 2005, S.9 f.).
Das Erzählen von Geschichten zeichnet sich dadurch aus, dass etwas Besonderes, Außergewöhnliches, Unerwartetes geboten wird.
Die nachfolgenden Punkte kennzeichnen laut Boueke et al. (1995, S. 15) eine Geschichte:
1. Das Zustandekommen einer Geschichte ist von zusammengehörigen Ereignissen als kohärente Ereignisfolge organisiert und die ausdrückenden sprachlichen Einheiten zu einer linearen Kette miteinander verbunden. (Es gelten dieselben Bedingungen wie für jeden Text.)
2. Eine Geschichte als Variante einer Erzählung ist zusätzlich durch ein unerwartetes Ereignis, das im Mittelpunkt steht, gekennzeichnet.
3. Die für eine Geschichte zentrale Funktion besteht darin, den Zuhörer in das Geschehen mit einzubeziehen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Marlena Börger (Autor:in), 2010, Unterrichtsentwurf zum Üben freien Erzählens unter Einhaltung von Erzählregeln, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/210856