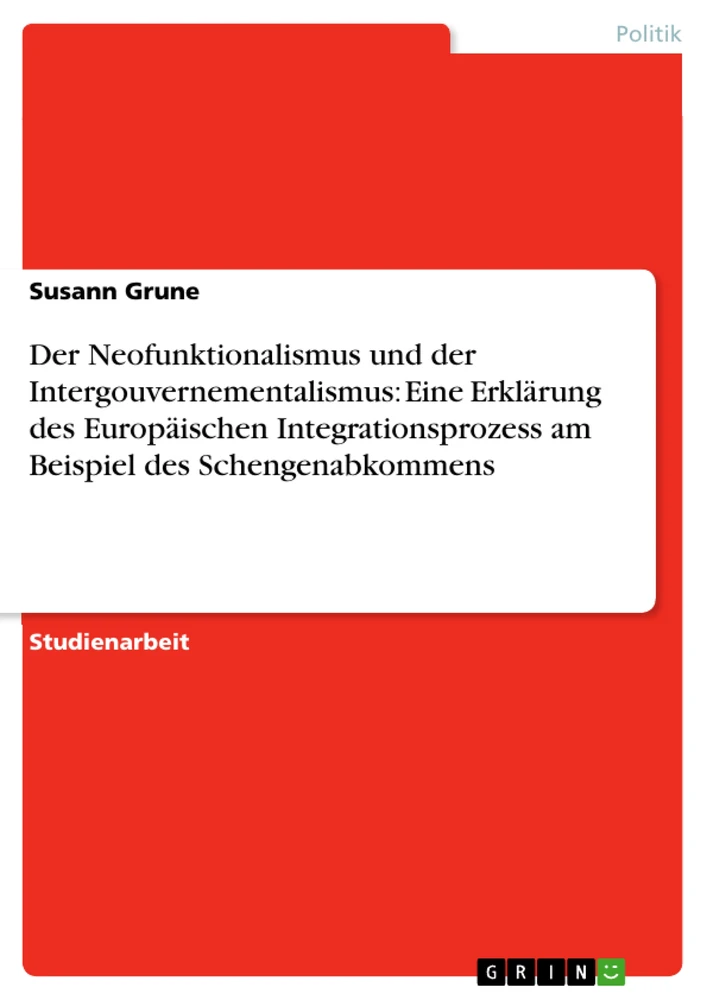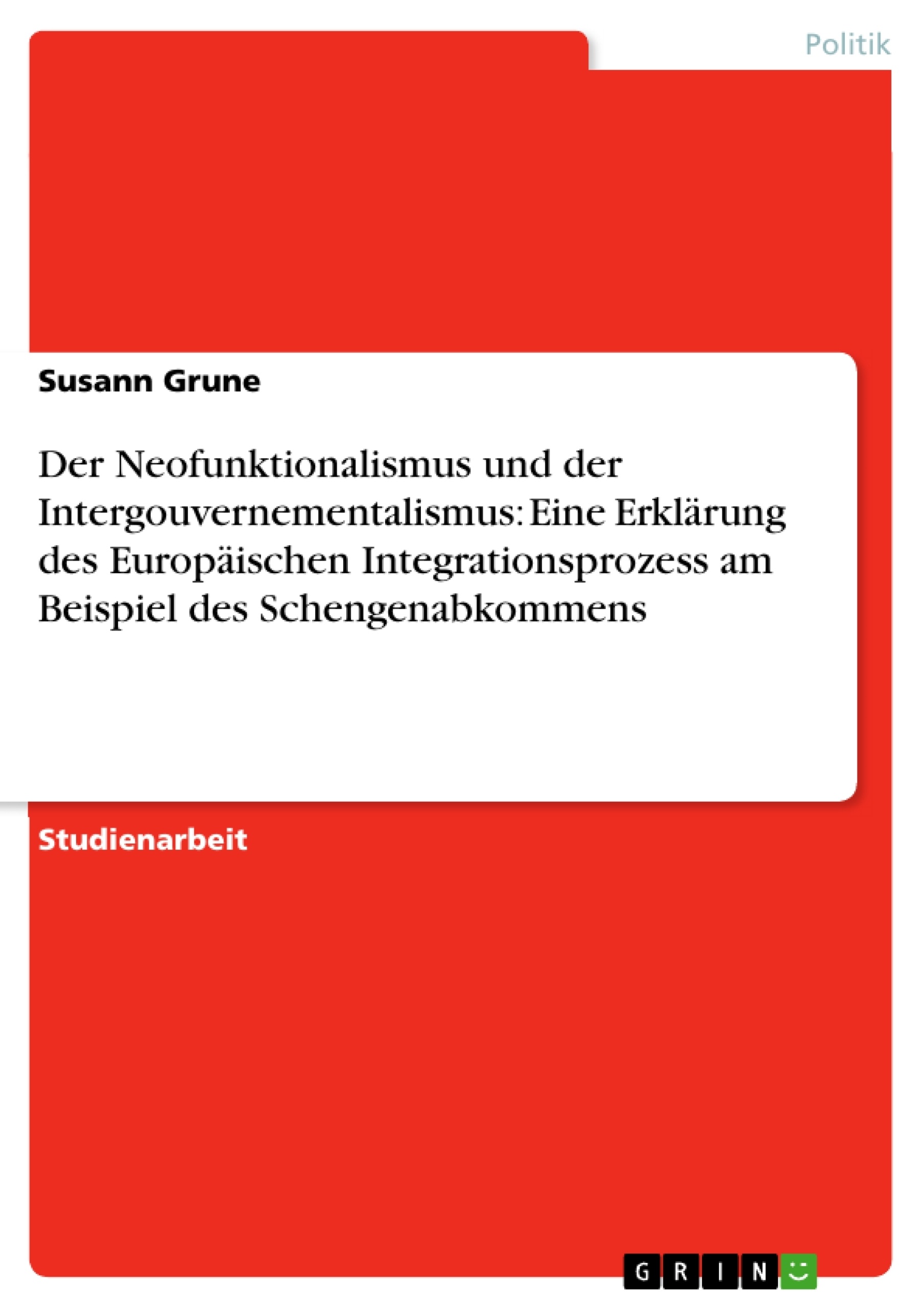Seit Anfang des Jahres 2008 besteht mit dem Verzicht auf Grenzkontrollen in Ländern wie Ungarn und Polen, die seit 2004 zur Europäischen Union (EU) gehören, in weiten Teilen des europäischen Festlands Reisefreiheit. Dieses Ereignis wurde vom deutschen Bundesinnenminister Schäuble im Dezember 2007 mit folgenden Worten gewürdigt: "Es wird mehr Freiheit geben und nicht weniger Sicherheit. Deshalb können wir uns auf die Schengen-Erweiterung und ein weiter zusammenwachsendes Europa freuen.“1 Mit Abstand zu dieser anfänglicher Euphorie konzentriert sich die Schwerpunktsetzung in dieser Ausarbeitung auf sicherheitspolitische Aspekte des nationalen Souveränitäts-transfers. Wesentlich verkürzt werden demnach Überlegungen zu historischen Details des Schengenabkommens sowie zu einzelnen Durchführungsbestimmungen und zu landesspezifischen Vor- und Nachteilen des Schengen-Raums erörtert. Diese Eingrenzung auf das Sicherheitsthema ist relevant in Zeiten der organisierten Kriminalität, der illegalen Migration, des Menschenhandels und besonders durch die Herausforderung des internationalen Terrorismus weder von Nationalstaaten noch von supranationalen Organisationen wie die EU unter-schätzt werden darf. Bleibt die Frage, wie es sich aus theoretischer Perspektive erklären lässt, warum eine Einigung auf diesem Gebiet nicht über den Europäischen Rat erfolgt ist und erst mit dem Schengenabkommen Blockaden von bestimmten EU-Mitgliedern überwunden wurde. Diese Vorüberlegungen bilden die Basis für die Konzeptualisierung der folgenden Fragestellung: Warum ist eine Integration in bestimmten Politikfeldern, die sich z. B. auf staatliche Aussengrenzen auswirkt, schwieriger als eine Vergemeinschaftung von wirtschaftlichen Bereichen?
Inhaltsverzeichnis
- Dient das Schengenabkommen dem europäischen Integrationsprozess?
- Der Neofunktionalismus und die Europäische Integration der 50er Jahre
- Der Intergouvernementalismus und Integrationskrisen der 60er Jahre
- Stärken- und Schwächenprofil beider Integrationsstrategien
- Integrationserfolge und -rückschritte innerhalb des Schengenabkommens
- Annäherung an die Wirklichkeit durch eine Theoriekombination?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob das Schengenabkommen den europäischen Integrationsprozess fördert, indem sie die Integrationsdynamiken des Abkommens unter dem Blickwinkel des Neofunktionalismus und des Intergouvernementalismus beleuchtet.
- Sicherheitspolitische Aspekte des nationalen Souveränitätstransfers
- Bedeutung des Schengenabkommens in Zeiten der organisierten Kriminalität, der illegalen Migration und des internationalen Terrorismus
- Erläuterung des Neofunktionalismus und des Intergouvernementalismus als Theorien der Europäischen Integration
- Analyse der Grenzen und Schwächen beider Theorien im Hinblick auf die Erklärung von Integrationsschritten und -rückschlägen
- Integration des Dialektischen Funktionalismus von Dorette Corbey zur Erklärung von Integrations- und Nichtintegrationsphasen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage, ob das Schengenabkommen den europäischen Integrationsprozess unterstützt. Es beleuchtet die Bedeutung des Abkommens in Bezug auf die Sicherheit und stellt die Rolle des nationalen Souveränitätstransfers in den Fokus.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel erläutert den Neofunktionalismus als eine Theorie der Europäischen Integration und zeigt auf, wie er die Integrationsdynamiken der 1950er Jahre erklärt. Der Fokus liegt dabei auf der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und ihrer Ausweitung zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Intergouvernementalismus als einer weiteren Theorie der Europäischen Integration und zeigt, wie er die Integrationskrisen der 1960er Jahre erklärt.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel untersucht die Stärken und Schwächen des Neofunktionalismus und des Intergouvernementalismus im Hinblick auf ihre Fähigkeit, den Integrationsprozess der Europäischen Union zu erklären.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel beleuchtet die Integrationserfolge und -rückschritte innerhalb des Schengenabkommens, indem es die Auswirkungen des Abkommens auf den europäischen Verkehrsraum diskutiert.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Neofunktionalismus, Intergouvernementalismus, Schengenabkommen, Sicherheit, nationaler Souveränitätstransfer, Integrationsdynamiken, Integrationsschritte, Integrationsschwierigkeiten, Dialektischer Funktionalismus, Europäischer Verkehrsraum.
- Quote paper
- M.A. Susann Grune (Author), 2008, Der Neofunktionalismus und der Intergouvernementalismus: Eine Erklärung des Europäischen Integrationsprozess am Beispiel des Schengenabkommens, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/210651