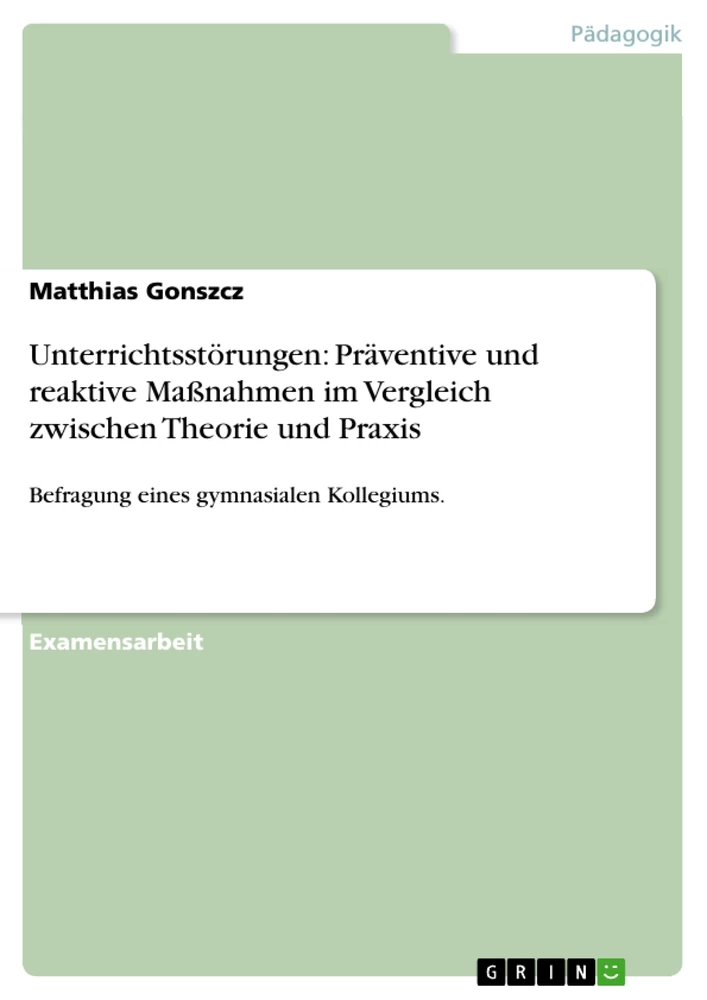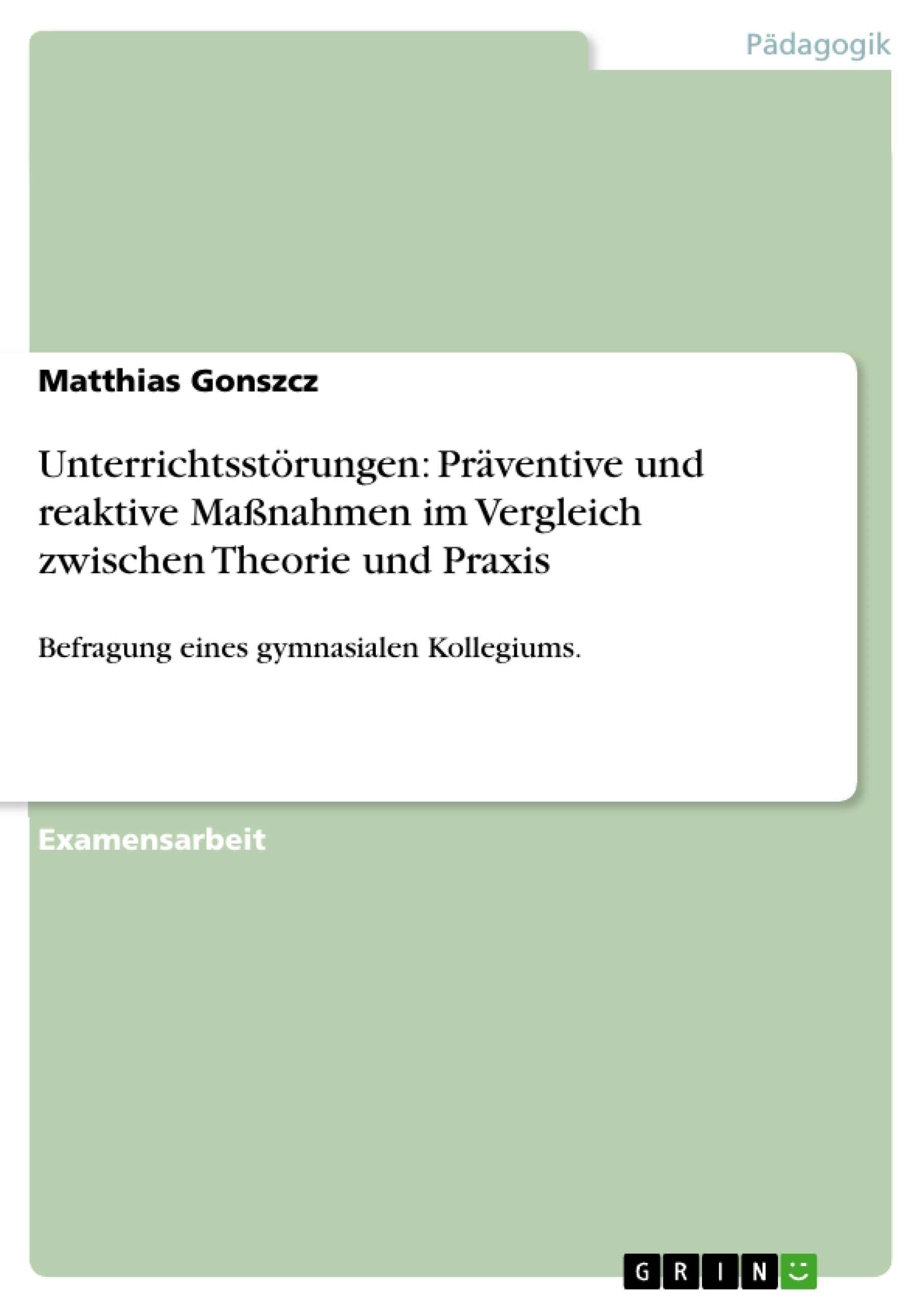Ein umfassende Arbeit zum Thema Unterrichtsstörungen, speziell der in der aktuellen Fachliteratur besprochenen präventiven und reaktiven Strategien, die im theoretischen Teil vorgestellt und im praktischen Teil der Arbeit auf ihre Effektivität und Verwendung im Klassenzimmer hin untersucht. Das Classroom Management findet dabei eine wesentliche Beachtung .
Zielsetzung der Arbeit
Die geschilderte Sachlage wirft die Frage auf, wie sich der Vergleich zwischen Theorie und Praxis in Bezug auf den Umgang mit Unterrichtsstörungen aktuell gestaltet. Wie ist in der Praxis die Verteilung von präventiven und reaktiven Maßnahmen? Auf welche Strategien greifen Lehrkräfte tatsächlich zurück und wie bewerten sie deren Effektivität? Die vorliegende theoretische und empirische Untersuchung will diese und weitere damit im Verhältnis stehende Fragen beantworten und einen Abgleich zwischen Theorie und Praxis schaffen.
Fragestellungen:
I. Wie viele der in der aktuellen Literatur diskutierten Strategien sind den Lehrkräften bekannt?
II. Erweitern bzw. mindern Lehrkräfte ihr Repertoire an Maßnahmen mit zunehmender Berufserfahrung?
III. Welche der den Lehrern bekannten Strategien aus der aktuellen Literatur werden auch tatsächlich angewandt?
a. Wie ist in der Praxis das Verhältnis zwischen den präventiven und reaktiven Maßnahmen verteilt?
b. Welche sind die am häufigsten vorkommenden Strategien?
IV. Wie beurteilen die Lehrkräfte die Effektivität der angewandten Strategien?
a. Was halten Lehrkräfte von präventiven Maßnahmen?
b. Welches sind die Gründe für einen möglicherweise geringen Einsatz präventiver Maßnahmen in der Schule?
V. Wie kamen Sie zu diesen Strategien?
VI. Wie groß ist der Anteil unbewusst angewandter gegenüber bewusst angewandten Strategien?
Ziele:
- Erarbeitung der in der Literatur diskutierten präventiven und reaktiven Maßnahmen
- Hervorhebung der Bedeutung der präventiven Maßnahmen gegenüber den reaktiven
- Feststellen, ob die in der aktuelleren Literatur hervorgebrachten Maßnahmen in der Praxis angekommen sind
- Feststellen, welche Strategien bekannt sind und welche an- gewandt werden
- Feststellung der im Schulalltag am häufigsten angewandten Strategien
- Feststellen, inwieweit die Bewältigung von Unterrichtsstörungen unbewusst geschieht
- Erfassung der Standpunkte der Lehrerinnen und Lehrer bzgl. der verschiedene Maßnahmen, speziell der präventiven
- Abgleich von Theorie und Praxis
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Definitionen und Begriffsklärungen
- 2.1 Unterrichtsstörungen
- 2.1.1 Definition nach Karlheinz Biller (1979)
- 2.1.2 Definition nach Rainer Winkel
- 2.1.3 Definition nach Gert Lohmann
- 2.2 Klassenführung - Classroom Management
- 2.1 Unterrichtsstörungen
- 3 Forschungsstand
- 3.1 Prävention und Intervention von Unterrichtsstörungen
- 3.1.1 Erste Studien zum Classroom Management
- 3.1.2 Jacob Kounins Befunde
- 3.1.3 Befunde Evertsons et. al.
- 3.1.4 Führungsstil (Tausch/Tausch)
- 3.1.5 Haertel, Wang und Walberg
- 3.1.6 Helmke (Scholastik-Studie)
- 3.2 Vergleich zwischen Theorie und Praxis
- 3.2.1 Erfolgreiche Strategien und Typen - Mayr et al.
- 3.2.2 LCH-Befragung zu Disziplinschwierigkeiten in den deutschschweizerischen Schulen
- 3.2.3 Umfrage Noltings
- 3.3 Kritische Reflexion des Forschungsstandes
- 3.4 Aktuelle Literatur zum Thema
- 3.1 Prävention und Intervention von Unterrichtsstörungen
- 4 Strategien im Umgang mit Unterrichtsstörungen
- 4.1 Präventive Strategien
- 4.1.1 Disziplin-Managementebene und Organisation
- 4.1.2 Prävention auf der Unterrichtsebene
- 4.1.3 Prävention auf der Beziehungsebene
- 4.2 Reaktive Strategien
- 4.2.1 Interventionsstrategien auf der Beziehungsebene
- 4.2.2 Interventionen auf der Disziplin-Managementebene
- 4.2.3 Interventionsstrategie auf der Unterrichtsebene
- 4.2.4 Bedeutung präventiver Strategien
- 4.1 Präventive Strategien
- 5 Zusammenfassung des theoretischen Teils
- 6 Die Studie – Fragestellung und Hypothesen
- 6.1 Fragestellungen
- 6.2 Hypothesen
- 7 Methodik
- 7.1 Forschungsdesign
- 7.2 Erstellung des Fragebogens
- 7.3 Aufbau des Fragebogens
- 7.4 Vorstellung der Schule (Stichprobe)
- 7.5 Durchführung
- 7.6 Datenanalyse
- 8 Auswertung und Ergebnisse
- 8.1 Stichprobe
- 8.2 Kenntnis der Strategien
- 8.2.1 Kenntnis der Strategien
- 8.2.2 Kenntnis der Strategien in Abhängigkeit der Dienstjahre
- 8.3 Verwendung der Strategien
- 8.3.1 Verwendung der vorgestellten Strategien
- 8.3.2 Verwendung präventiver und reaktiver Strategien im Vergleich
- 8.3.3 Von den Lehrkräften angegebene Strategien
- 8.3.4 Eingeschätzte Verwendung an der Schule
- 8.4 Effektivität der Strategien
- 8.4.1 Effektivität der vorgestellten Strategien
- 8.4.2 Effektivität präventiver und reaktiver Strategien im Vergleich
- 8.5 Gründe für den seltenen Einsatz präventiver Strategien
- 8.6 Aneignung der Strategien
- 8.7 Bewusste bzw. unbewusste Verwendung
- 9 Diskussion
- 9.1 Zusammenfassung und Diskussion der Befunde
- 9.2 Methodenkritik
- 9.3 Ausblick
- 10 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht präventive und reaktive Maßnahmen im Umgang mit Unterrichtsstörungen an einem Gymnasium. Ziel ist es, den praktischen Umgang mit solchen Störungen im Vergleich zu theoretischen Ansätzen zu analysieren.
- Präventive Strategien zur Vermeidung von Unterrichtsstörungen
- Reaktive Strategien zur Intervention bei Störungen
- Vergleich zwischen Theorie und Praxis im Umgang mit Unterrichtsstörungen
- Analyse der Effektivität verschiedener Strategien
- Faktoren, die den Einsatz präventiver Strategien beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Unterrichtsstörungen ein und beschreibt die Zielsetzung sowie den Aufbau der vorliegenden Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas im schulischen Kontext herausgestellt und der Rahmen der Untersuchung abgesteckt. Die Einleitung dient als Orientierungshilfe für den Leser und liefert einen Überblick über die behandelten Aspekte.
2 Definitionen und Begriffsklärungen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen von "Unterrichtsstörungen" und "Klassenführung", basierend auf verschiedenen theoretischen Ansätzen von Biller, Winkel und Lohmann. Es klärt grundlegende Begriffe und schafft damit eine einheitliche terminologische Grundlage für die weitere Analyse. Die unterschiedlichen Definitionen werden verglichen und ihre Implikationen für die Praxis diskutiert.
3 Forschungsstand: Kapitel 3 beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Thema Prävention und Intervention von Unterrichtsstörungen. Es werden relevante Studien und Theorien von Kounin, Evertson et al., Tausch/Tausch, Haertel, Wang und Walberg sowie Helmke (Scholastik-Studie) vorgestellt und kritisch reflektiert. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen theoretischen Modellen und empirischen Befunden. Es wird ein Überblick über erfolgreiche Strategien und deren Anwendung in der Praxis gegeben, inklusive der Analyse von Befragungen wie der LCH-Studie und der Umfrage Noltings.
4 Strategien im Umgang mit Unterrichtsstörungen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert präventive und reaktive Strategien im Umgang mit Unterrichtsstörungen. Es unterteilt diese Strategien nach verschiedenen Ebenen (Disziplin-Management, Unterricht, Beziehung) und erläutert deren jeweilige Anwendung und Bedeutung. Der Schwerpunkt liegt auf der systematischen Darstellung und dem Vergleich der verschiedenen Ansätze. Die Bedeutung präventiver Strategien wird besonders hervorgehoben.
5 Zusammenfassung des theoretischen Teils: Dieses Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse des theoretischen Teils zusammen und bereitet den Leser auf den empirischen Teil der Arbeit vor. Es dient als Brücke zwischen Theorie und Praxis und stellt die Verbindung zwischen den theoretischen Grundlagen und der Forschungsfrage her.
6 Die Studie – Fragestellung und Hypothesen: Dieses Kapitel formuliert die Forschungsfragen und Hypothesen, die im empirischen Teil der Arbeit untersucht werden. Es beschreibt die Grundlage für die empirische Erhebung und die zu erwartenden Ergebnisse. Die Forschungsfragen leiten die Methodik und die Auswertung der Daten.
7 Methodik: Kapitel 7 beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es wird das Forschungsdesign vorgestellt, der Aufbau des Fragebogens erläutert und die Stichprobe beschrieben. Die Durchführung der Studie und die Methoden der Datenanalyse werden transparent dargestellt.
8 Auswertung und Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Auswertung der Daten zu den Kenntnissen, der Anwendung und der Effektivität verschiedener Strategien wird detailliert beschrieben. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Forschungsfragen und Hypothesen interpretiert.
Schlüsselwörter
Unterrichtsstörungen, Prävention, Intervention, Klassenführung, Classroom Management, Strategien, Effektivität, Lehrerbefragung, Gymnasium, Theorie, Praxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Präventive und Reaktive Maßnahmen im Umgang mit Unterrichtsstörungen an einem Gymnasium
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht präventive und reaktive Maßnahmen im Umgang mit Unterrichtsstörungen an einem Gymnasium. Sie analysiert den praktischen Umgang mit Unterrichtsstörungen im Vergleich zu theoretischen Ansätzen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt präventive Strategien zur Vermeidung von Unterrichtsstörungen, reaktive Strategien zur Intervention bei Störungen, den Vergleich zwischen Theorie und Praxis im Umgang mit Unterrichtsstörungen, die Analyse der Effektivität verschiedener Strategien und die Faktoren, die den Einsatz präventiver Strategien beeinflussen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil umfasst Kapitel 1 (Einleitung), 2 (Definitionen und Begriffsklärungen), 3 (Forschungsstand), 4 (Strategien im Umgang mit Unterrichtsstörungen) und 5 (Zusammenfassung des theoretischen Teils). Der empirische Teil umfasst Kapitel 6 (Die Studie – Fragestellung und Hypothesen), 7 (Methodik), 8 (Auswertung und Ergebnisse) und 9 (Diskussion). Kapitel 10 enthält die Zusammenfassung der gesamten Arbeit.
Welche Definitionen von "Unterrichtsstörungen" werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Definitionen von "Unterrichtsstörungen", unter anderem von Karlheinz Biller (1979), Rainer Winkel und Gert Lohmann. Diese Definitionen werden im Kapitel 2 vorgestellt und verglichen.
Welche theoretischen Ansätze werden im Forschungsstand (Kapitel 3) diskutiert?
Kapitel 3 beleuchtet den Forschungsstand zu Prävention und Intervention von Unterrichtsstörungen, einschließlich Studien und Theorien von Kounin, Evertson et al., Tausch/Tausch, Haertel, Wang und Walberg sowie Helmke (Scholastik-Studie). Es werden erfolgreiche Strategien und deren Anwendung in der Praxis analysiert, sowie Befragungen wie die LCH-Studie und die Umfrage Noltings.
Welche Strategien im Umgang mit Unterrichtsstörungen werden vorgestellt?
Kapitel 4 beschreibt detailliert präventive und reaktive Strategien, unterteilt nach Ebenen (Disziplin-Management, Unterricht, Beziehung). Es erläutert deren Anwendung und Bedeutung und hebt die Bedeutung präventiver Strategien hervor.
Wie ist die empirische Untersuchung aufgebaut (Kapitel 6 & 7)?
Der empirische Teil formuliert Forschungsfragen und Hypothesen. Kapitel 7 beschreibt die Methodik, das Forschungsdesign, den Aufbau des Fragebogens, die Stichprobe (eine Schule), die Durchführung der Studie und die Datenanalyse.
Welche Ergebnisse werden in Kapitel 8 präsentiert?
Kapitel 8 präsentiert die Ergebnisse der Lehrerbefragung zu Kenntnissen, Anwendung und Effektivität verschiedener Strategien. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Forschungsfragen und Hypothesen interpretiert, einschließlich der Analyse der Effektivität präventiver und reaktiver Strategien und der Gründe für den seltenen Einsatz präventiver Strategien.
Was beinhaltet die Diskussion in Kapitel 9?
Die Diskussion (Kapitel 9) fasst die Befunde zusammen, diskutiert diese kritisch, reflektiert die Methodik und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Unterrichtsstörungen, Prävention, Intervention, Klassenführung, Classroom Management, Strategien, Effektivität, Lehrerbefragung, Gymnasium, Theorie, Praxis.
- Quote paper
- Matthias Gonszcz (Author), 2012, Unterrichtsstörungen: Präventive und reaktive Maßnahmen im Vergleich zwischen Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/210130