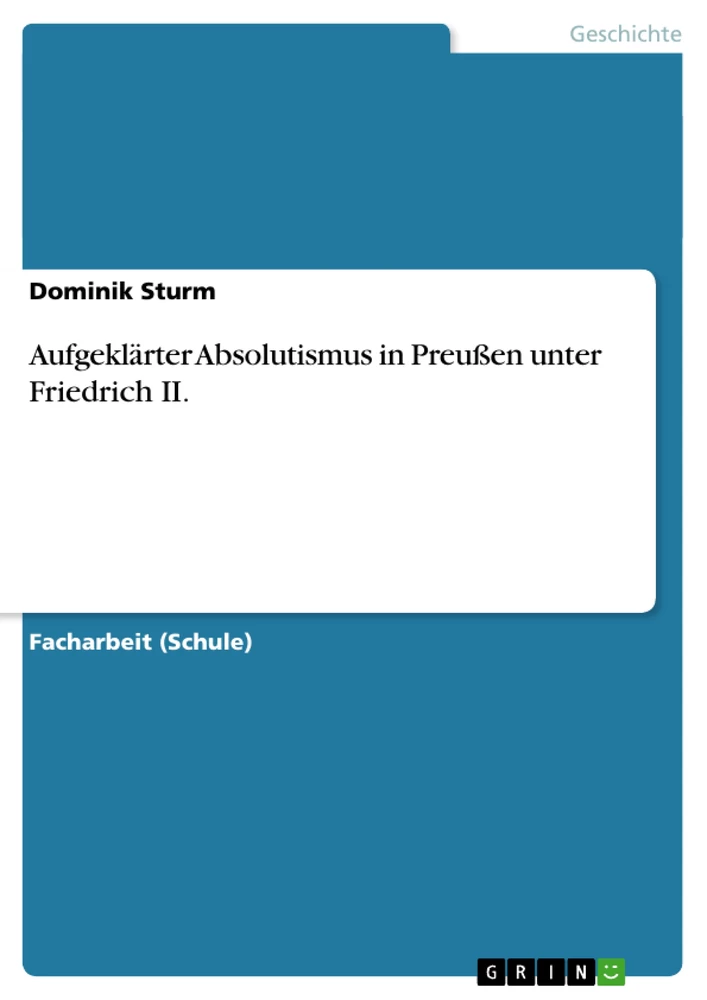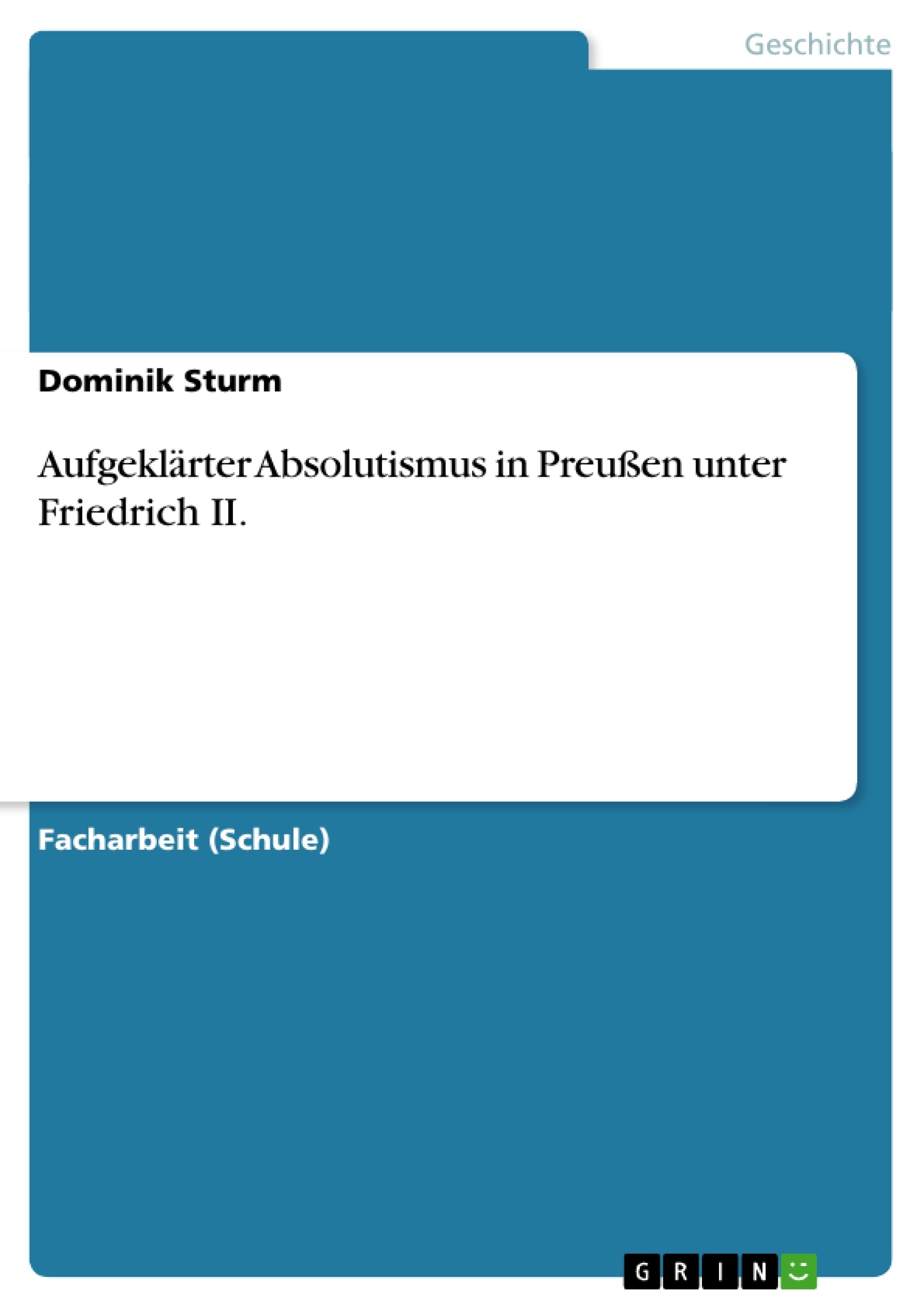In dieser Arbeit geht es um den "Aufgeklärten Absolutismus in Preußen unter Friedrich II.". Dabei analysiere ich seine Politik, um zu klären, ob er Absolutist oder Aufklärer war. Im Speziellen befasse ich mich mit ihm als Aufklärer, aber auch als absoluten Herrscher. So kann ich zeigen, wie die beiden politischen Eigenschaften Friedrichs zum Vorschein kommen und wo sich diese gebildet haben. Mein Ziel ist es zu zeigen, dass Friedrich II. tatsächlich ein aufgeklärter König war und kein einfacher absoluter Herrscher wie seine Zeitgenossen, obwohl es den Absolutismus als solches nirgendwo in seiner Reinform gab.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Was ist Aufklärung - Aufgeklärter Absolutismus
3 Briefwechsel mit Voltaire
3.1 Der Anti-Machiavelli als Regierungsgrundlage?
4 Die Politik von Friedrich II.
4.1 Die Verwaltung
4.2 Die Gesellschaft
4.3 Die Wirtschaftspolitik
4.4 Die Toleranzpolitik
4.5 Das Bildungswesen
4.6 Das Justizwesen
4.7 Die Außenpolitik & das Militär
5 Friedrich II. - Aufklärer oder absoluter Herrscher?
6 Literatur
1 Einleitung
In dieser Facharbeit befasse ich mich mit dem aufgeklärten Absolutismus in Preußen unter Friedrich II. Ich habe mich für dieses Thema entschieden, da Friedrich durch seine vielen Wesenszüge, meiner Meinung nach, eine der interessantesten Persönlichkeiten der Geschichte ist. Bereits außerhalb der Schule habe ich mich mit ihm als Menschen und Monarchen befasst, da mich seine Einzigartigkeit und die Tragik seines Lebens fasziniert. Durch das Schreiben dieser Arbeit erhoffe ich mir, noch mehr über Friedrich II. in Erfahrung zu bringen.
Im Speziellen befasse ich mich mit ihm als Aufklärer, aber auch als absoluten Herrscher. So kann ich zeigen, wie die beiden politischen Eigenschaften Friedrichs zum Vorschein kommen und wo sich diese gebildet haben. Mein Ziel ist es zu zeigen, dass Friedrich II. tatsächlich ein aufgeklärter König war und kein einfacher absoluter Herrscher wie seine Zeitgenossen, obwohl es den Absolutismus als solches nirgendwo in seiner Reinform gab.
Zuerst gebe ich in meiner Hausarbeit einen Überblick über die Aufklärung und den aufgeklärten Absolutismus als Ganzes. Dabei gehe ich darauf ein wie die Aufklärung entstand und was die Aufklärer verändern wollen. Im Zusammenhang der Aufklärung mit dem Absolutismus stelle ich dar, was an dem aufgeklärten Absolutismus anders ist und wann es sich um diese Form der Regierung handelt. Zudem dient es als Einführung in das Thema.
In dem nächsten Kapitel beleuchte ich den Briefwechsel mit Voltaire und erkläre, warum gerade Voltaire Friedrichs Mentor wurde und welche Einflüsse der französi- sche Philosoph auf den Monarchen hatte. Im Besonderen gehe ich im Abschnitt 3.1. auf den Anti-Machiavelli ein, da dieser eine der aufgeklärten Schriften Friedrichs ist, welche zudem aus dem Briefwechsel zweier hoher Köpfe dieser Zeit entstanden ist. Hier kläre ich die Frage, ob der Anti-Machiavelli tatsächlich als Grundlage für sei- ne spätere Regierung angesehen werden kann. Dieses Kapitel ist vor allem wichtig, um einige Zusammenhänge seiner Regierung, vor allem im Bezug auf Voltaire und seinen Anti-Machiavelli, zu verstehen.
In Kapitel 4 befasse ich mich mit der Politik Friedrichs und erkläre dabei, ob seine Art der Regierung auf sein aufgeklärtes Weltbild beziehungsweise die Grundsätze der Aufklärung zurück zu führen ist, oder ob sie auf der Grundlage des Absolutismus, also aufgrund eigener Interessen, entstanden ist. Hierbei ist aber auch darauf zu achten, ob es sich um ”vernünftige“Reformenhandelt.DazuwerdeichdieAspekte seiner Politik (Verwaltung, Religionspolitik, Schulwesen, usw.) genauer darstellen, um die objektive Schlussfolgerung in Kapitel [5] verständlich zu machen. Das letzte Kapitel dient als Schluss dieser Arbeit. Hier kläre ich, ob Friedrich ein Aufklärer oder ein absoluter Herrscher war. Indem sämtliche Argumente nochmals zusammengetragen werden, um dann auch meine Aussage, bezüglich der Einordnung Friedrichs, zu klären.
2 Was ist Aufklärung - Aufgeklärter Absolutismus
Bei der Aufklärung handelt es sich um eine Reformbewegung die gegen Ende des 17. Jahrhunderts ihren Anfang nahm. Die Idee verbreitete sich durch Lesezirkel, Ge- heimgesellschaften oder philosophische Schriften, wie zum Beispiel die von François Marie Arouet[1] oder Christian Wolff. Vertreter dieser philosophischen Bewegung be- riefen sich stets auf die Vernunft, denn diese diene als einziges dazu, um alle mögli- chen Sachverhalte einzuschätzen. Dorinda Outram beschrieb diese Aufklärung fol- gendermaßen:
” A ufklärungwarderWunschdanach,dassmenschlicheAngelegenheiten von der Vernunft geleitet werden, anstatt durch Religion, Aberglauben oder Offenbarung; und der Glaube an die Kraft der menschlichen Ver- nunft die Gesellschaft zu verändern und das Individuum von den Fes- seln der Tradition oder der willkürlichen Autorität zu befreien. All dies gestützt durch eine Weltanschauung, die zunehmend durch die Wissen- schaft anstatt durch Religion oder Tradition validiert wird. “ [21]
Man wandte sich von der Religion ab und ersetzte diese durch die Vernunft, in diesem Augenblick berief man sich auf die Naturreligion[2]. schrieb Christian Thomasius, ” D asLichtderNatur “, ” u nddasLichtderOffenbarungsindzweiverschie- dene Quellen; die Theologie ist aus der Schrift, die Philosophie aus der Vernunft herzuleiten. “ [5, S.15] Aber hauptsächlich war die Aufklärung eine Reform der Ge- sellschaft. Die Aufklärer wollten also das vorherrschende Feudalsystem durch die Vernunft ersetzen. Sie forderten die politische Gleichberechtigung und wollten so- mit die Herrschaft des Adels brechen, oder zumindest einschränken, denn der Adel verfügte immer noch über zahlreiche Privilegien. Doch Preußen bestand zu 80 Pro- zent aus Bauern, von denen trotz allgemeiner Schulpflicht viele nicht lesen oder schreiben konnten. Aus diesem Grund wundert es nicht, dass diese Ideale meist durch Intellektuelle, beziehungsweise den niederen Adel, vertreten wurden. Jedoch ist eine solche Reform der Gesellschaft ohne die Regierung nicht umsetzbar, vor allem nicht zur Zeit des Absolutismus, und somit wurde nach einem Kompromiss gesucht.
Der aufgeklärte Absolutismus war dieser Kompromiss, doch mussten die Monar- chen selbst aufgeklärt sein, oder zumindest einige der Vorstellungen teilen, damit ein solcher Staat entstehen konnte. Befürworter dieser neuen aufgeklärten Regie- rungsform waren Persönlichkeiten wie Christian Wolff oder Andreas Riem, welche schon zur Zeit der Frühaufklärung aktiv geworden waren. Vor allem Christian Wolff wurde von vielen Aufklärern bewundert und hoch gelobt. Ein aufgeklärter Staat strebt Reformen an die durch die Vernunft begründet sind, also die Humanisierung der Justiz und der Bestrafungen[3], das Abbauen des Ständesystems, was teils nur bedingt möglich war, das Abwenden vom Gottesgnadentum[4] sowie die Toleranz in Glaubensfragen und die Trennung der Religion vom Staat. Vor allem aber sollte sich der Fürst unter die Bedürfnisse des Volkes und des Staates stellen und nicht nur seinen eigenen Zielen folgen. Das Augenmerk der Regierung wurde aber auf das Bildungssystem gelegt, denn auch das Volk sollte die Ideen des Staates teilen, es sollte dazu erzogen werden seinen Verstand zu gebrauchen. Der Unterschied zum konventionellen Absolutismus ist ohne Frage, dass der Fürst nicht mehr der von Gott gegebene, über dem Gesetz stehende, Herrscher ist, sondern der Fürst ist der oberste ” R epräsentanteinervernünftigenStaatsordnung,dessenVerpflichtungesist “[20], seinen Untergebenen zu dienen. Der Herrscher war an eine Art Gesellschaftsvertrag gebunden, nach dem ” d erStaatauseinemVertragfreierMenschenentstehtundder Fürst dem Allgemeinwohl verpflichtet ist. “10, S.53 Im aufgeklärten Absolutismus ist der Fürst also der oberste Diener des Staates, der für das Volk regiert, aber das Volk nicht an der Regierung teilhaben soll.
Vor allem Friedrich II. von Preußen gilt als Vertreter des aufgeklärten Absolutis- mus, er selbst stilisierte sich auch gern als aufgeklärten Herrscher, der den preußi- schen Staat reformierte und den aufgeklärten Idealen anpasste. Kein anderer wird in diesem Kontext so kritisiert wie er, denn trotz seiner aufgeklärten Reformen scheute er auch nicht davor zurück, Kriege zu führen und somit seinem Volk zu schaden. Er sah sich zwar als den ” e rstenDienerdesStaates “1,S.163,dochmeistwarenan
seinen Reformen für den preußischen Staat andere Menschen beteiligt oder teilwei se auch ausschlaggebend. Ob Friedrich nun ein Aufklärer oder doch ein absoluter Herrscher war, wird im letzten Kapitel dieser Arbeit geklärt.
3 Briefwechsel mit Voltaire
Voltaire, einer der bedeutendsten Philosophen zur Zeit der Aufklärung, war für Friedrich allzeit und in allen Lebenslagen ein großes Vorbild. Er schätzte jedes sei- ner Werke und hielt jedes Einzelne in Ehren. Er wurde sogar so sehr von ihm verehrt, dass sich Friedrich eine Büste des französischen Philosophen in sein Schloss Rheins- berg[5] holen ließ. Für Friedrich war schon früh klar, dass er, wenn er sich immer mehr bilden wollte, sich einen Mentor wie Voltaire zu suchen hatte, doch das war ” fürFriedricheinegro ßeHerausforderung,sichaneinenebensoumstrittenenwie viel umworbenen [. . . ] Autor zu wenden “. 14, S.39
Am 8. August 1736 wandte sich Friedrich erstmals an sein Vorbild, vor dem er mehrfach gewarnt wurde, da Voletaire nicht nur die Politik des französischen Staates kritisiert[6], sondern mit seiner allgemeinen Kritik gegenüber dem Absolutismus auch das preußische System in Frage stellte. Doch trotz aller Warnungen entschied sich Friedrich, an seinen späteren Mentor zu schreiben. Dies geschah mit vielen schmei- chelnden Worten und Loben, die ein Philosoph von ein zukünftigen König eigentlich nicht zu erwarteten hatte.
” M onseur,wenngleichichnichtdieGenugtuunghabe,Siepersönlichzu kennen, so sind Sie mir doch durch ihre Werke wohl bekannt. Es sind,
wenn ich mich so ausdrücken darf, Schätze des Esprits und Werke die mit so viel Geschmack, Delikatesse und Kunst gearbeitet sind, dass ihre Schönheiten bei jedem Wiederlesen ganz neu erscheinen. Ich vermeine darin den Charakter ihres ingniösen Schöpfers wiederzuerkennen, der unserem Volk und dem menschlichen Geistüberhaupt zur Ehre gereicht. [. . . ] Falls mein Schicksal es mir vergönnt, sie selbst zu besitzen, so kann ich doch hoffen, eines Tages den Mann zu sehen, den ich seit so langer Zeit von weitem bewundere. “2, S.237
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt eines langen Briefes, der für Friedrich eine neue Zeit einleitete. Damit ist die Zeit gemeint, in der er Voltaire als seinen Mentor ansah und eine Zeit einer Korrespondenz zweier geistreicher Köpfe, die beinahe ein gan- zes Jahrhundert prägten. Aus diesem Schriftverkehr gehen über 40 Jahre hinweg, je nach Quelle, 600-900 Briefe hervor, wo sich die beiden Männer mit allerhand Themen auseinandersetzten. In den Schriftstücken wimmelte es nur so von ” T hemenvielfalt und Spontanität zwischen Tiefschürfendem und launig hingeworfenen Artigkeiten. “ [14, S.38] So schrieb Friedrich auch am 10. März 1736 an seine Schwester Wilhel- mine:
” W irphilosophierennachHerzenslust.JetztsindwirbeiderMetaphysikdes berühmten Wolff “2, S.239.
Als Mentor lehrte Voltaire den Jungen Prinzen in der Philosophie, in den Idealen der Aufklärung, sowie der Wissenschaft. Auch die Skepsis an der Religion förderte er, denn beide waren überzeugte Anhänger des Deismus[7]. Neben den Diskussionen mit seinem Schüler redigierte Voltaire auch die Arbeiten Friedrichs und gab ihm Ratschläge zur Verbesserung. Aber vor allem die Auseinandersetzungen über die Politik sollten den Briefwechsel lange Zeit hauptsächlich beanspruchen. So disku- tierten die beiden, meist über mehrere Seiten hinweg, über einen klärten Staat. Voltaires Weltanschauung basierte ”wahren“aufge- ” a ufparlamentarischerMitbestim- mung und sehr weitgehender religiöser Toleranz “ 4, S.142. In dem Punkt der Reli- gionstoleranz waren sich die beiden Männer einig. Doch der Hauptträger der Macht sollte laut Friedrich immer noch allein der Monarch sein, da die Minister noch zu viele Nebenabsichten verfolgen würden und letztendlich nichts Gutes dabei heraus kommen könnte, wenn die Macht zu sehr verteilt würde. Zu seiner Einschätzung eines aufgeklärten Staates verfasste er mehrere Werke, unter anderem den Anti- Machiavelli.
3.1 Der Anti-Machiavelli als Regierungsgrundlage?
Als Höhepunkt seines Rheinsberger Schaffens und des Briefwechsels mit Voltaire ent- stand im Jahr 1739 sein Anti-Machiavelli, welchen Voltaire nach Friedrichs Thron- besteigung veröffentlichen sollte. In diesem Werk zerlegte Friedrich die Philosophie des Politikers Niccoló Machiavelli, die er in seiner Schrift Il Principe[8] darlegte. Die- ses Werk Friedrichs zählt zu seinen aufgeklärtesten Schriften, da Friedrich stets auf die Vernunft der Taten und auf die Rationalität sämtlichen Handelns hinwies.
In seinem Anti-Machiavelli zeichnete Friedrich das Idealbild eines Fürsten auf. So sollte ein Fürst nicht wie Machiavelli es forderte frei von moralischen Grundsätzen handeln, der Fürst müsse solchen Grundsätzen folgen, denn es ist die Aufgabe eines Fürsten sein Volk glücklich zu machen. Laut Friedrich sollte der ideale Fürst die Kunst und die Wissenschaft fördern, er solle stets im Sinne des Volkes handeln und besonders die Rechtspflege sei die wichtigste Aufgabe eines Fürsten. Auffällig an diesem Werk ist, dass er die Schrift Machiavellis Stück für Stück zerlegte und in seine Auffassung presste. So durfte der Staatsmann nicht so korrupt sein wie er von Machiavelli geschildert wurde, oder auch die Menschenliebe und die Gerechtigkeit sollten im Gegensatz zu Machiavelli im Mittelpunkt stehen. Friedrich sah sich auch selbst, wenn er später König sein sollte, als Beschützer der Menschen. es “, schrieb er, ” I chwage ” z urVerteidigungderMenschheitgegeneinUngeheueranzutreten, das sie zerstören will “4, S.149. Auch war es die Pflicht eines Fürsten der ” e rste Diener des Staates “ 1, S.163 zu sein und als aufgeklärter Herrscher mit aller Kraft versuchen, immer das beste zu tun.
War der Anti-Machiavelli eine Grundlage für eine aufgeklärte Regierungsform? Teilweise. Für Friedrich selbst war der Anti-Machiavelli kein zwingendes Nachschla- gewerk, denn man sollte dieses Werk eher als eine einfache philosophische Schrift sehen, mit der er unter den Philosophen seiner Zeit mitmischen wollte. Friedrich befasste sich zwar ausführlich mit dem aufgeklärten Absolutismus, natürlich nur in seiner Auffassung, doch ist und bleibt es eine Tugendliste, an die sich niemand zu halten hatte. Sicherlich zeigt die Geschichte auch, dass er viele Punkte, die er angesprochen hatte, einhielt, wie zum Beispiel seine Grundsätze in der Religionspo- litik, wo er die Toleranz der Religionen an oberste Stelle stellte, was auch auf den Grundsätzen der Aufklärung und auf dem Einwirken Voltaires beruhte, oder das der Fürst sich der Kunst und der Wissenschaft zu widmen hatte. Alles in allem ist nicht mit Sicherheit zu sagen, ob Friedrich II. sich seiner Regeln bemächtigt hat oder eben nicht.
4 Die Politik von Friedrich II.
Nach seiner Thronbesteigung am 31. Mai 1740, die wie bei seinem Vater ohne auf- wendige Krönung stattfand, änderte sich für Friedrich vieles. Der Amtsantritt wird von vielen Historikern als tiefe Zäsur angesehen, da Friedrich sich nun von der rheins- berger Gesellschaft losreißt und als neuer König herrscht, ein König von dem so ziemlich alle Menschen viel erwarten. So wusste es Friedrich durchaus zu unterschei- den wer Freunde und wer qualifizierte Beamte waren. Aus diesem Grund erhob er nur wenige seiner rheinsberger Freunde in ihrem Rang und die derzeitigen Minister, die schon unter Friedrich Wilhelm I. dienten, blieben größtenteils im Amt.
[...]
[1]Mit Künstlernamen Voltaire
[2]Als Naturreligion bezeichnet man eine Religion, die sich auch das Naturrecht beruft. In ihr ist alles der Vernunft untergeordnet und somit gewinnt man seine Erkenntnisse nicht mehr auf Grund der Offenbarung (s. Zitat von von Christian Thomasius auf S.4), sondern durch Forschung, strenge Beobachtung und Philosophie.
[3]Es beschreibt die Abschaffung von Strafen, oder Prozessregeln, welche mit Menschenrechten oder moralischen Grundgedanken nicht vereinbar wären.
[4]Rechtfertigung der Monarchen für die Ansprüche auf den Thron, somit sei die vorherrschende Ordnung der Gesellschaft von Gott gegeben und unantastbar.
[5]Das Schloss das Friedrich ab 1736 bewohnte. Diese Freiheit erlaubte ihm sein Vater erst nach der Hochzeit, im Jahr 1733 mit Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern. Hier lebte Friedrich sein aufgeklärtes Weltbild vollkommen aus und beschäftigte sich intensiv mit dem Licht der Aufklärung. Es lag 25km nördlich von seinem Ruppiner Regiment, dem Infanterieregiment Nr.15 das ihm am 29. Februar 1732 übertragen wurde und ihm den Rang des Oberst einbrachte.
[6]Weswegen Voltaire unter anderem zu einer Hafstrafe in der Bastille, im Jahr 1717, verurteilt wurde.
[7]Eine Religion die Gott als den Schöpfer des Universums betrachtet, er habe aber nach diesem Schöpfungsakt nicht weiter eingreiffen.
[8] Zu deutsch ”derFürst“.DasBucherschienimJahr 1513.
- Quote paper
- Dominik Sturm (Author), 2013, Aufgeklärter Absolutismus in Preußen unter Friedrich II., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/209714