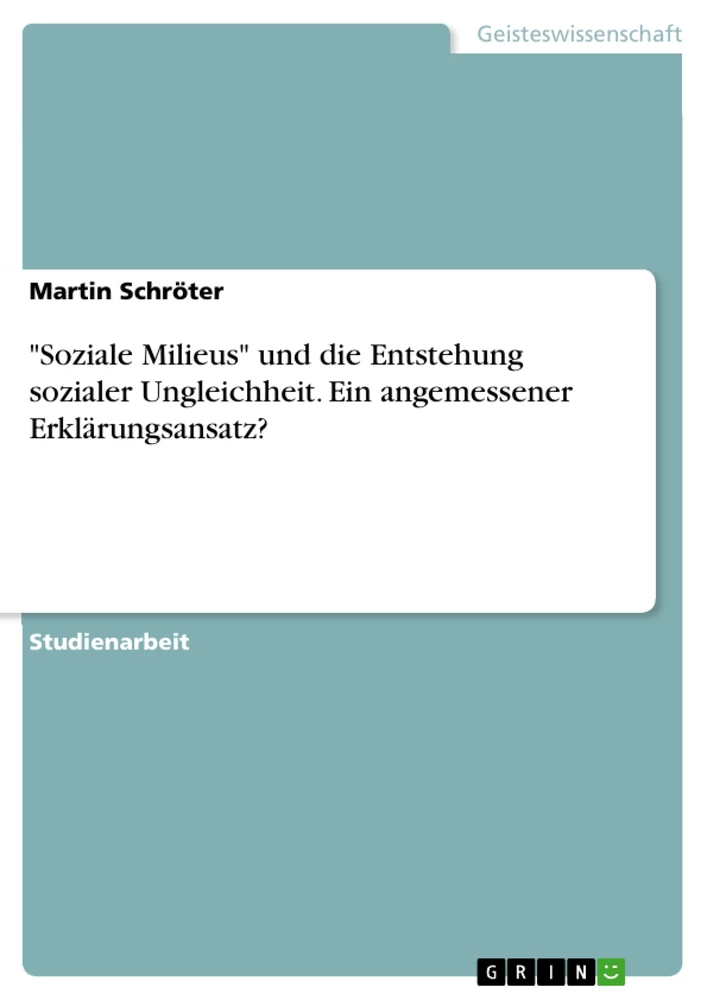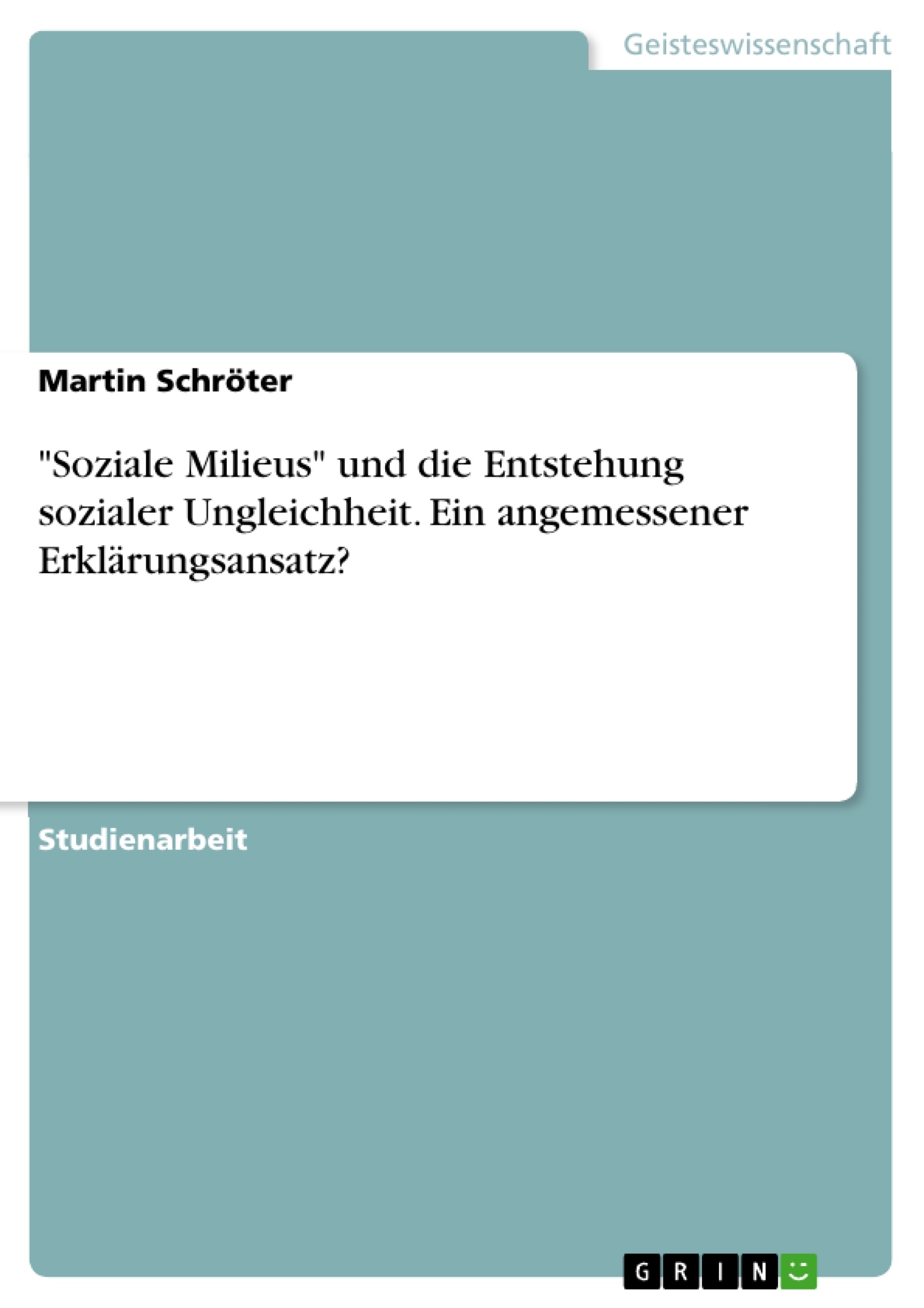Soziale Ungleichheit gab es vermutlich in allen Gesellschaften und zu jeder Zeit. Seit ihrer Entstehung setzen sich daher die Sozialwissenschaften und im speziellen die Ungleichheitsforschung mit sozialer Ungleichheit auseinander.
Bis heute wurden zahlreiche Theorien und Ansätze entwickelt, die die Entstehung sozialer Ungleichheit insbesondere durch verschiedene Begriffe wie Klassen, Stände und Schichten zu erklären vermögen. Dabei beschäftigen sie sich vor allem mit den objektiven, das heißt äußeren Bedingungen sozialer Ungleichheit wie Einkommen, Bildung und Beruf. Eine andere Perspektive schlägt der Ansatz der „sozialen Milieus“ vor, der – aufbauend auf den Ideen des Soziologen Pierre Bourdieus – die subjektive Seite sozialer Ungleichheit untersucht. Seine Grundannahme ist, dass soziale Ungleichheit – zwar durchaus abhängig, aber weniger von objektiven Faktoren wie Einkommen, Bildung und Beruf entstehe, sondern vielmehr durch milieuspezifische Lebensstile, ‚Geschmäcker’ und Mentalitäten.
In wie weit der Milieuansatz, der sich insbesondere seit den 1980er Jahren in der sozialwissenschaftlichen Debatte in Deutschland durchgesetzt hat, als ein angemessenes Instrument zur Erklärung sozialer Ungleichheit darstellt, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.
Dazu wird zunächst der Begriff ‚soziale Ungleichheit’ definiert und dargestellt, was seine grundlegenden Problematiken sind. Anschließend folgt ein historischer Überblick über die wichtigsten Theorien und Ansätze zur Erklärung sozialer Ungleichheit in Deutschland.
Es folgt im Rahmen dieser Diskussion die Vorstellung des Milieuansatzes und dessen Beitrag zur Erklärung sozialer Ungleichheit, die insbesondere auf der Kapital- und Habitustheorie Bourdieus beruhen. Anschließend werden die Anwendungsmöglichkeiten des Milieuansatzes, dessen Stärken und Schwächen diskutiert und seine Möglichkeiten zur Erklärung sozialer Ungleichheit im Kontext der aktuellen Entwicklungen in Deutschland resümiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Soziale Ungleichheit
- 2.1 Definition und Grundannahmen
- 2.2 Theorien sozialer Ungleichheit: Klassen, Stände und Schichten
- 3. Soziale Milieus
- 3.1 Definition und Grundannahmen
- 3.2 Entstehung sozialer Milieus
- 3.3 Anwendung und Empirie
- 3.4 Kritik
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Angemessenheit des Milieuansatzes als Erklärungsmodell für soziale Ungleichheit. Sie beleuchtet die Definition und die Problematik von sozialer Ungleichheit und gibt einen historischen Überblick über verschiedene Theorien (Klassen, Stände, Schichten). Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des Milieuansatzes, seiner Anwendung, Stärken und Schwächen im deutschen Kontext.
- Definition und Problematik sozialer Ungleichheit
- Historischer Überblick über Theorien sozialer Ungleichheit (Klassen, Stände, Schichten)
- Der Milieuansatz und seine theoretischen Grundlagen (Bourdieu)
- Anwendung und Empirie des Milieuansatzes
- Kritik und Bewertung des Milieuansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema soziale Ungleichheit ein und beschreibt die Forschungsfrage der Arbeit: Inwieweit eignet sich der Milieuansatz zur Erklärung sozialer Ungleichheit? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen. Der Fokus liegt auf der Gegenüberstellung traditioneller Ungleichheitstheorien (Klassen, Stände, Schichten) mit dem neueren Ansatz der sozialen Milieus.
2. Soziale Ungleichheit: Dieses Kapitel definiert den Begriff der sozialen Ungleichheit und beleuchtet dessen grundlegende Problematiken. Es zeigt auf, dass soziale Ungleichheit ein Zustand regelmäßiger und dauerhafter Formen der Begünstigung und Benachteiligung von Menschen darstellt und durch ungleichen Zugang zu sozialen Positionen gekennzeichnet ist. Der normative Charakter der Ungleichheitsforschung wird hervorgehoben, die Betrachtung muss im Kontext der jeweiligen Sozialstruktur und deren historischen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen erfolgen. Die Definition von Solga et al. wird als Grundlage der Arbeit herangezogen.
2.2 Theorien sozialer Ungleichheit: Klassen, Stände und Schichten: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die wichtigsten Theorien zur Erklärung sozialer Ungleichheit. Es beginnt mit antiken Auffassungen von „natürlicher Ungleichheit“ und verfolgt die Entwicklung über das Mittelalter bis zur Aufklärung. Die Kapitel beleuchtet kritisch die Vorstellung einer „gottgegebenen“ Ungleichheit und den Wandel hin zu einer Betonung der „naturrechtlichen Gleichheit“ im 17. Jahrhundert. Der Einfluss von Rousseau und Marx mit ihren jeweiligen Ansätzen zur Erklärung sozialer Ungleichheit durch Privateigentum und unterschiedliche Produktionsverhältnisse werden ausführlich diskutiert.
3. Soziale Milieus: Dieses Kapitel widmet sich dem Milieuansatz als alternativem Erklärungsansatz für soziale Ungleichheit. Es definiert soziale Milieus und deren Grundannahmen, wobei der Fokus auf der subjektiven Seite sozialer Ungleichheit liegt, die sich in milieuspezifischen Lebensstilen, Geschmäckern und Mentalitäten manifestiert. Die Kapitel beleuchtet die Entstehung sozialer Milieus, ihre Anwendung und empirische Forschung sowie kritische Auseinandersetzungen mit dem Ansatz. Die Verbindung zu Bourdieus Kapital- und Habitustheorie wird als zentrale theoretische Grundlage hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Klassen, Stände, Schichten, Milieus, Pierre Bourdieu, Kapital, Habitus, Lebensstil, Ungleichheitsforschung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse Sozialer Ungleichheit anhand des Milieuansatzes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Milieuansatzes als Erklärungsmodell für soziale Ungleichheit. Sie vergleicht den Milieuansatz mit traditionellen Ungleichheitstheorien (Klassen, Stände, Schichten) und analysiert seine Anwendbarkeit und seine Stärken und Schwächen im deutschen Kontext.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und die Problematik sozialer Ungleichheit, gibt einen historischen Überblick über verschiedene Theorien sozialer Ungleichheit (Klassen, Stände, Schichten), beschreibt den Milieuansatz und seine theoretischen Grundlagen (insbesondere Bourdieu), analysiert dessen Anwendung und empirische Forschung und schließlich die Kritik und Bewertung des Milieuansatzes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu sozialer Ungleichheit mit Unterkapiteln zur Definition und den Theorien (Klassen, Stände, Schichten), ein Kapitel zum Milieuansatz mit Unterkapiteln zur Definition, Entstehung, Anwendung, Empirie und Kritik, und ein Fazit. Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit. Jedes Kapitel fasst seine Kernaussagen zusammen.
Welche Theorien sozialer Ungleichheit werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet klassische Theorien wie Klassen-, Stände- und Schichtentheorien, beginnend mit antiken Auffassungen bis hin zu den Ansätzen von Rousseau und Marx. Der Fokus liegt jedoch auf dem Vergleich mit dem neueren Milieuansatz.
Welche Rolle spielt Pierre Bourdieu?
Bourdieus Kapital- und Habitustheorie bildet die zentrale theoretische Grundlage für die Betrachtung des Milieuansatzes. Die Arbeit erläutert den Zusammenhang zwischen Bourdieus Theorie und der Entstehung und Anwendung des Milieuansatzes.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Arbeit (in Kurzform)?
Die Arbeit bewertet die Anwendbarkeit und die Grenzen des Milieuansatzes als Erklärungsmodell für soziale Ungleichheit im Vergleich zu traditionellen Ansätzen. Sie zeigt die Stärken und Schwächen des Milieuansatzes auf und diskutiert die empirische Forschung dazu.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Soziale Ungleichheit, Klassen, Stände, Schichten, Milieus, Pierre Bourdieu, Kapital, Habitus, Lebensstil, Ungleichheitsforschung, Deutschland.
- Quote paper
- Martin Schröter (Author), 2011, "Soziale Milieus" und die Entstehung sozialer Ungleichheit. Ein angemessener Erklärungsansatz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/209608