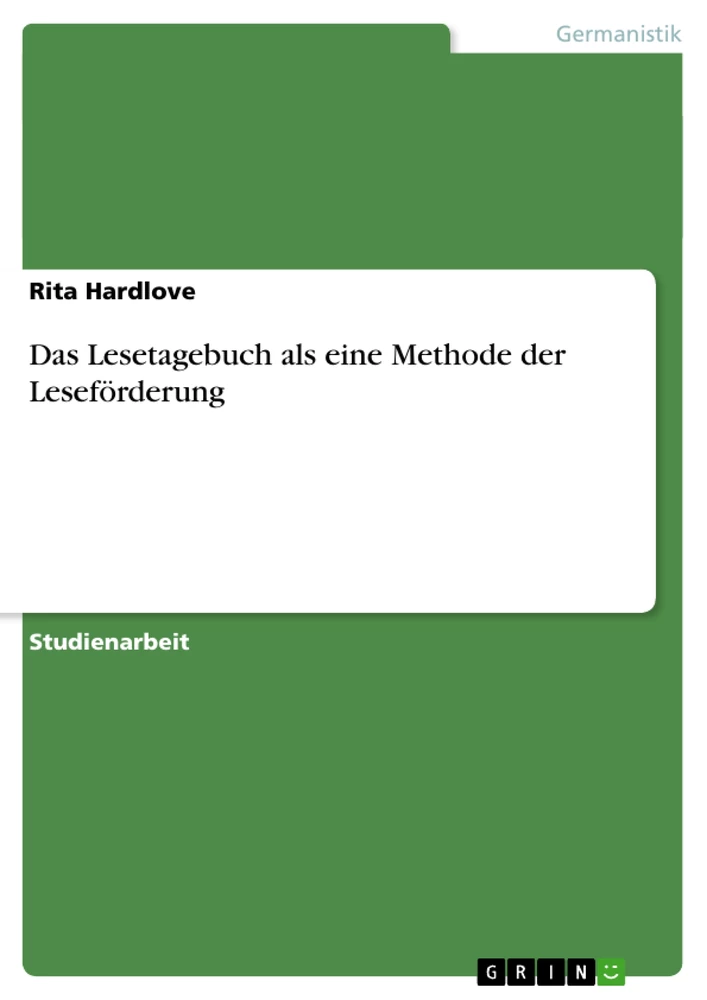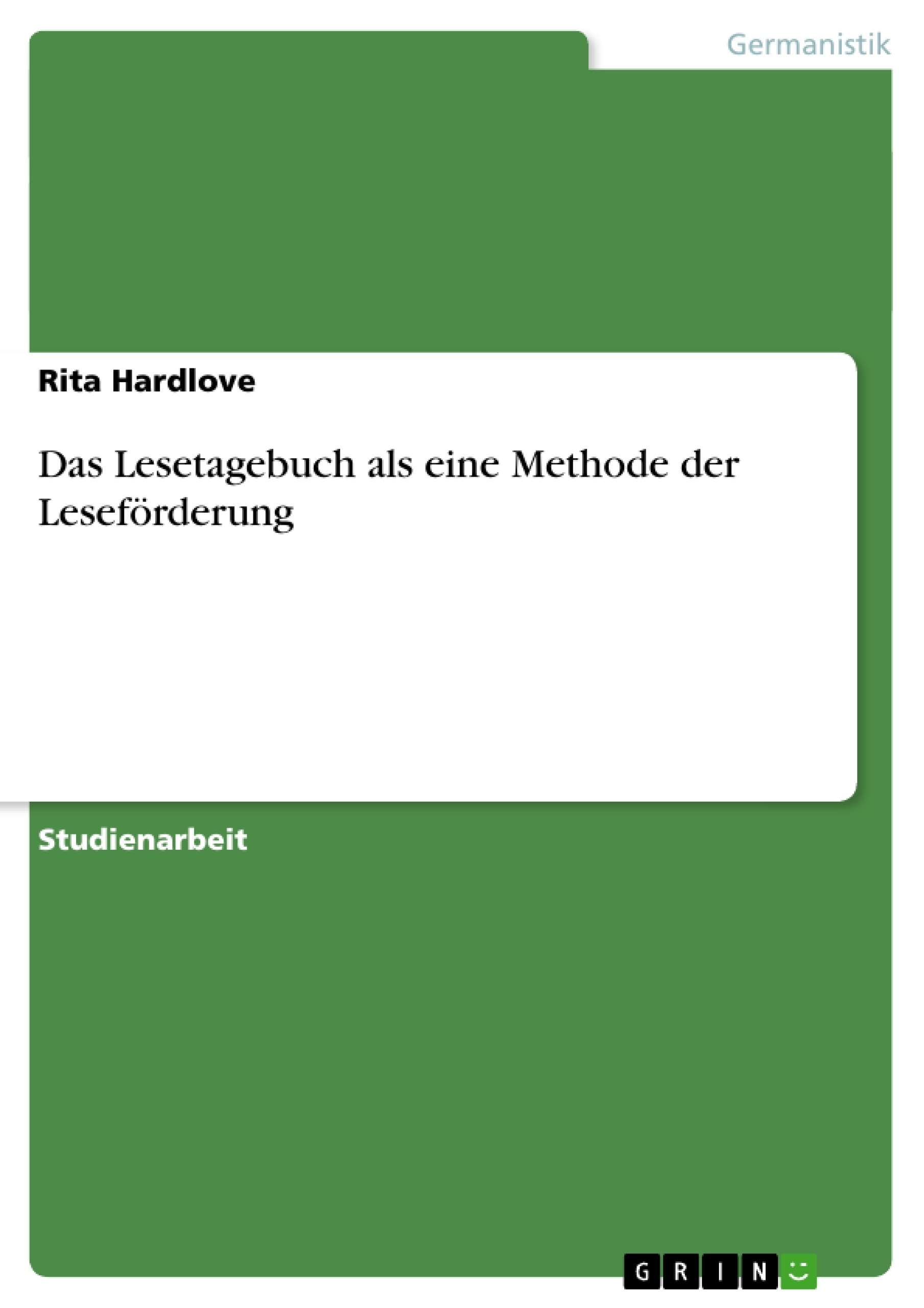Zunehmend werden in der heutigen Gesellschaft Jugendliche zu Nichtlesern. Tatsächlich weist auch die internationale PISA-Studie nach, dass in Deutschland Schülerinnen und Schüler, überwiegend Jugendliche, den Anforderungen des Lesens und Textverständnisses nicht gewachsen sind. Untersuchungen ergaben, dass vorrangig bei Haupt- und Realschülern nach dem 12. Lebensjahr ein Leseknick zu bemerken ist, aber auch Unterschiede des Leseinteresses zwischen Mädchen und Jungen treten verstärkt auf. Als Ursache für diesen Wandel wird u. a. die Dominanz des Fernseh- und anderweitiger elektronischer Medienkonsum beigemessen. (vgl. Hintz 2011, S. VII, 9, 70)
Zumal das Lesen selbstverständlich zur Bildungsteilhabe gehört und für den alltäglichen Gebrauch, wie auch in der heutigen Medienkultur von praktischer Bedeutung ist, steht die Schule vor einer großen Herausforderung den Schülern Zugang zur Literatur zu ermöglichen, ihre Lesefreude zu wecken und sie vermehrt zu einem privaten Lesen zu ermutigen (vgl. Hurrelmann/Elias 1998, S.3; vgl. Hintz 2011, S.60,70).
Um das Lesen den Schülern interessant und ansprechend nahezubringen, gibt es dazu verschiedene Methoden, die in der Schule angewandt werden. Eine Alternative davon bietet das ‚Lesetagebuch’. Dazu bot mir das Seminar ‚Schreibaufgaben und Schreibprozesse’ die Möglichkeit mich mit der Methodik des Lesetagebuchs zu beschäftigen und diese mit einer Kommilitonin in einem Referat vorzustellen. Insofern bezieht sich die vorliegende Hausarbeit im Wesentlichen auf eine Referatsausarbeitung.
Neben dem Ziel das Lesetagebuch als eine mögliche Methodenalternative vorzustellen, werde ich zunächst einmal auf die Leseförderung eingehen. Zum Lesetagebuch allgemein, seinen Aufbau und Funktion werde ich anschließend darstellen und mithilfe von Beispielen veranschaulichen. Darauffolgend möchte ich näher auf die Bewertung der Lesetagebucheinträge eingehen und im Anschluss eine kurze Vorstellung der Forschungsergebnisse geben. Abschließend folgt eine eigene Stellungnahme zum gesamten Thema.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Leseförderung
- 3. Das Lesetagebuch als eine Methode der Leseförderung
- 3.1 Welchen Zweck erfüllt das Lesetagebuch bei der Leseförderung?
- 3.2 Aufbau und Inhalt eines Lesetagebuches
- 3.3 Ziel und Zweck des Lesetagebuchs
- 3.4 Bezug zum Bildungsplan
- 3.5 Lehrerfunktion
- 4. Bewertung von Lesetagebüchern
- 5. Schülerbeispiele und Anregungen
- 6. Umsetzungsbeispiele aus Sekundarstufen
- 7. Forschungsergebnisse
- 8. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Lesetagebuch als Methode der Leseförderung. Ziel ist es, die Methodik des Lesetagebuchs vorzustellen und deren Einsatz im Unterricht zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet den Aufbau und die Funktion des Lesetagebuchs, geht auf dessen Bewertung ein und präsentiert Forschungsergebnisse.
- Leseförderung im Kontext sinkender Lesekompetenz
- Das Lesetagebuch als Methode der Leseförderung
- Aufbau und Funktion des Lesetagebuchs
- Bewertung von Lesetagebüchern
- Umsetzung des Lesetagebuchs in der Sekundarstufe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext sinkender Lesekompetenz bei Jugendlichen, insbesondere im Hinblick auf die PISA-Studie und den Einfluss elektronischer Medien. Sie führt in die Thematik des Lesetagebuchs als Methode der Leseförderung ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Herausstellung des Problems der Lesekompetenz und der Notwendigkeit von effektiven Fördermethoden.
2. Leseförderung: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung von Leseförderung im schulischen Kontext. Es diskutiert die Notwendigkeit einer familienergänzenden Rolle der Schule und beschreibt verschiedene Stufen der Leseförderung, beginnend mit der Weckung von Neugierde und Lesebedürfnissen bis hin zur Präsentation von Leseerfahrungen. Besonderer Wert wird auf die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Interessen der Schüler gelegt, um eine nachhaltige Lesemotivation zu erreichen. Die Ausführungen betonen den Zusammenhang zwischen Lesefähigkeit, Lesemotivation und dem Verständnis literarischer Texte. Der Bezug zu den individuellen Bildungsprozessen der Schüler wird hervorgehoben.
3. Das Lesetagebuch als eine Methode der Leseförderung: Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Beschreibung des Lesetagebuchs als Methode der Leseförderung. Es erläutert den Zweck des Lesetagebuchs, seinen Aufbau und Inhalt, sowie seine Ziele und den Bezug zum Bildungsplan. Die Rolle des Lehrers bei der Umsetzung und Bewertung der Lesetagebücher wird ebenfalls thematisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des Lesetagebuchs als ein handlungs- und produktionsorientiertes Verfahren, das die aktive Auseinandersetzung der Schüler mit Texten fördert.
4. Bewertung von Lesetagebüchern: Kapitel 4 fokussiert auf die Kriterien für die Bewertung von Lesetagebüchern. Es wird auf die methodischen Ansätze der Bewertung eingegangen und zeigt auf, wie die Lehrer die Lesetagebücher der Schüler effektiv evaluieren können. Der Abschnitt betont die Notwendigkeit einer angemessenen und motivierenden Bewertungspraxis, die die individuellen Fortschritte der Schüler würdigt und gleichzeitig Anreize für weitere Leseaktivitäten bietet.
5. Schülerbeispiele und Anregungen: Kapitel 5 präsentiert exemplarische Schülerbeiträge und gibt konkrete Anregungen zur Gestaltung von Lesetagebüchern. Der Fokus liegt hier auf der praktischen Umsetzung und der Illustration der beschriebenen Methodik. Die Schülerbeispiele dienen dazu, die vielfältigen Möglichkeiten des Lesetagebuchs zu veranschaulichen und Lehrern und Schülern konkrete Inspirationen zu liefern.
6. Umsetzungsbeispiele aus Sekundarstufen: In Kapitel 6 werden konkrete Beispiele für die Umsetzung des Lesetagebuchs in der Sekundarstufe I und II vorgestellt. Es beleuchtet unterschiedliche didaktische Ansätze und zeigt die Adaption der Methode an verschiedene Altersgruppen und Lerngruppen auf. Die Kapitel beschreibt die verschiedenen Erfahrungen und Herausforderungen, die mit der Implementierung des Lesetagebuchs in der Praxis einhergehen.
7. Forschungsergebnisse: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über relevante Forschungsergebnisse zum Thema Lesetagebuch und Leseförderung. Es werden wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse zusammengefasst und in Bezug zur beschriebenen Methodik gesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit der bestehenden Forschung und der Ableitung von Implikationen für die Praxis.
Häufig gestellte Fragen zum Lesetagebuch als Methode der Leseförderung
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend das Lesetagebuch als Methode zur Leseförderung. Sie beleuchtet die Methodik, den Einsatz im Unterricht, den Aufbau und die Funktion des Lesetagebuchs, dessen Bewertung und präsentiert relevante Forschungsergebnisse. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Lesekompetenz, insbesondere im Kontext sinkender Leseleistung bei Jugendlichen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Leseförderung im Kontext sinkender Lesekompetenz, das Lesetagebuch als Methode der Leseförderung, Aufbau und Funktion des Lesetagebuchs, Bewertung von Lesetagebüchern und die Umsetzung des Lesetagebuchs in der Sekundarstufe. Zusätzlich werden Schülerbeispiele, Anregungen und Forschungsergebnisse präsentiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Leseförderung, Das Lesetagebuch als Methode der Leseförderung (inkl. Unterkapitel zu Zweck, Aufbau, Inhalt, Zielen, Bezug zum Bildungsplan und Lehrerfunktion), Bewertung von Lesetagebüchern, Schülerbeispiele und Anregungen, Umsetzungsbeispiele aus Sekundarstufen, Forschungsergebnisse und Resümee. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Welchen Zweck erfüllt das Lesetagebuch laut der Arbeit?
Das Lesetagebuch dient als Methode der Leseförderung, indem es die aktive Auseinandersetzung der Schüler mit Texten fördert. Es ermöglicht die Dokumentation von Leseerfahrungen, die Reflexion über gelesene Inhalte und die Entwicklung von Lesestrategien. Es ist ein handlungs- und produktionsorientiertes Verfahren.
Wie wird das Lesetagebuch aufgebaut und bewertet?
Der Aufbau des Lesetagebuchs wird detailliert beschrieben und beinhaltet konkrete Beispiele. Die Bewertung der Lesetagebücher erfolgt nach spezifischen Kriterien, die eine angemessene und motivierende Bewertungspraxis gewährleisten, welche die individuellen Fortschritte der Schüler würdigt und Anreize für weitere Leseaktivitäten bietet.
Welche Rolle spielt der Lehrer bei der Umsetzung des Lesetagebuchs?
Der Lehrer spielt eine wichtige Rolle bei der Einführung, Anleitung und Bewertung des Lesetagebuchs. Er unterstützt die Schüler bei der Gestaltung ihrer Einträge und gibt Feedback zu ihren Fortschritten. Die Lehrerfunktion umfasst die methodische Begleitung und die motivierende Bewertung der Schülerarbeiten.
Welche Forschungsergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit fasst relevante Forschungsergebnisse zum Thema Lesetagebuch und Leseförderung zusammen. Sie setzt sich kritisch mit der bestehenden Forschung auseinander und leitet Implikationen für die Praxis ab.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrer, Lehramtsstudenten, Schulbibliothekare und alle, die sich mit Leseförderung und der Verbesserung der Lesekompetenz bei Schülern beschäftigen. Sie bietet praktische Anleitungen und theoretische Grundlagen zur effektiven Umsetzung des Lesetagebuchs im Unterricht.
Wo finde ich konkrete Beispiele für die Umsetzung des Lesetagebuchs in der Sekundarstufe?
Konkrete Umsetzungsbeispiele für die Sekundarstufe I und II werden in einem eigenen Kapitel vorgestellt. Dieses Kapitel beleuchtet unterschiedliche didaktische Ansätze und zeigt die Adaption der Methode an verschiedene Altersgruppen und Lerngruppen auf. Es beschreibt auch die Erfahrungen und Herausforderungen bei der Implementierung in der Praxis.
Wie wird die sinkende Lesekompetenz in der Arbeit thematisiert?
Die sinkende Lesekompetenz, insbesondere im Kontext der PISA-Studie und des Einflusses elektronischer Medien, wird als Ausgangspunkt und Begründung für die Notwendigkeit effektiver Fördermethoden wie des Lesetagebuchs dargestellt. Die Arbeit betont den Zusammenhang zwischen Lesefähigkeit, Lesemotivation und dem Verständnis literarischer Texte.
- Quote paper
- Rita Hardlove (Author), 2012, Das Lesetagebuch als eine Methode der Leseförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/209145