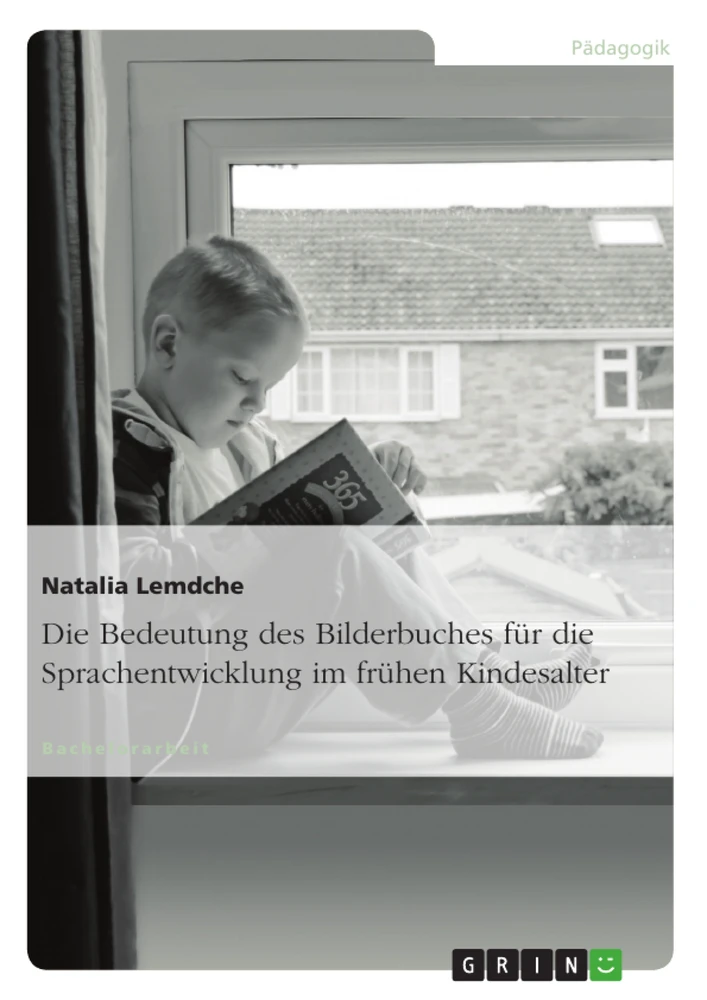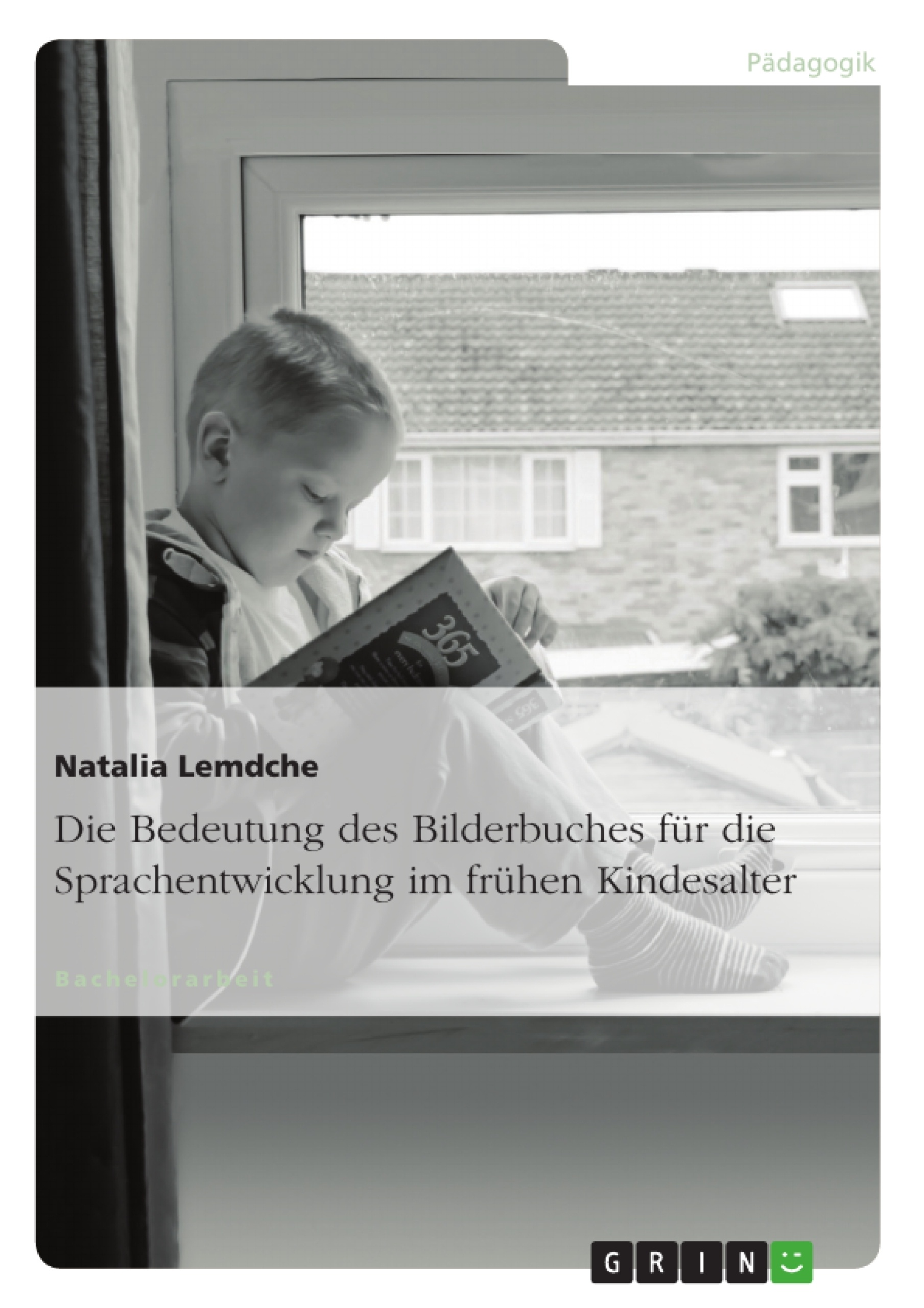Die Bedeutung des Bilderbuches für die Sprachentwicklung im frühen Kindesalter
Einleitung
Ein Bilderbuch ist für eine Kinderstube ein ebenso wesentlicheres und noch unentbehrlicheres Meuble als eine Wiege, Puppe oder das Ste-ckenpferd. Diese Wahrheit kennt jeder Vater, jede Mutter, jeder, der Kinder erzogen hat, und von Locke an bis auf Basedow, Campe und Salzmann empfiehlt jeder vernünftige Pädagog, den frühesten Unter-richt des Kindes durchs Auge anzufangen, und ihm so viel gute und richtige Bilder und Figuren, als man kann, vor Gesicht zu bringen.
(Friedrich Justin Bertuch 1790: 438, zitiert nach Niermann 1979: 7)
Die vermittelnde und kommunikative Struktur der Bilderbücher geriet bereits im 17. Jahrhun-dert ins Blickfeld der Pädagogik. 1658 brachte Comenius das erste Bildwörterbuch der Welt, den „Orbis sensualium pictus“ mit dem Ziel heraus, den Kindern das Erlernen der lateinischen Sprache durch bildliche Vorstellungen zu einer Spielbeschäftigung zu machen und dadurch auf eine angenehme Weise zu erleichtern (vgl. Rosenfeld 1964: Nachwort). Dieser war der erste Best- und Longseller der Kinder- und Jugendliteratur und wurde für die Entwicklung des Bilderbuches im 17. und 18. Jahrhundert richtungsgebend (vgl. Doderer/Müller 1973: 43). In den nächsten Jahren entstanden zahlreiche Nachfolgewerke wie Johann Bernhard Basedows „Elementarwerk“ (1770–1774), Johann Siegmund Stoys „Bilder-Akademie für die Jugend“ (1780), Christian Gotthilf Salzmanns „Moralisches Elementarbuch“, bis hin zu Friedrich Jus-tin Bertuchs „Bilderbuch für Kinder“ (1790–1822) (vgl. Dierks 1965: 27ff.). Mit Bertuch wurde der Begriff Bilderbuch zum ersten Mal als Titel eines illustrierten Werkes für Kinder gebraucht (vgl. Minke 1958: 5). Auch das Familienbuch „Mutter- und Koselieder“ (1844) von Friedrich Fröbel darf nicht übersehen werden, das durch die Einheit von Bild, Text und Musik zum gemeinsamen Anschauen und Spielen, zu einer Begegnung mit Kunst und Dichtung anregt. All diese Werke wurden mit dem gleichen Anliegen geschaffen, den Kindern die Welt näher-zubringen – wenn auch zunächst mit mäßiger Qualität und nicht in systematischer Weise – und sie dabei mit allen Sinnen anzusprechen. Die gemeinsame Bilderbuchbetrachtung stellt eine der effektivsten Formen der Sprachförderung im frühen Kindesalter dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsexplikation „Bilderbuch“
- Bilderbuchbetrachtung und Vorlesen als besondere Dialogform
- Bilderbuchbetrachtung und Vorlesen als Basis für eine tragfähige Beziehung
- Entwicklungspsychologische Forschungsperspektiven zur Bedeutung von Bildern
- Bilderbucharten
- Bilderbuchgattungen
- Bildgestaltung
- Text-Bild-Verknüpfungen
- Allererste Bilderbücher
- Nachfolgende Bilderbücher
- Ein Zwischenfazit
- Spracherwerbstheorien
- Lerntheoretische Konzeptionen
- Nativistische Konzeptionen
- Kognitivistische Konzeptionen
- Interaktionistische Konzeptionen
- Ein Zwischenfazit
- Die Bedeutung des Bilderbuches für die kindliche Sprachentwicklung
- Dimensionen der kindlichen Sprachentwicklung
- Phonologische Entwicklung
- Grammatisch-syntaktische Entwicklung
- Wortschatzentwicklung
- Entwicklung konversationeller und diskursiver Fähigkeiten
- Phraseologieerwerb
- Ein Zwischenfazit
- Wie trägt das Bilderbuch zur sprachlichen Entwicklung bei?
- Phonologische Bewusstheit
- Wortschatz und Grammatik
- Entwicklung des Bewusstseins über Sprachstil und Textsorten
- Konversationelle und diskursive Fähigkeiten
- Phraseologieerwerb
- Ein Zwischenfazit
- Dimensionen der kindlichen Sprachentwicklung
- Analyse des Bilderbuches von Anne Heseler „Der dicke fette Pfannkuchen“
- Methodische Vorgehensweise und Zielsetzung
- Analyse des Bilderbuches
- Didaktische Handhabung
- Fazit
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Bilderbüchern für die Sprachentwicklung im frühen Kindesalter. Ziel ist es, die Rolle des Bilderbuches bei der Sprachförderung aufzuzeigen und didaktische Konsequenzen abzuleiten. Die Arbeit analysiert verschiedene Spracherwerbstheorien und untersucht anhand des Beispiels "Der dicke fette Pfannkuchen" von Anne Heseler, wie Bilderbücher die sprachliche Entwicklung in ihren verschiedenen Dimensionen (Phonologie, Grammatik, Wortschatz, Diskursfähigkeit) unterstützen können.
- Die Bedeutung von Bilderbüchern für die Sprachförderung im frühen Kindesalter
- Analyse verschiedener Spracherwerbstheorien im Kontext von Bilderbüchern
- Die Rolle von Bildgestaltung und Text-Bild-Verknüpfungen
- Didaktische Implikationen für die Arbeit mit Bilderbüchern
- Fallstudie: Analyse des Bilderbuches "Der dicke fette Pfannkuchen"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die historische Bedeutung von Bilderbüchern in der Pädagogik, beginnend mit Comenius' "Orbis sensualium pictus". Sie hebt die Forschungslücke bezüglich des Zusammenhangs zwischen Kinderliteratur und Spracherwerb hervor und formuliert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit, die sich auf die Beiträge von Bilderbüchern zur Sprachentwicklung, die Auswahl geeigneter Bilderbücher und die daraus resultierenden didaktischen Konsequenzen konzentrieren. Die Einleitung legt die drei Hauptthesen der Arbeit dar: Bilderbücher bieten spezifischen Input für den Spracherwerb, unterstützende Informationen für erfolgreiches Lernen und fördern den Spracherwerb durch interaktive Kommunikation.
Begriffsexplikation „Bilderbuch“: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Bilderbuch" und beleuchtet seine verschiedenen Facetten. Es wird dargestellt, was ein Bilderbuch ausmacht und wie es sich von anderen Medien unterscheidet. Die Definition und Abgrenzung des Begriffs bildet die Grundlage für die spätere Analyse.
Bilderbuchbetrachtung und Vorlesen als besondere Dialogform / Bilderbuchbetrachtung und Vorlesen als Basis für eine tragfähige Beziehung: Diese Kapitel untersuchen die interaktive Dimension des Bilderbuchlesens. Sie analysieren die gemeinsame Betrachtung von Bilderbüchern als Dialogform und deren Bedeutung für den Aufbau einer positiven Beziehung zwischen Kind und Vorleser. Die Interaktion wird als entscheidender Faktor für den Spracherwerb hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der kommunikativen Funktion des Bilderbuches und dem gemeinsamen Erlebnis.
Entwicklungspsychologische Forschungsperspektiven zur Bedeutung von Bildern: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Bildern aus entwicklungspsychologischer Perspektive. Es wird erörtert, wie Bilder die kognitive und sprachliche Entwicklung von Kindern fördern und welche Relevanz sie für den Verarbeitungsprozess von Informationen haben. Die verschiedenen Stadien der kindlichen Entwicklung und deren Bezug zu den Bildern werden beleuchtet.
Bilderbucharten: Hier werden verschiedene Arten von Bilderbüchern und deren Merkmale (Gattungen, Bildgestaltung, Text-Bild-Verknüpfungen) vorgestellt. Der Überblick dient als Grundlage für die spätere Auswahl geeigneter Bilderbücher für die Sprachförderung und berücksichtigt die Entwicklungsstufen des Kindes. Verschiedene Klassifizierungen und Ansätze werden verglichen.
Spracherwerbstheorien: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Spracherwerbstheorien (lerntheoretisch, nativistisch, kognitivistisch, interaktionistisch), um den theoretischen Rahmen für die Analyse der Bedeutung von Bilderbüchern zu liefern. Die verschiedenen Theorien werden im Hinblick auf ihre Relevanz für den Spracherwerb durch Bilderbücher diskutiert und verglichen.
Die Bedeutung des Bilderbuches für die kindliche Sprachentwicklung: Kapitel 6 analysiert, wie Bilderbücher verschiedene Dimensionen der kindlichen Sprachentwicklung (phonologisch, grammatikalisch-syntaktisch, lexikalisch, konversationell, phraseologisch) positiv beeinflussen. Es wird dargelegt, wie Bilderbücher zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, des Wortschatzes, der Grammatik und der kommunikativen Fähigkeiten beitragen. Die einzelnen Aspekte der Sprachentwicklung werden im Zusammenhang mit der Bilderbuchbetrachtung analysiert.
Schlüsselwörter
Bilderbuch, Sprachentwicklung, frühes Kindesalter, Spracherwerbstheorien, Sprachförderung, Interaktion, Kommunikation, Bilderbuchdidaktik, phonologische Bewusstheit, Wortschatzentwicklung, Grammatik, Analyse, Anne Heseler, "Der dicke fette Pfannkuchen".
Häufig gestellte Fragen zu der Bachelorarbeit: "Die Bedeutung von Bilderbüchern für die kindliche Sprachentwicklung"
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedeutung von Bilderbüchern für die Sprachentwicklung im frühen Kindesalter. Sie analysiert die Rolle von Bilderbüchern bei der Sprachförderung und leitet daraus didaktische Konsequenzen ab.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist es, aufzuzeigen, wie Bilderbücher die sprachliche Entwicklung von Kindern unterstützen. Die Arbeit analysiert verschiedene Spracherwerbstheorien und untersucht anhand einer Fallstudie (das Bilderbuch "Der dicke fette Pfannkuchen" von Anne Heseler), wie Bilderbücher die phonologische, grammatikalisch-syntaktische, lexikalische und konversationelle Entwicklung fördern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Bilderbüchern für die Sprachförderung, der Analyse verschiedener Spracherwerbstheorien im Kontext von Bilderbüchern, der Rolle von Bildgestaltung und Text-Bild-Verknüpfungen, didaktischen Implikationen für die Arbeit mit Bilderbüchern und einer Fallstudie zur Analyse des Bilderbuchs "Der dicke fette Pfannkuchen".
Welche Spracherwerbstheorien werden betrachtet?
Die Arbeit berücksichtigt lerntheoretische, nativistische, kognitivistische und interaktionistische Spracherwerbstheorien und diskutiert deren Relevanz für den Spracherwerb durch Bilderbücher.
Wie wird die Bedeutung von Bildern für die kindliche Entwicklung beleuchtet?
Aus entwicklungspsychologischer Perspektive wird untersucht, wie Bilder die kognitive und sprachliche Entwicklung von Kindern fördern und welche Relevanz sie für den Verarbeitungsprozess von Informationen haben. Die verschiedenen Stadien der kindlichen Entwicklung und deren Bezug zu Bildern werden beleuchtet.
Welche Aspekte der Sprachentwicklung werden im Zusammenhang mit Bilderbüchern analysiert?
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Bilderbüchern auf verschiedene Dimensionen der kindlichen Sprachentwicklung: phonologische Entwicklung, grammatikalisch-syntaktische Entwicklung, Wortschatzentwicklung, Entwicklung konversationeller und diskursiver Fähigkeiten sowie Phraseologieerwerb.
Wie wird das Bilderbuch "Der dicke fette Pfannkuchen" analysiert?
Das Bilderbuch wird mithilfe einer detaillierten Analysemethode untersucht, die methodische Vorgehensweise und Zielsetzung werden explizit dargelegt. Die Analyse umfasst die Betrachtung der Bildgestaltung, des Textes und der Text-Bild-Verknüpfungen sowie didaktische Überlegungen zur Handhabung des Buches im pädagogischen Kontext.
Welche didaktischen Konsequenzen werden abgeleitet?
Die Arbeit leitet aus den Forschungsergebnissen didaktische Konsequenzen für die Arbeit mit Bilderbüchern in der Sprachförderung ab. Es werden Hinweise zur Auswahl geeigneter Bilderbücher und deren Einsatz im Unterricht gegeben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bilderbuch, Sprachentwicklung, frühes Kindesalter, Spracherwerbstheorien, Sprachförderung, Interaktion, Kommunikation, Bilderbuchdidaktik, phonologische Bewusstheit, Wortschatzentwicklung, Grammatik, Analyse, Anne Heseler, "Der dicke fette Pfannkuchen".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Begriffsexplikation „Bilderbuch“, Bilderbuchbetrachtung und Vorlesen als Dialogform, entwicklungspsychologische Perspektiven, Bilderbucharten, Spracherwerbstheorien, Bedeutung des Bilderbuches für die kindliche Sprachentwicklung, Analyse von "Der dicke fette Pfannkuchen" und Schlussbetrachtung.
- Quote paper
- Natalia Lemdche (Author), 2012, Die Bedeutung des Bilderbuches für die Sprachentwicklung im frühen Kindesalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/208829