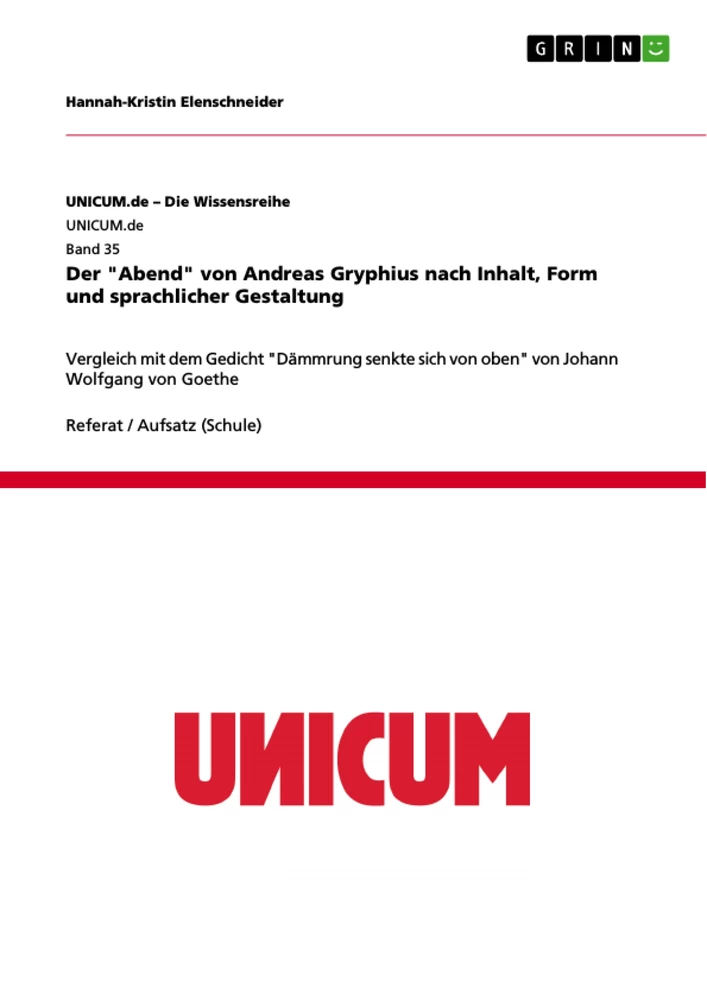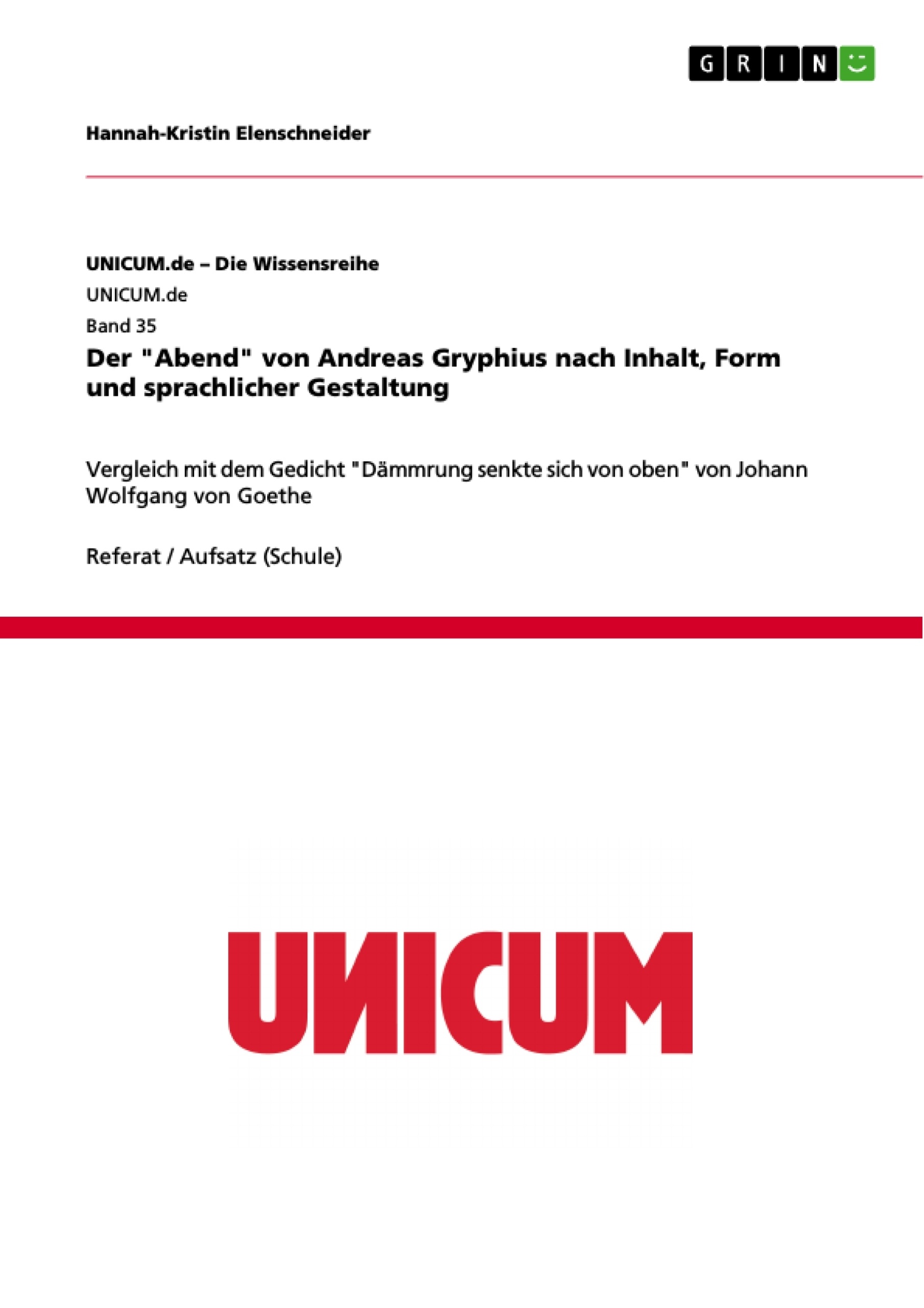A. Allgemeine Informationen zum Gedicht „Abend" von Andreas Gryphius
B. Interpretation des Gedichts „Abend" von Andreas Gryphius im Vergleich mit dem Gedicht „Dämmrung senkte sich von oben" von Johann Wolfgang von Goethe
I. Beschreibung von Inhalt und Aufbau
1. Überblick
2. 1. Quartett: Allgemeine Beschreibung des irdischen Alltags
3. 2. Quartett: Darstellung des Tagesablaufs und des Lebenslauf
4. 1. Terzett: Bitte an Gott um Hilfe und Schutz im irdischen Leben
5. 2. Terzett: Bitte an Gott um Erlösung im Jenseits
II. Untersuchung der formalen und sprachlich-stilistischen Gestaltung
1. Formale Gestaltung
1.1. Gedichtform: Sonett
1.2. Strophenform: Zwei Quartette und zwei Terzette
1.3. Versform: Zeilenstil und Enjambements
2. Sprache und Stil
2.1. Klarheit der Reimform
2.2. Eindringlichkeit durch Klangfiguren
2.3. Anschaulichkeit durch bildliche Stilmittel
2.4. Syntaktische Besonderheiten
III. Deutung
1. Position des lyrischen Ich
2. Motivik
IV. Formale und sprachlich-stilistische Unterschiede der beiden Gedichte
V. Differente Gestaltung des Motivs „Abend" in beiden Gedichten
C. Zusammenfassung
Inhaltsverzeichnis
- I.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- II.
- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.
- 2.
- 2.1.
- 2.2.
- 2.3.
- 2.4.
- III.
- 1.
- 2.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Gedicht „Abend.“ von Andreas Gryphius ist ein Sonett, das sich mit dem Thema der Vergänglichkeit des Lebens und dem Glauben an die Erlösung auseinandersetzt. Das Gedicht erforscht die menschliche Erfahrung der Zeit, den Tod und die Hoffnung auf eine jenseitige Existenz. Die Analyse des Gedichts soll Einblicke in die poetischen Mittel und die philosophische Denkweise des Barock bieten.
- Die Vergänglichkeit des Lebens
- Die Bedeutung des Todes
- Die Hoffnung auf Erlösung
- Die Rolle des Glaubens im Angesicht der Vergänglichkeit
- Die Verwendung von Bildsprache und Metaphern zur Veranschaulichung abstrakter Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
I.
Der erste Teil des Gedichts beschreibt die Vergänglichkeit des Lebens anhand von Naturbildern. Der „schnelle Tag“ (V. 1) weicht der Nacht, die „fahnen schwingend“ (V. 2) die Sterne aufsteigen lässt. Die Menschen, „müde“ (V. 2) von ihrer Arbeit, kehren nach Hause zurück. Die Einsamkeit der Abendlandschaft spiegelt die Trauer über die vergängliche Zeit wider. Die zweite Strophe vergleicht das Leben mit einer Seefahrt, die dem Hafen des Todes entgegenführt. Der „Kahn“ (V. 5) der menschlichen Glieder nähert sich dem „port“ (V. 5), der das Ende des irdischen Lebens symbolisiert. Das Gedicht stellt die Vergänglichkeit allen Lebens fest und unterstreicht den unaufhaltsamen Lauf der Zeit.
II.
Der zweite Teil des Gedichts richtet sich an Gott und fleht um Beistand auf dem Lebenslaufplatz. Die Angst vor den Versuchungen der „Pracht“ (V. 10) und „Lust“ (V. 10) sowie Leid („Ach“) und „Angst“ (V. 10) soll durch Gottes „ewig heller glantz“ (V. 11) gemildert werden. Der Tod wird als „entschlafen“ (V. 12) beschrieben und die Hoffnung auf Erlösung im Jenseits wird ausgedrückt. Das Motiv des „Abend“ (V. 13), das im ersten Teil als Symbol für die Vergänglichkeit eingeführt wurde, kehrt hier wieder und verstärkt die Sehnsucht nach dem ewigen Licht.
III.
Die Haltung des lyrischen Ich ist geprägt von existentieller Betroffenheit und einem tiefen Glauben an Gott und die Erlösung. Der Abend dient als Metapher für den Lebensabend und die Vergänglichkeit. Der Tod ist das zentrale Thema des Gedichts, das die menschliche Erfahrung der Zeit, den Glauben an die Erlösung und die Sehnsucht nach dem ewigen Licht beleuchtet.
Schlüsselwörter
Das Gedicht „Abend.“ von Andreas Gryphius thematisiert die Vergänglichkeit, den Tod, die Erlösung, den Glauben, die Zeit, den Abend und die Bildsprache.
- Arbeit zitieren
- Hannah-Kristin Elenschneider (Autor:in), 2003, Der "Abend" von Andreas Gryphius nach Inhalt, Form und sprachlicher Gestaltung, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/208658