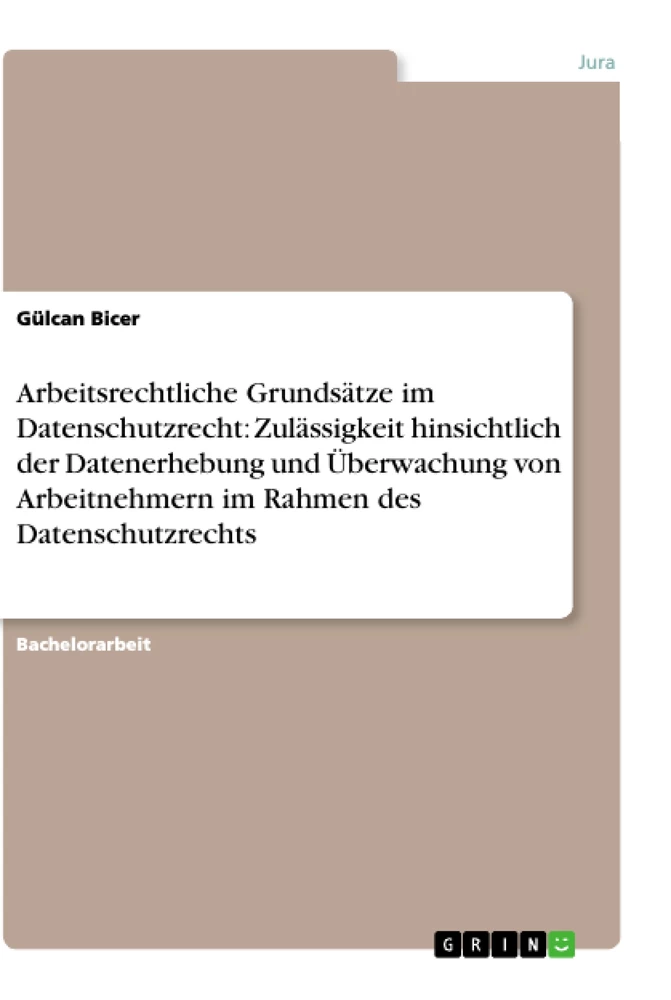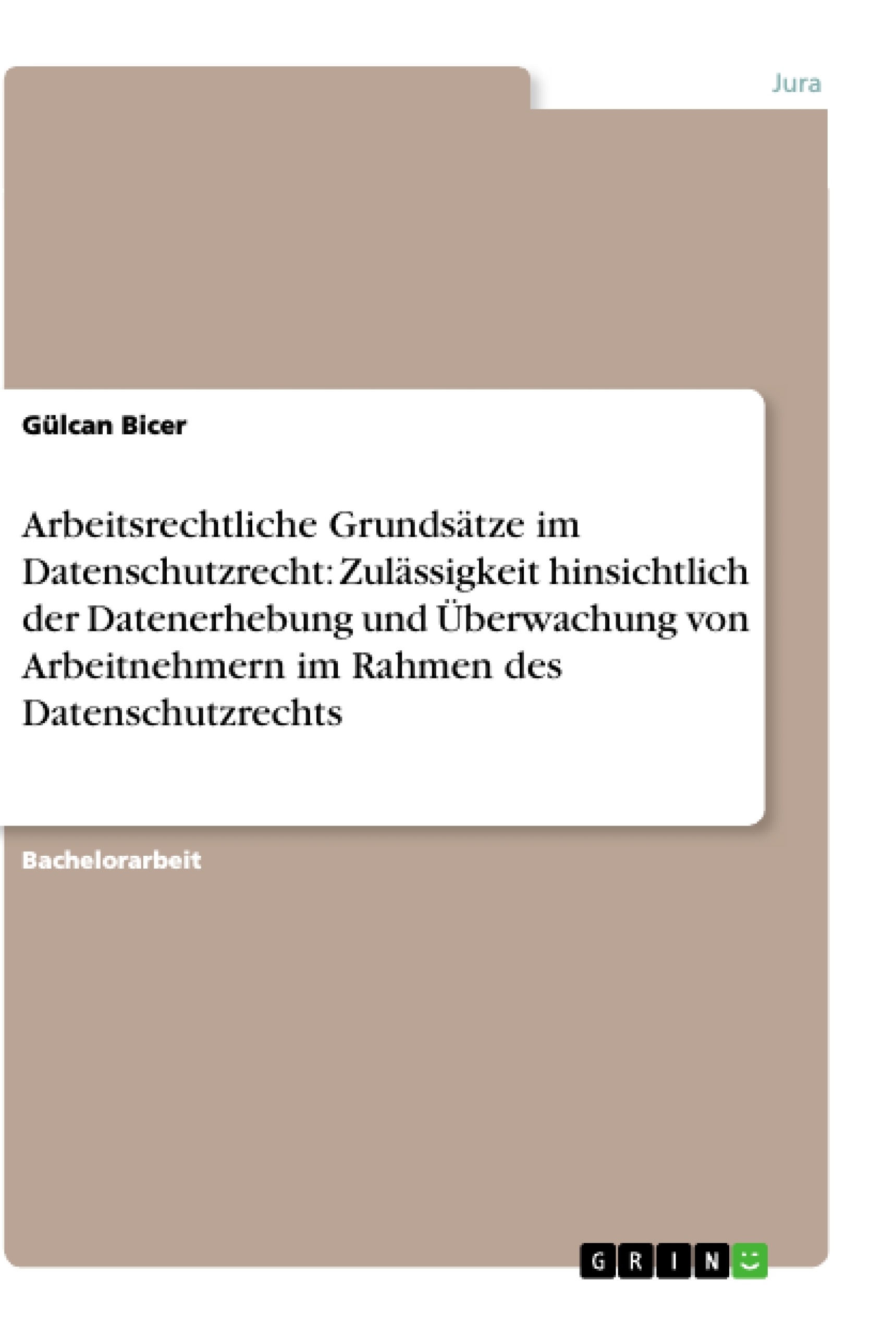Ist die Datenerhebung und Überwachung von Arbeitnehmern zulässig?
Im Datenschutz werden hauptsächlich personenbezogene und besondere personenbezogene Daten, welches erhoben, verarbeitet oder genutzt wird, geschützt. Das Datenschutzrecht wurde am 1.09.2009 reformiert. Dies geschah aufgrund der Datenschutzskandale bei Lidl, Telekom und Deutsche Bahn. Damit wurde von vielen Arbeitnehmern das Persönlichkeitsrecht verletzt, was verfassungsrechtlich fest garantiert ist vgl. Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 GG. Das Persönlichkeitsrecht wurde durch das Mithören der dienstlichen oder privaten Telefonate und über die Videoüberwachung an nicht zulässigen Stellen verletzt. Grundsätzlich galt das Datenschutzrecht durch den § 28 BDSG sehr allgemein. Durch die Reformierung wurde die Vorschrift § 32 BDSG eingefügt, welches sich wesentlich auf das Arbeitsrecht erstreckt und die Betroffenen Arbeitnehmer die gem. § 3 Abs. 11 BDSG erfasst sind, Anwendung findet. § 32 BDSG gilt für alle Beschäftigten gem. § 3 Abs. 11 BDSG. Der Begriff für die Beschäftigten ist nach dieser Norm weiter gefasst als des Arbeitnehmers. Es werden nicht nur Arbeitnehmer erfasst, sondern auch (Auszubildende, Personen in Fortbildung/ Umschulung), Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Ein-Euro-Jobber), arbeitnehmerähnliche Personen, Beamte Richter und Soldaten (auch Zivildienstleistende) sowie Bewerber. Das Datenschutzrecht erfordert eine wirksame Einwilligung des Betroffenen. Die Einwilligung muss auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruhen. Eine Einwilligung muss grundsätzlich schriftlich erfolgen. Abweichungen in den Formalitäten der Einwilligung sind zulässig, wenn Eilbedürftigkeit besteht. Bei der Eilbedürftigkeit sollte eine mündliche oder fernmündliche Einwilligung, wie z.B. bei Telefoninterviews ausreichen. Bei einer Verletzung des Betroffenen hat das Datenschutzrecht Ansprüche auf Benachrichtigung, Sperrung, Löschung, Berichtigung, Auskunft und Schadensersatz zuerkannt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung zum Thema Datenschutzrecht
- B. Das BDSG
- I. Voraussetzungen für die Anwendung des BDSG
- II. Personenbezogene Daten
- 1. Besondere personenbezogene Daten
- 2. Daten über Beschäftigte.
- 3. Anonymisierte und pseudonymisierte Daten
- 4. Erheben, Verarbeiten und Nutzen
- III. Einwilligung
- 1.Formale Wirksamkeitsvoraussetzungen der Einwilligung
- 2. Inhaltliche Wirksamkeitsvoraussetzungen der Einwilligung
- IV. Der Vorbehalt des § 32 BDSG
- 1. Die Datenerhebung vor und im Beschäftigungsverhältnis
- 2. Der Begriff der Erforderlichkeit
- C. Die EG-Datenschutzrichtlinie 95/46
- D. Der Datenschutz in Unternehmen
- I. Kontrollrechte des Arbeitgebers
- II. Die Videobeobachtung
- 1. Die öffentlich zugänglichen Räume
- 2. Die nicht öffentlich zugänglichen Räume
- 23. Die heimliche Videoüberwachung
- III. Erfassung eines Bewegungsprofils
- 1. RFID-Anwendungen im Betrieb
- 2. Die Handy- und GPS-Ortung im Arbeitsverhältnis
- IV. Die Überwachung der Telekommunikation
- 1. Das Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 Abs. 1 GG
- 2. Das Fernmeldegeheimnis des § 88 TKG.
- 3. Das TMG
- V. Die Kontrolle über Telefon
- 1. Die Telefondatenerfassung
- 2. Das Mithören und Aufzeichnen dienstlicher Telefonate
- VI. Die Kontrolle der dienstlichen E-Mail- und Internetnutzung
- E. Rechte des Arbeitnehmers
- I. Ansprüche des Betroffenen
- 1. Auskunftsanspruch
- 2. Benachrichtigungsanspruch
- 3. Berichtigungsanspruch.
- 4. Anspruch auf Löschung
- 5. Anspruch auf Sperrung
- 6. Anspruch auf Widerspruch
- 7. Schadensersatzanspruch
- I. Ansprüche des Betroffenen
- F. Mitbestimmung und Datenschutz.
- I. Rechte des Betriebsrates.
- II. Personalfragebogen....
- III. Die Kontrolle über die Leistung und das Verhalten.
- G. Der Datenschutzbeauftragte und die Aufsichtsbehörde
- 3I. Pflicht zur Bestellung
- II. Die Bestellung einer geeigneten Person
- III. Aufgaben des Datenschutzbeauftragten.
- IV. Aufsichtsbehörde
- H. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Arbeitnehmerdatenschutz und untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Überwachung und Datenerhebung von Arbeitnehmern im Arbeitsverhältnis. Ziel ist es, die geltenden Gesetze und Vorschriften im Detail zu analysieren und die rechtlichen Grenzen der Datenerhebung durch den Arbeitgeber aufzuzeigen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Datenschutzes im Arbeitsverhältnis
- Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Datenschutzkontext
- Zulässige Formen der Überwachung und Datenerhebung am Arbeitsplatz
- Rechtliche Grenzen der Videoüberwachung, Telekommunikationsüberwachung und anderen Formen der Datenerfassung
- Die Rolle des Datenschutzbeauftragten und der Aufsichtsbehörde im Arbeitsverhältnis
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung zum Thema Datenschutzrecht: Dieses Kapitel führt in das Thema Datenschutzrecht ein und beleuchtet die Bedeutung des Schutzes von Personendaten im digitalen Zeitalter.
B. Das BDSG: Dieses Kapitel analysiert das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) als zentrale Grundlage des Arbeitnehmerdatenschutzes. Es befasst sich mit den Voraussetzungen für die Anwendung des Gesetzes, den verschiedenen Arten von personenbezogenen Daten und den Anforderungen an die Einwilligung zur Datenerhebung.
C. Die EG-Datenschutzrichtlinie 95/46: Dieses Kapitel erläutert die Europäische Datenschutzrichtlinie als Grundlage für den Datenschutz im europäischen Raum und beschreibt die wichtigsten Vorgaben für den Schutz von Personendaten.
D. Der Datenschutz in Unternehmen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Anwendung des Datenschutzes in Unternehmen und beleuchtet die Kontrollrechte des Arbeitgebers in Bezug auf die Überwachung von Arbeitnehmern. Es untersucht verschiedene Formen der Überwachung, wie beispielsweise Videoüberwachung, Telekommunikationsüberwachung und GPS-Ortung.
E. Rechte des Arbeitnehmers: Dieses Kapitel stellt die Rechte des Arbeitnehmers im Datenschutzkontext dar und beschreibt seine Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung und Löschung von Daten. Es behandelt auch das Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung.
F. Mitbestimmung und Datenschutz: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle des Betriebsrates im Datenschutz und die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei Entscheidungen über die Datenerhebung und -verarbeitung.
G. Der Datenschutzbeauftragte und die Aufsichtsbehörde: Dieses Kapitel behandelt die Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten in Unternehmen und beschreibt die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten sowie die Rolle der Aufsichtsbehörde im Datenschutz.
H. Fazit: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen zur aktuellen Rechtslage im Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzes.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmerdatenschutz, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), EG-Datenschutzrichtlinie, Videoüberwachung, Telekommunikationsüberwachung, GPS-Ortung, Einwilligung, Rechte des Arbeitnehmers, Mitbestimmung, Datenschutzbeauftragter, Aufsichtsbehörde.
- Quote paper
- Gülcan Bicer (Author), 2012, Arbeitsrechtliche Grundsätze im Datenschutzrecht: Zulässigkeit hinsichtlich der Datenerhebung und Überwachung von Arbeitnehmern im Rahmen des Datenschutzrechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/207799