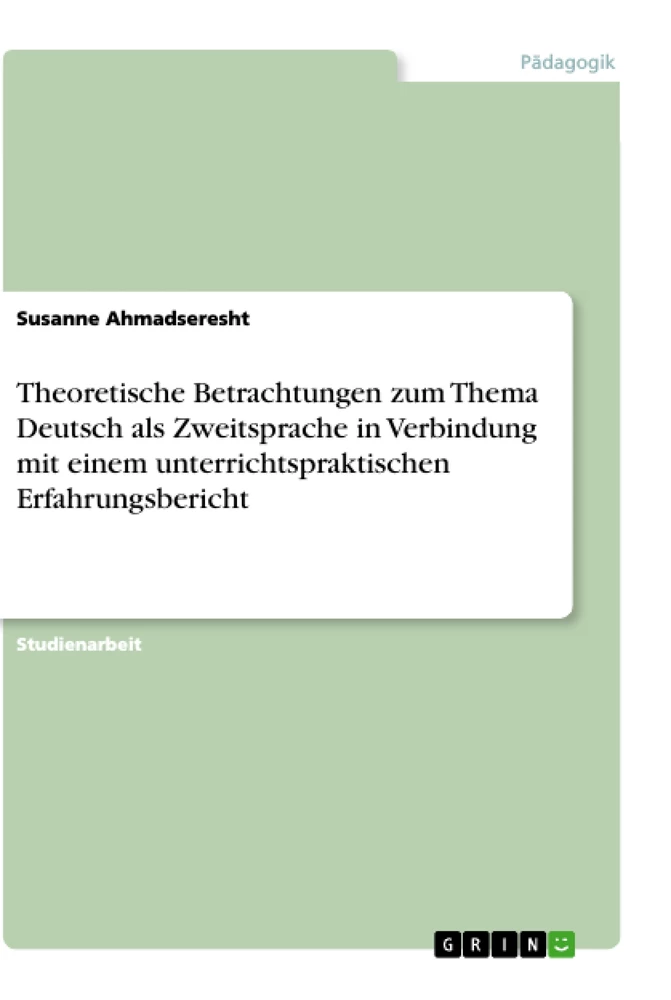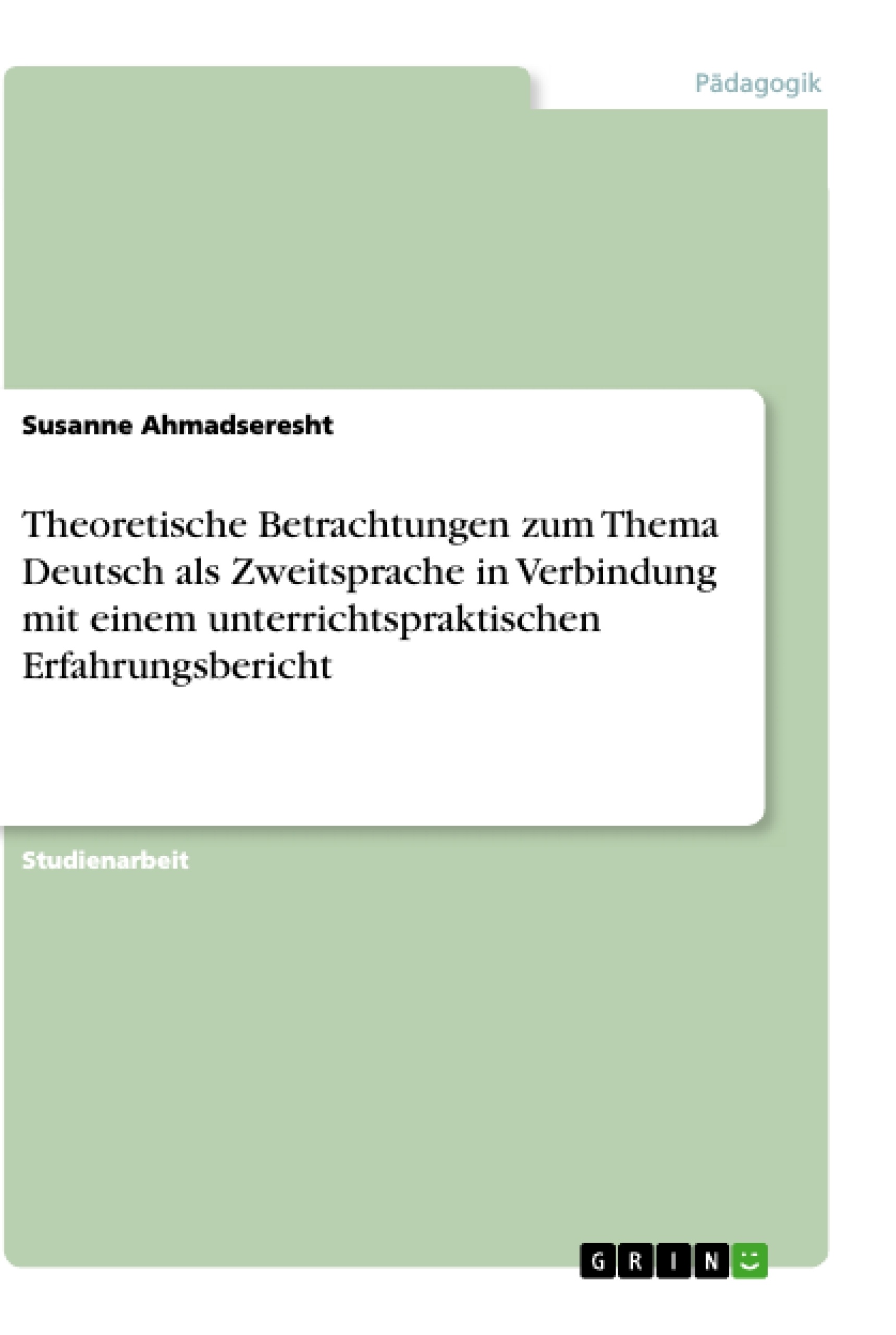Ca. 3,37 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland sprechen Deutsch nicht als Mutter-sprache, besuchen aber deutsche Schulen.
Das Beherrschen der deutschen Sprache steht in einem direkten Verhältnis zum Schulerfolg und dem Erfolg im Arbeits- und Berufs¬leben. SuS mit Migrationshintergrund haben oft Probleme in der Schule und sind meist weniger erfolgreich als ihre deutschen Mitschüler. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.
Angesichts der Tatsache, dass immer mehr SuS mit Migrationshintergrund unser Schulsystem durchlaufen, müssen wir uns die Frage stellen, was Schule tun kann, um auch diesen SuS Erfolg in unserem Bildungssystem zu ermöglichen, damit sie sich in unsere Gesellschaft und in unsere Berufs- und Arbeitswelt integrieren und ein erfülltes Leben führen können.
Im Rahmen meines Lehramtsstudiums in den Fächern Wirtschaft und Deutsch habe ich mich im Wintersemester 2012 für das „Fachdidaktische Projektmodul“ entschieden. Dieses Modul bein-haltet die Erteilung von Förderunterricht „Deutsch als Zweitsprache“ an ausgewählten Lünebur-ger Schulen. Unterrichtsbegleitend fand das Seminar statt. Da ich selbst in eine Familie mit Migrationshintergrund hineingeboren wurde, habe ich auch einen persönlichen Bezug zu diesem Thema.
Seit 2007 laufen zwei Projekte, die einerseits von der Stiftung Mercator und andererseits von dem Institut für Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik der Leuphana Universität getragen werden. Die Stiftung Mercator verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund mit Hilfe konkreter Sprachförderungsmaßnahmen zu unterstützen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit habe ich für ein halbes Jahr an der IGS Kaltenmoor in Lüne-burg eine „DaZ-AG“ der 7.Klasse unterrichtet.
Die vorliegende Arbeit ist dreigeteilt. Der erste Teil beschäftigt sich mit der fachwissenschaftli-chen Darstellung des Themas Deutsch als Zweitsprache. Der zweite Teil ist ein persönlicher Erfahrungsbericht über meine unterrichtspraktische Tätigkeit an der IGS Kaltenmoor in Lüneburg mit der DaZ-AG einer 7.Klasse. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Analyse, Bewertung und Behebung von Fehlern anhand eines Schülertextes.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil: Fachwissenschaftliche Darstellung des Themas
- Die Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb
- Didaktische Überlegungen
- Unterrichtspraktischer Teil
- Lerngruppe
- Lernumgebung
- Tabellarischer Überblick der erteilten Unterrichtsstunden
- Ausarbeitung einer Unterrichtsstunde
- Tabellarischer Stundenverlaufsplan
- Reflexion der Unterrichtsstunde
- Fehleranalyse
- Fehler und ihre Ursachen
- Analyse eines Schülertextes mit der Erstsprache Arabisch
- Die arabischen Sprache
- Tabellarische Fehleranalyse
- Fehlerbewertung
- Einsatz von Fehleranalysen im Unterricht
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet das Thema Deutsch als Zweitsprache (DaZ) aus fachwissenschaftlicher Perspektive und anhand eines eigenen Unterrichtspraktikums. Ziel ist es, den Erwerb der deutschen Sprache im Kontext der Bildung von Schülern mit Migrationshintergrund zu analysieren und die Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb zu verdeutlichen. Zudem werden didaktische Überlegungen und die praktische Umsetzung im Unterricht dargestellt.
- Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb
- Didaktische Konzepte und Methoden im DaZ-Unterricht
- Praktische Erfahrungen im DaZ-Unterricht
- Fehleranalyse im Kontext des Zweitspracherwerbs
- Unterstützung und Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Deutsch als Zweitsprache ein und beschreibt die Relevanz des Themas im Kontext des deutschen Schulsystems. Der theoretische Teil beschäftigt sich mit der fachwissenschaftlichen Darstellung des Themas und beleuchtet die Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb. Des Weiteren werden verschiedene Theorien zum Zweitspracherwerb erläutert und didaktische Überlegungen angestellt.
Der zweite Teil der Arbeit stellt den unterrichtspraktischen Teil dar und beleuchtet die Erfahrungen der Autorin im DaZ-Unterricht an der IGS Kaltenmoor in Lüneburg. Dieser Teil beinhaltet eine Beschreibung der Lerngruppe, der Lernumgebung sowie einen tabellarischen Überblick der erteilten Unterrichtsstunden. Ausgewählte Unterrichtsstunden werden detailliert analysiert, wobei ein Schwerpunkt auf die Reflexion der Unterrichtsstunde liegt.
Der dritte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse, Bewertung und Behebung von Fehlern im Kontext des Zweitspracherwerbs. Anhand eines Schülertextes mit der Erstsprache Arabisch werden die Ursachen von Fehlern analysiert und verschiedene Fehlertypen beleuchtet. Die Arbeit endet mit einer Reflexion über den Einsatz von Fehleranalysen im Unterricht.
Schlüsselwörter
Deutsch als Zweitsprache, Erstsprache, Zweitspracherwerb, Interdependenzhypothese, Interlanguage-Hypothese, Fehleranalyse, DaZ-Unterricht, Migrationshintergrund, Sprachförderung, Bildungserfolg, Unterrichtspraxis, Lerngruppe, Lernumgebung, Schülertext, Arabisch.
- Quote paper
- Susanne Ahmadseresht (Author), 2012, Theoretische Betrachtungen zum Thema Deutsch als Zweitsprache in Verbindung mit einem unterrichtspraktischen Erfahrungsbericht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/207442