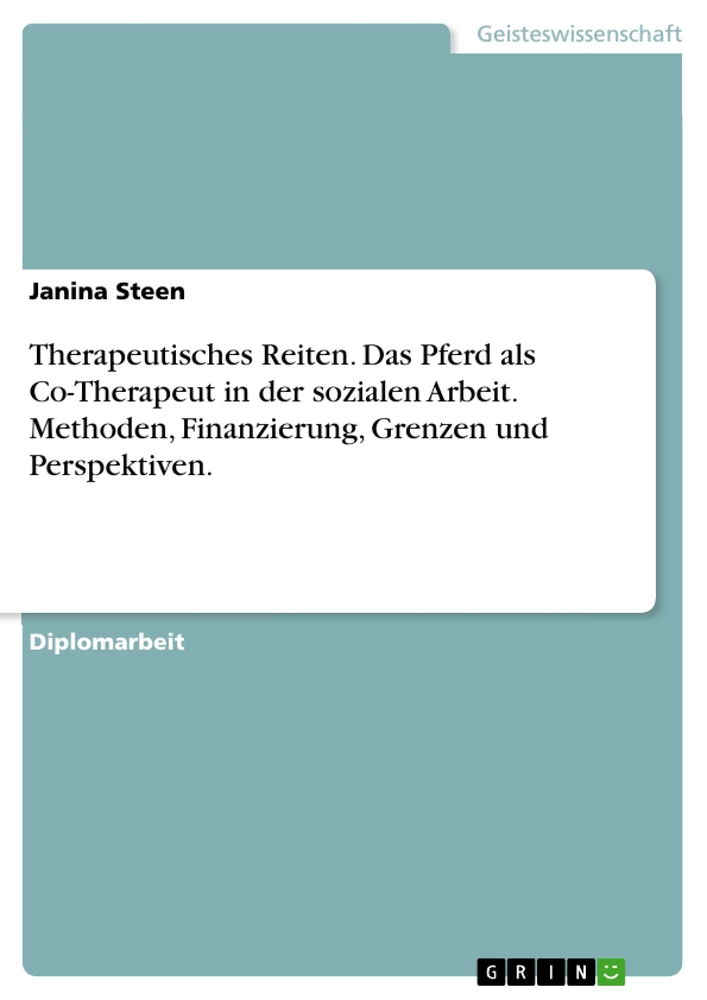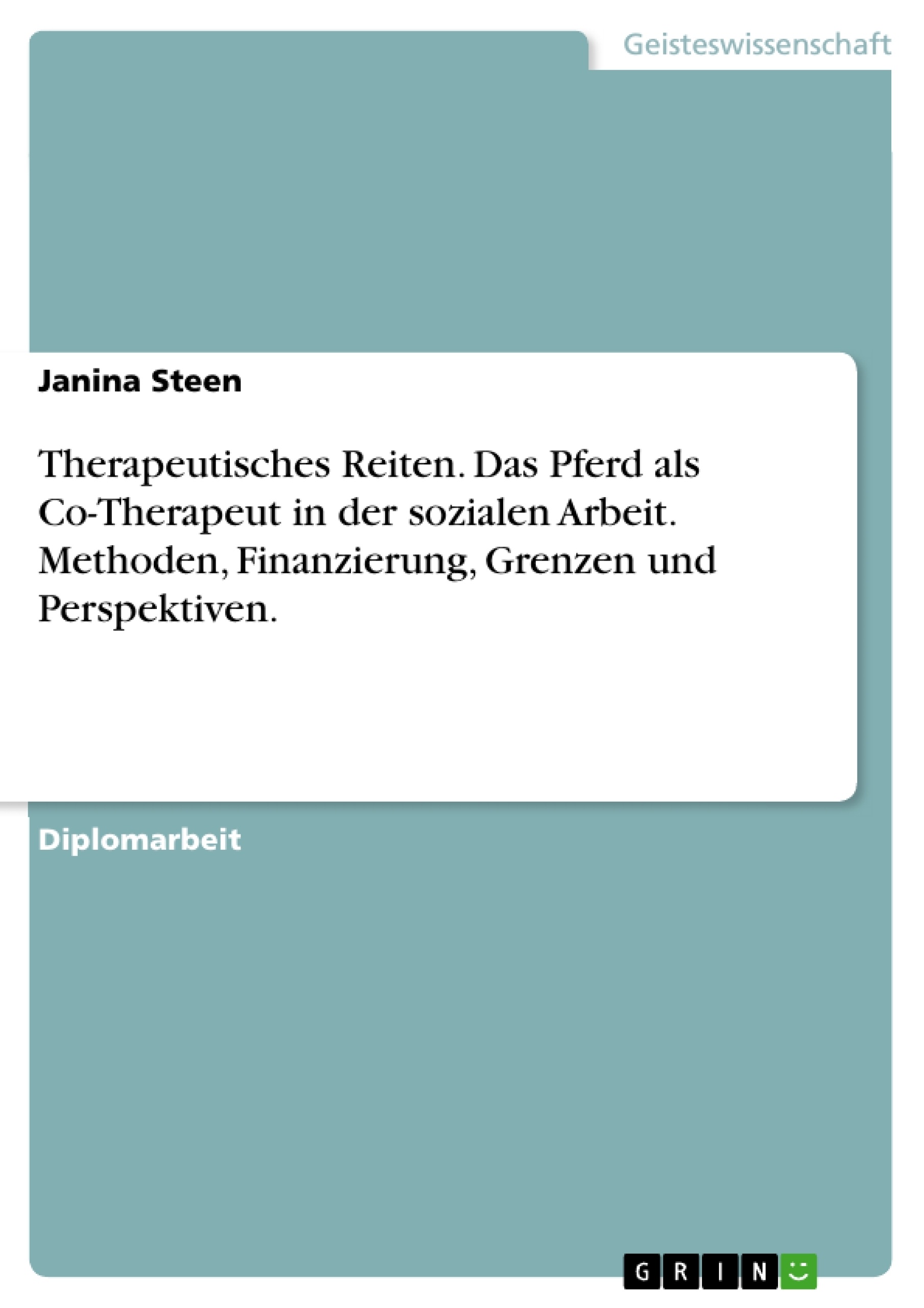Das Oberthema dieser schriftlichen Arbeit lautet : „Das Pferd als Co-Therapeut in der sozialen Arbeit“ und wirft als erstes die Frage auf, welche Gründe dazu veranlassen können, einem Tier therapeutische
Fähigkeiten zuzuschreiben. Als Therapeutenvariablen gelten im allgemeinen „spezifische verbale, nonverbale und soziale Verhaltensaspekte und Interventionsstrategien eines Therapeuten zur
Lösung von psychischen Problemen eines Hilfesuchenden“ (Fachlexikon der sozialen Arbeit, 1997, S. 957). Da das Werkzeug des Sozialarbeiters insbesondere die Sprache ist, scheint dem Laien
die Frage an dieser Stelle genügend beantwortet. Das Pferd ist nicht zur verbalen Kommunikation mit dem Menschen fähig, demnach vermag es in keinster Weise einen gesprächstherapeutischen Prozess zu unterstützen. Dennoch sei an dieser Stelle behauptet,
dass das Pferd zu einer umfangreichen Kommunikation mit dem Menschen fähig ist und außerdem über eben die spezifische Grundhaltung verfügt, die ein Therapeut gegenüber seinem Klienten
einnehmen soll. Das Unterthema der Arbeit „Methoden, Finanzierung, Grenzen und Perspektiven des Therapeutischen Reitens“ soll darauf
hinweisen, dass innerhalb dieser Ausführung zum Thema im Sinne der Ganzheitlichkeit der Sozialarbeit eben nicht nur die Beziehung
des Therapeuten zum Klienten, hier die Beziehung zwischen Therapeut, Co-Therapeut und Klient, betrachtet werden soll, sondern inwiefern das Therapeutische Reiten in der sozialen Arbeit bereits
eingebetet ist bzw. wie es eingebetet werden könnte. Dazu ist es zum Einen notwendig, die unterschiedlichen Methoden in ihrer Bandbreite
genauer zu betrachten und zum Anderen die Rahmenbedingungen und insbesondere die Finanzierbarkeit des Therapeutischen Reitens
abzuklären. Ziel dieser Arbeit ist es, den Einsatz des Pferdes als effektiven Sozialhelfer anhand von ausgewählten methodischen Ansätzen und Handlungskonzepten zu prüfen. Da das Therapeutische Reiten ein Oberbegriff ist, dient das erste
Kapitel als Orientierungshilfe innerhalb der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Pferdes in Medizin, Pädagogik und Sport.
In der Betrachtung des Pferdes als Co-Therapeut in der sozialen Arbeit wird hier der Bereich des Heilpädagogischen Reitens und
Voltigierens akzentuiert. Im zweiten Kapitel soll das Pferd mit seinen spezifischen Verhaltensaspekten als, weitläufig in seinen besonderen Qualitäten noch relativ unbekanntes, Medium besondere Beachtung
finden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Therapeutisches Reiten - Der Einsatz des Pferdes in Medizin, Pädagogik und Sport
- 2.1 Die Hippotherapie - Krankengymnastische Förderung auf dem Pferd
- 2.2 Das Heilpädagogische Reiten und Voltigieren - Ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen
- 2.3 Reiten als Sport für Behinderte - Integrative Freizeitgestaltung und Leistungssport
- 3 Pferd - Kind - Pädagoge: Die Partner im heilpädagogischen Reiten / Voltigieren
- 3.1 Das Pferd - Symbolhaftigkeit und gemeinsame Entwicklungsgeschichte mit dem Menschen
- 3.1.1 Verhaltensspezifische Eigenschaften und Beziehungsfähigkeit des Pferdes
- 3.1.2 Zum Motivationsaspekt - der (auf)fordernde Charakter des Pferdes
- 3.1.3 Das geeignete Therapiepferd
- 3.2 Das Kind/ der Jugendliche - Zielgruppenbestimmung und Lebensweltbetrachtung
- 3.2.1 Reduzierung der Freiräume für Kinder - Multimedialität versus Realitätsprinzip
- 3.2.2 Zur Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten/-störungen, Lernstörungen/-behinderungen
- 3.3 Der Reitpädagoge - Grundsätzliche Einstellung und Verhalten des Pädagogen
- 3.3.1 Sachorientierte Partnerschaft als Handlungskonzept im Heilpädagogischen Reiten/Voltigieren
- 3.3.2 Berufsbezeichnung, Qualifikation
- 3.4 Das Beziehungsgeschehen im Setting des Heilpädagogischen Reitens/Voltigierens
- 4 Verschiedene methodische Ansätze und spezielle Zielsetzungen des HPR/V
- 4.1 Entwicklungsorientierung - Zur Entwicklung der Persönlichkeit nach Freud und Erikson
- 4.2 Psycho- und sensomotorische Förderung durch das Pferd
- 4.3 Psychoanalytisch-orientiertes Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
- 4.4 Erwerb individueller und sozialer Kompetenzen durch den Umgang mit dem Pferd
- 5 Zusammenarbeit mit Kostenträgern, Eltern sowie anderen Institutionen
- 5.1 Zur Finanzierung des Therapeutischen Reitens - Leistungserbringer und Kostenträger
- 5.2 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen sozialer Arbeit
- 5.3 Die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Eltern
- 5.3.1 Der erste Kontakt mit den Eltern - Absicherung, Kosten, Anamnese
- 5.4 Qualitätssicherung im HPR/V - Qualitätsstandards und Zielüberprüfung
- 6 Die Grenzen der Arbeit mit dem Pferd
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz des Pferdes als Co-Therapeut in der Sozialen Arbeit, insbesondere im therapeutischen Reiten. Sie beleuchtet Methoden, Finanzierung, Grenzen und Perspektiven dieser Arbeit. Die Zielsetzung besteht darin, die Effektivität des Pferdes als Sozialhelfer anhand ausgewählter methodischer Ansätze zu prüfen.
- Methoden des therapeutischen Reitens (Hippotherapie, Heilpädagogisches Reiten/Voltigieren)
- Beziehung zwischen Pferd, Kind/Jugendlichem und Therapeut
- Entwicklungs- und psychologische Aspekte der Förderung
- Finanzierung und Zusammenarbeit mit Institutionen
- Grenzen des Einsatzes von Pferden in der Therapie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den therapeutischen Fähigkeiten des Pferdes und dem therapeutischen Reiten in der Sozialen Arbeit. Sie betont die Bedeutung der ganzheitlichen Betrachtung des therapeutischen Prozesses, der Beziehung zwischen Therapeut, Co-Therapeut (Pferd) und Klient, sowie der Klärung von Rahmenbedingungen und Finanzierbarkeit.
2 Therapeutisches Reiten - Der Einsatz des Pferdes in Medizin, Pädagogik und Sport: Dieses Kapitel dient als Überblick über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten des Pferdes in Medizin, Pädagogik und Sport. Der Fokus liegt auf dem Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren im Kontext der Sozialen Arbeit. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Methoden beleuchtet, um den spezifischen Beitrag des Pferdes in der Sozialen Arbeit zu definieren.
3 Pferd - Kind - Pädagoge: Die Partner im heilpädagogischen Reiten / Voltigieren: Dieses Kapitel analysiert die drei zentralen Akteure im heilpädagogischen Reiten: das Pferd, das Kind/der Jugendliche und der Reitpädagoge. Es beleuchtet die besonderen Eigenschaften des Pferdes als Therapiemedium, die Zielgruppen des Heilpädagogischen Reitens/Voltigierens und die notwendigen Qualifikationen des Reitpädagogen, inklusive des Konzepts der sachorientierten Partnerschaft. Das Kapitel analysiert die komplexe Beziehung zwischen den drei Akteuren und deren Interaktionen.
4 Verschiedene methodische Ansätze und spezielle Zielsetzungen des HPR/V: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene methodische Ansätze des Heilpädagogischen Reitens und Voltigierens. Es werden psychologische Grundlagen, wie die Entwicklungstheorien von Freud und Erikson, in Bezug auf die Förderung der Persönlichkeit integriert. Es werden verschiedene Förderbereiche und methodische Vorgehensweisen detailliert dargestellt und mit den vorhergehenden Kapiteln verbunden.
5 Zusammenarbeit mit Kostenträgern, Eltern sowie anderen Institutionen: Dieses Kapitel widmet sich den praktischen Aspekten des therapeutischen Reitens. Es befasst sich mit der Finanzierung, der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und der Bedeutung der Elternarbeit. Die Qualitätssicherung und die Überprüfung der gesetzten Ziele werden ebenfalls behandelt. Es beleuchtet die Herausforderungen in Bezug auf die praktische Umsetzung des therapeutischen Reitens.
Schlüsselwörter
Therapeutisches Reiten, Heilpädagogisches Reiten, Voltigieren, Hippotherapie, Sozialarbeit, Co-Therapie, Pferd, Kind, Jugendlicher, Reitpädagoge, Methoden, Finanzierung, Qualitätssicherung, Entwicklungsförderung, soziale Kompetenz, Grenzen, Perspektiven.
Häufig gestellte Fragen zum Thema "Therapeutisches Reiten"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einsatz des Pferdes als Co-Therapeut in der Sozialen Arbeit, insbesondere im therapeutischen Reiten. Sie beleuchtet Methoden, Finanzierung, Grenzen und Perspektiven dieser Arbeit und prüft die Effektivität des Pferdes als Sozialhelfer anhand ausgewählter methodischer Ansätze.
Welche Arten des therapeutischen Reitens werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Formen des therapeutischen Reitens, darunter Hippotherapie, Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Methoden werden im Detail erläutert.
Welche Akteure spielen im heilpädagogischen Reiten eine Rolle?
Die Arbeit analysiert die Interaktion zwischen Pferd, Kind/Jugendlichem und Reitpädagogen im heilpädagogischen Reiten/Voltigieren. Dabei werden die Eigenschaften des Pferdes als Therapiemedium, die Zielgruppen und die notwendigen Qualifikationen des Reitpädagogen, inklusive des Konzepts der sachorientierten Partnerschaft, beleuchtet.
Welche methodischen Ansätze des Heilpädagogischen Reitens werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene methodische Ansätze des Heilpädagogischen Reitens und Voltigierens, in Bezug auf psychologische Grundlagen (z.B. Entwicklungstheorien von Freud und Erikson) und verschiedene Förderbereiche (z.B. psycho- und sensomotorische Förderung).
Wie ist die Finanzierung des therapeutischen Reitens geregelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Finanzierung des therapeutischen Reitens, der Zusammenarbeit mit Kostenträgern und anderen Institutionen sowie der Bedeutung der Elternarbeit. Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung werden ebenfalls thematisiert.
Welche Bedeutung hat die Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Institutionen?
Die Zusammenarbeit mit Eltern, Kostenträgern und anderen Institutionen sozialer Arbeit ist ein wichtiger Aspekt, der die erfolgreiche Durchführung des therapeutischen Reitens beeinflusst. Der erste Kontakt mit den Eltern, die Klärung von Kosten und die Anamnese werden ebenso betrachtet wie die Qualitätssicherung und Zielüberprüfung.
Welche Grenzen hat die Arbeit mit dem Pferd in der Therapie?
Die Arbeit thematisiert auch die Grenzen des Einsatzes von Pferden in der Therapie und gibt einen Überblick über die entsprechenden Einschränkungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Therapeutisches Reiten, Heilpädagogisches Reiten, Voltigieren, Hippotherapie, Sozialarbeit, Co-Therapie, Pferd, Kind, Jugendlicher, Reitpädagoge, Methoden, Finanzierung, Qualitätssicherung, Entwicklungsförderung, soziale Kompetenz, Grenzen, Perspektiven.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu den verschiedenen Arten des therapeutischen Reitens, den Akteuren im heilpädagogischen Reiten, den methodischen Ansätzen, der Zusammenarbeit mit Institutionen und den Grenzen der Arbeit mit dem Pferd. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Wo finde ich weitere Informationen zum Thema Therapeutisches Reiten?
(Hier könnten Sie Links zu relevanten Webseiten oder Literatur hinzufügen)
- Quote paper
- Janina Steen (Author), 2002, Therapeutisches Reiten. Das Pferd als Co-Therapeut in der sozialen Arbeit. Methoden, Finanzierung, Grenzen und Perspektiven., Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/20714