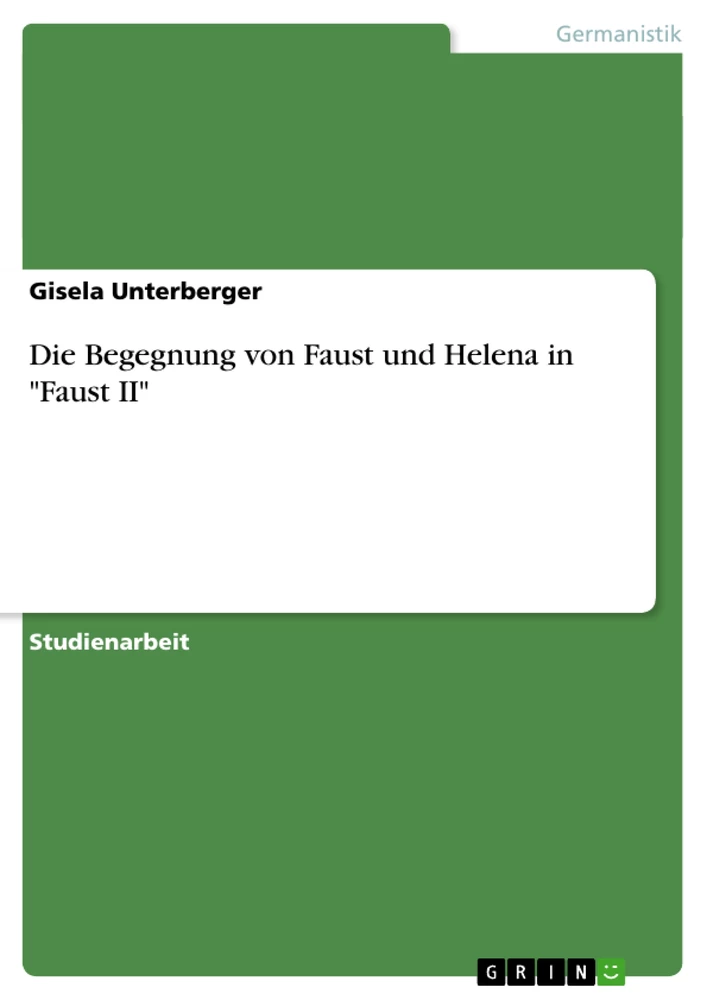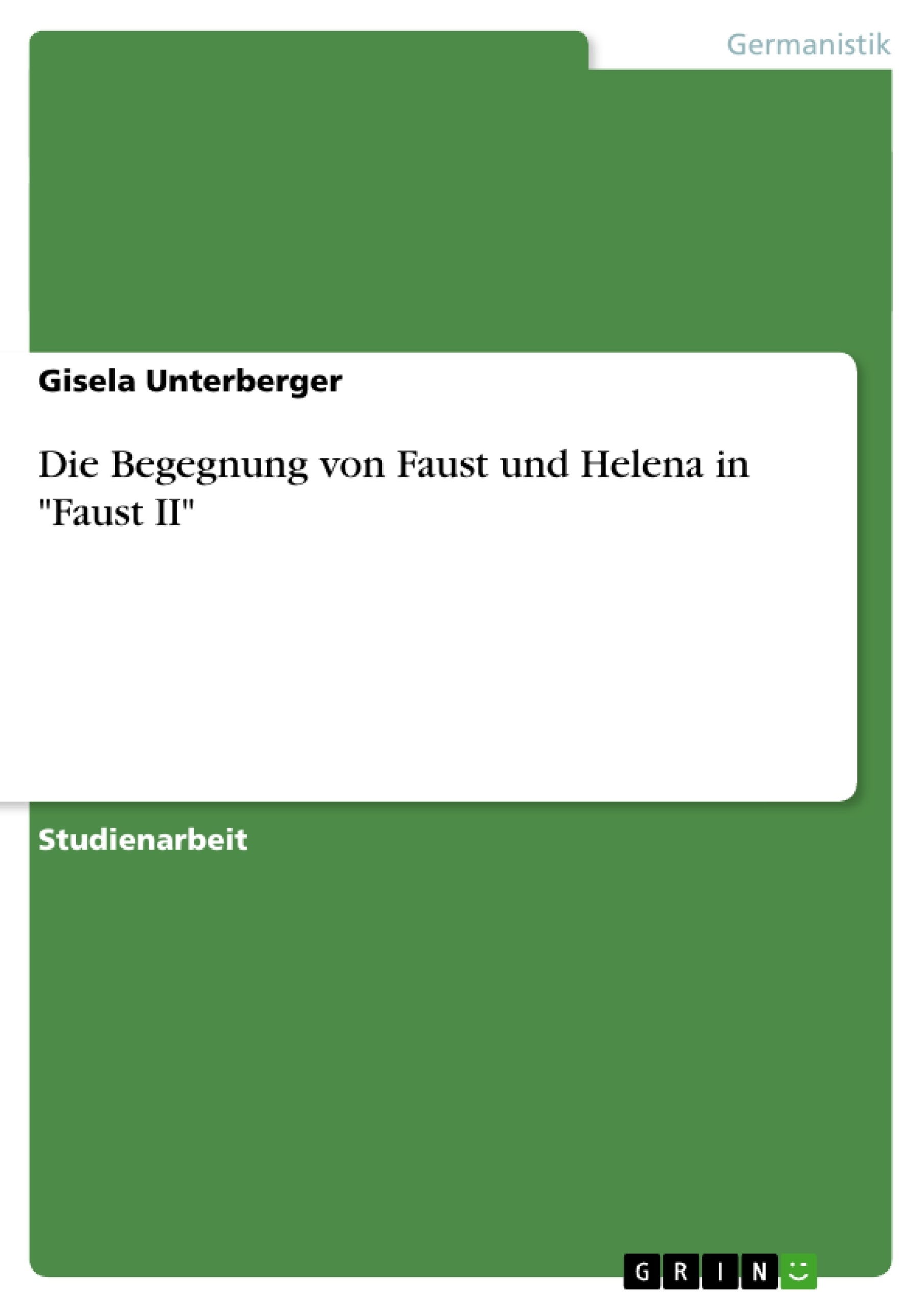Das Helena-Motiv gehörte schon zur Faust-Sage der Volksbücher. Dort ist Helena eine herbeigezauberte Gestalt, eine Schöpfung des Teufels. Bei Goethe hingegen wird sie als erhabene Gestalt, als Heldin dargestellt. Um 1800 begann sich Goethe eingehender mit der Helena-Figur zu befassen. Es entstand ein Fragment von 265 Versen, das bereits die Auftrittsszene und das Gespräch mit Phorkyas enthält. Als Beispiel seien die Verse 8707 – 8718 in Faust II erwähnt.1 Darin trifft Helena noch nicht mit Faust zusammen. Die Weiterführung des Helena-Faust-Themas musste warten. Andere Werke, wie die Wahlverwandtschaften, Farbenlehre, die erste Fassung der Wanderjahre waren vorrangig. Erst im Alter, in der Schaffensperiode von 1825 bis 1831 arbeitete Goethe an seinem Faust II weiter. In seinem Tagebuch bezeichnete er nun die Arbeit am „Faust“ als „Hauptgeschäft.“ In einem Brief äußert er sich ironisch: „Wie ich im Stillen langmütig einhergehe, werden Sie an der dreitausendjährigen „Helena“ sehen, der ich nun auch schon sechzig Jahre nachschleiche, um ihr einigermaßen etwas abzugewinnen…
Inhaltsverzeichnis
- 1. Entstehungsgeschichte
- 2. Gestaltwerdung der Helena-Figur - Hinführung zu Helena
- 3. Der Helena-Akt
- 4. Vor dem Palast des Menelas zu Sparta
- 5. Die Vereinigung von Faust und Helena
- 6. Euphorions Erscheinen
- 7. Ausklang, Faust und Helena
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entstehung und Darstellung der Helena-Figur in Goethes Faust II. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Verbindung zwischen der mittelalterlichen Figur Fausts und der antiken Helena, sowie die künstlerischen und literarischen Mittel, die Goethe hierfür einsetzt. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Helena-Episode innerhalb des Gesamtkontexts von Faust II.
- Die Entstehungsgeschichte der Helena-Figur in Goethes Werk
- Die künstlerische Gestaltung und Symbolik der Helena-Figur
- Die Verbindung von antiker und mittelalterlicher Kultur in Faust II
- Die Rolle der Helena-Episode im Gesamtkontext von Faust II
- Goethes Auseinandersetzung mit mythologischen und kulturellen Motiven
Zusammenfassung der Kapitel
1. Entstehungsgeschichte: Das Kapitel beschreibt die Entwicklung des Helena-Motivs in Goethes Werk, von frühen Fragmenten bis zur endgültigen Integration in Faust II. Es beleuchtet Goethes langjährige Beschäftigung mit dem Thema, die verschiedenen Einflüsse und die Herausforderungen, die sich aus der Verbindung von mittelalterlicher und antiker Welt ergaben. Goethes eigene Äußerungen in Briefen und Tagebüchern werden herangezogen, um seine Arbeitsweise und seine Intentionen zu verstehen. Die Herausforderungen der zeitlichen und kulturellen Diskrepanz zwischen Faust und Helena werden deutlich gemacht und als zentrales Problem der Integration des Helena-Aktes in den Gesamtkontext von Faust II herausgestellt. Die Veröffentlichung des „Helena“-Aktes als eigenständige Einheit wird thematisiert und in Bezug zu Goethes Gesamtwerk gesetzt.
2. Gestaltwerdung der Helena-Figur – Hinführung zu Helena: Dieses Kapitel untersucht die Vorbereitungen und Hinführung zur Begegnung von Faust und Helena. Es analysiert Fausts wechselndes Verhältnis zum Gedenken und Vergessen, seine Erinnerung an Gretchen und die Rolle der „Hexenküche“ als Vorbote der Begegnung mit Helena. Die Reise Fausts und Mephistos zur „kaiserlichen Pfalz“ wird beschrieben, sowie der Wunsch des Kaisers nach einem besonderen Schauspiel, das den Weg für Fausts Herbeizauberung Helenas ebnet. Die Reise in das Reich der Mütter, als entscheidender Schritt zur Materialisierung Helenas, wird eingehend betrachtet, wobei die mythischen und philosophischen Hintergründe dieser Episode ausführlich erläutert werden, inklusive verschiedener Interpretationen der „Mütter“ durch verschiedene Gelehrte wie Plutarch oder Rudolf Steiner. Die Ambivalenz der Mutter-Figur und ihre Symbolik für die Ursprünge der Welt bilden die Grundlage der Interpretation.
Schlüsselwörter
Goethe, Faust II, Helena, Entstehungsgeschichte, Klassisch-romantische Phantasmagorie, Antike, Mittelalter, Mythologie, Gedächtnis, Mütter, Reich der Mütter, Kulturelle Geschichtswerdung.
Goethes Faust II: Helena - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entstehung und Darstellung der Helena-Figur in Goethes Faust II. Sie untersucht die Herausforderungen der Verbindung zwischen der mittelalterlichen Figur Fausts und der antiken Helena und die von Goethe hierfür eingesetzten künstlerischen und literarischen Mittel. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Helena-Episode im Gesamtkontext von Faust II.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte der Helena-Figur, ihre künstlerische Gestaltung und Symbolik, die Verbindung von antiker und mittelalterlicher Kultur in Faust II, die Rolle der Helena-Episode im Gesamtkontext von Faust II und Goethes Auseinandersetzung mit mythologischen und kulturellen Motiven.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: 1. Entstehungsgeschichte (Entwicklung des Helena-Motivs in Goethes Werk, Herausforderungen der Verbindung von Mittelalter und Antike); 2. Gestaltwerdung der Helena-Figur – Hinführung zu Helena (Vorbereitungen auf die Begegnung von Faust und Helena, Fausts Verhältnis zum Gedenken und Vergessen, die Rolle der Hexenküche, die Reise zum Kaiser und ins Reich der Mütter); 3. Der Helena-Akt (genaue Analyse des Helena-Aktes - Details folgen in der vollständigen Arbeit); 4. Vor dem Palast des Menelas zu Sparta (genaue Analyse - Details folgen in der vollständigen Arbeit); 5. Die Vereinigung von Faust und Helena (genaue Analyse - Details folgen in der vollständigen Arbeit); 6. Euphorions Erscheinen (genaue Analyse - Details folgen in der vollständigen Arbeit); 7. Ausklang, Faust und Helena (genaue Analyse - Details folgen in der vollständigen Arbeit).
Wie wird die Entstehungsgeschichte der Helena-Figur behandelt?
Das erste Kapitel beschreibt die Entwicklung des Helena-Motivs von frühen Fragmenten bis zur Integration in Faust II. Es beleuchtet Goethes langjährige Beschäftigung mit dem Thema, verschiedene Einflüsse und die Herausforderungen der Verbindung von mittelalterlicher und antiker Welt. Goethes eigene Äußerungen werden herangezogen, um seine Arbeitsweise und Intentionen zu verstehen. Die Herausforderungen der zeitlichen und kulturellen Diskrepanz zwischen Faust und Helena werden als zentrales Problem der Integration des Helena-Aktes hervorgehoben. Die Veröffentlichung des „Helena“-Aktes als eigenständige Einheit wird ebenfalls thematisiert.
Wie wird die Hinführung zur Begegnung von Faust und Helena dargestellt?
Kapitel zwei analysiert die Vorbereitungen auf die Begegnung von Faust und Helena. Es untersucht Fausts wechselndes Verhältnis zum Gedenken und Vergessen, seine Erinnerung an Gretchen und die Rolle der „Hexenküche“. Die Reise Fausts und Mephistos zur „kaiserlichen Pfalz“ und die Reise ins Reich der Mütter werden beschrieben, inklusive mythischer und philosophischer Hintergründe und verschiedener Interpretationen der „Mütter“ durch Gelehrte.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Goethe, Faust II, Helena, Entstehungsgeschichte, Klassisch-romantische Phantasmagorie, Antike, Mittelalter, Mythologie, Gedächtnis, Mütter, Reich der Mütter, Kulturelle Geschichtswerdung.
- Quote paper
- Gisela Unterberger (Author), 2011, Die Begegnung von Faust und Helena in "Faust II", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/207134