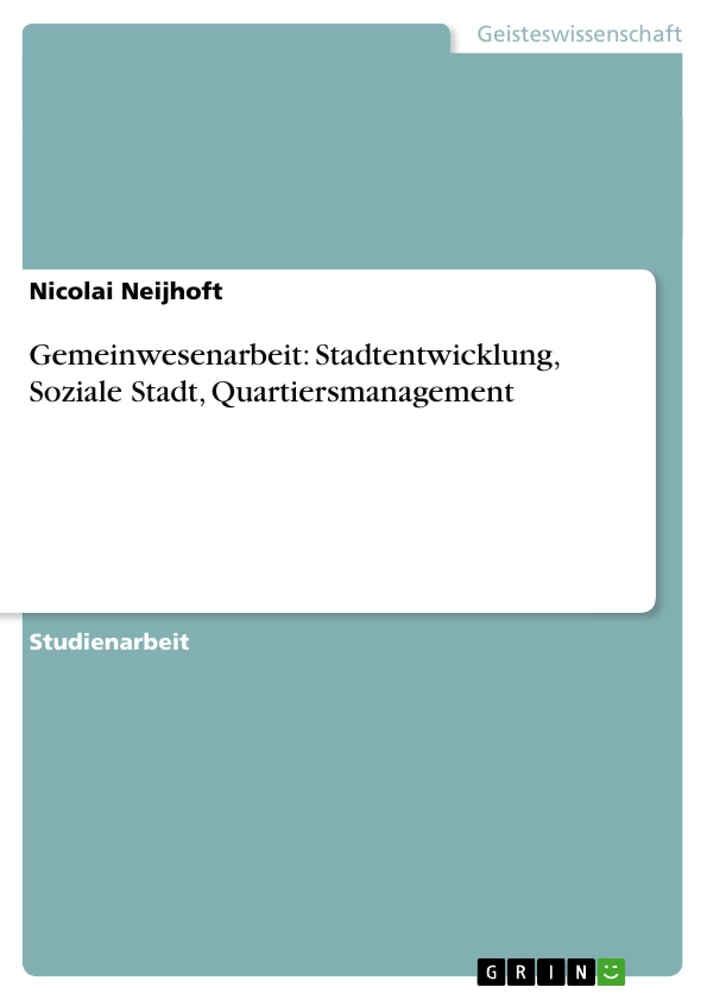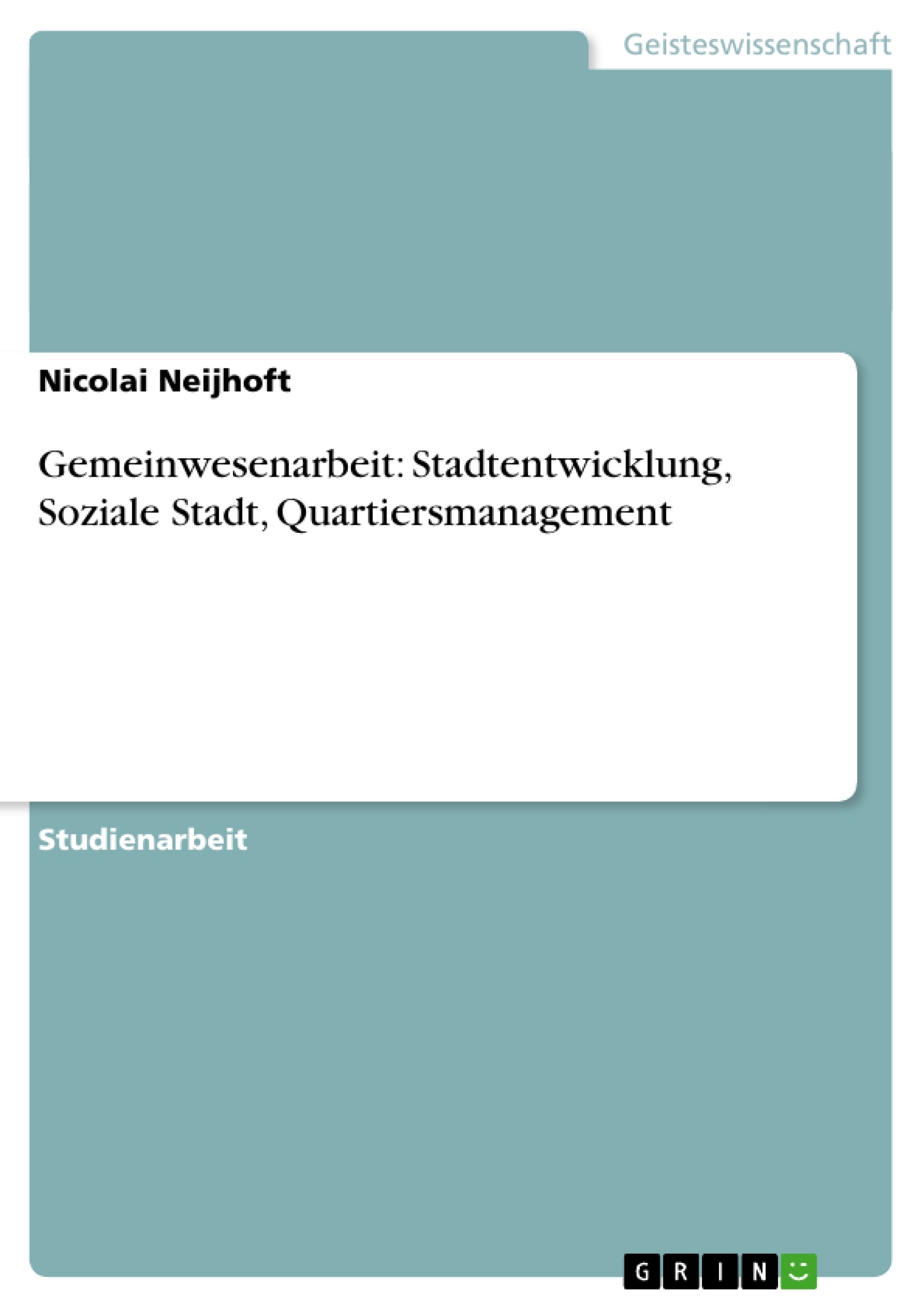Das Leben in den Industrienationen, also auch in Deutschland, spielt sich immer stärker in den Städten ab. So leben in Deutschland heute bereits 88 % der Bevölkerung in Städten.1 Damit einhergehend ist auch die soziale Rolle, die sozialen Funktionen, die die Stadt und die
Stadtinstitutionen ihrer Bevölkerung bieten muss, gewachsen.
Durch die soziale Arbeit in Stadtteilen, kurz genannt sei nur die Settlement Arbeit in England und die community organisation in den USA, wurde der Begriff der Gemeinwesenarbeit als Zweig der sozialen Arbeit ausgearbeitet und geprägt. Daher sind die beiden Begriffe Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit sehr eng verknüpft.
In vielen Städten beziehungsweise in vielen Stadtteilen existieren große soziale Probleme. Einige Stadtteile sind geprägt von einer hohen Arbeitslosen- und Sozialhilfeempfängerquote. Diese Stadtteile sind oft unterentwickelt, haben eine schlechte Bausubstanz und geringe
ökonomische und kulturelle Möglichkeiten. Woher rühren diese Probleme? Wie werden sie von den unterschiedlichen Institutionen angegangen? Welche Lösungsmodelle gibt es? Diesen Fragen versuche ich mit dieser Arbeit nachzugehen. Im ersten Kapitel möchte ich die Stadtentwicklung ab 1850 darlegen. Anschließend gehe ich auf aktuelle Entwicklungen und Problemlagen in den Städten, insbesondere in Großstädten ein. Dabei kommen sowohl das Armutsproblem in den Städten,
die ‚Theorie der geteilten Stadt’ als auch Begriffe wie Segregation und Urbanisierung zum tragen. Anschließend erläutere ich das Programm der ‚Sozialen Stadt’ die Entwicklung, Prognosen und Chancen, sowie ihre Bedeutsamkeit für die soziale Arbeit, für die Gemeinwesenarbeit. Im nächsten Kapitel erkläre ich den Begriff des Quartiermanagement und werde dabei der Frage nachgehen, ob dieser Begriff lediglich eine Umbenennung der klassischen Gemeinwesenarbeit ist oder tatsächlich eine Alternative zur Gemeinwesenarbeit darstellt. Zur Verdeutlichung möchte ich zum Abschluss ein konkretes Beispiel eines Programmgebiets der ‚Sozialen Stadt’ veranschaulichen. Dies geschieht am Beispiel der Stuttgarter Stadtteile Freiberg und Mönchfeld.
1http://www.g-o.de/geobin/
frameset.pl?id=00001&frame1=titelgo.htm&frame2=menue04.htm&frame3=kap4/40la0025.htm, 9.7.2003
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stadtentwicklung
- Geschichte der Stadtentwicklung ab 1850
- Urbanisierung und Suburbanisierung
- Segregation und die Auflösung der Innenstädte
- Armut in der Stadt
- Theorie der,geteilten Stadt'
- Das Programm,Die soziale Stadt'
- Gründung des Programms, Ziele und Charakteristika der Gebiete
- Chancen und Grenzen der,Sozialen Stadt'
- Quartiersmanagement
- Praxisbeispiel zu Quartiersmanagement und Stadtentwicklung Anhand eines Projektes im Rahmen der,Sozialen Stadt'
- Das Programmgebiet
- Die einzelnen Projekte in Freiberg/ Mönchfeld
- Bürgerbeteiligung
- Aufwertung und Sanierung des Ladenzentrums, Kaufpark Freiberg'
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit. Sie analysiert die Entwicklung der Städte ab 1850, insbesondere die Entstehung von Armut, Segregation und Urbanisierung. Dabei werden verschiedene Konzepte und Programme, wie die,Theorie der geteilten Stadt' und das Programm,Die soziale Stadt', erläutert und im Kontext der Gemeinwesenarbeit betrachtet. Des Weiteren wird der Begriff des Quartiersmanagement in Bezug zur Gemeinwesenarbeit gesetzt und anhand eines Praxisbeispiels aus Freiberg/Mönchfeld veranschaulicht.
- Die Geschichte der Stadtentwicklung ab 1850
- Aktuelle Herausforderungen und Probleme in Städten, wie Armut und Segregation
- Das Programm,Die soziale Stadt' und seine Bedeutung für die Gemeinwesenarbeit
- Der Begriff des Quartiersmanagement und seine Beziehung zur Gemeinwesenarbeit
- Die Bedeutung von Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die enge Verknüpfung von Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit dar und beleuchtet die sozialen Probleme in einigen Stadtteilen. Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte der Stadtentwicklung ab 1850, beginnend mit der Industrialisierung und den damit verbundenen Herausforderungen. Das Kapitel behandelt die Entstehung von Segregation, die Auflösung der Innenstädte und die Problematik der Armut in den Städten. Die ,Theorie der geteilten Stadt' wird ebenfalls diskutiert.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Programm,Die soziale Stadt'. Es werden die Gründung, die Ziele und die Charakteristika der Programmgebiete erläutert. Des Weiteren werden die Chancen und Grenzen des Programms für die soziale Arbeit und die Gemeinwesenarbeit betrachtet.
Kapitel 4 geht auf den Begriff des Quartiersmanagement ein und diskutiert, ob es sich um eine bloße Umbenennung der klassischen Gemeinwesenarbeit oder um eine eigenständige Alternative handelt.
Kapitel 5 stellt anhand eines Praxisbeispiels aus Freiberg/Mönchfeld ein Programmgebiet der,Sozialen Stadt' vor. Es werden die einzelnen Projekte, wie die Bürgerbeteiligung und die Sanierung des Ladenzentrums, Kaufpark Freiberg', beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Stadtentwicklung, Gemeinwesenarbeit, Soziale Stadt, Quartiersmanagement, Segregation, Urbanisierung, Armut, Bürgerbeteiligung und Sanierung. Sie untersucht die Herausforderungen der Stadtentwicklung im Kontext von sozialen Problemen und betrachtet verschiedene Ansätze und Programme zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Insbesondere das Konzept der,Sozialen Stadt' und seine Umsetzung in der Praxis werden analysiert.
- Quote paper
- Nicolai Neijhoft (Author), 2003, Gemeinwesenarbeit: Stadtentwicklung, Soziale Stadt, Quartiersmanagement, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/20669