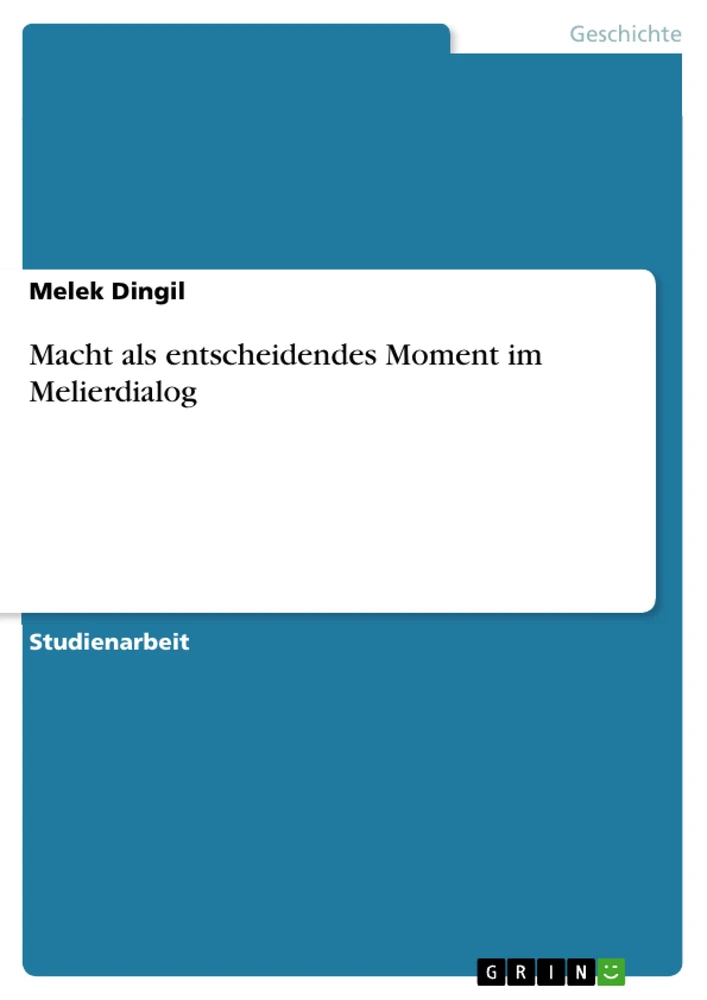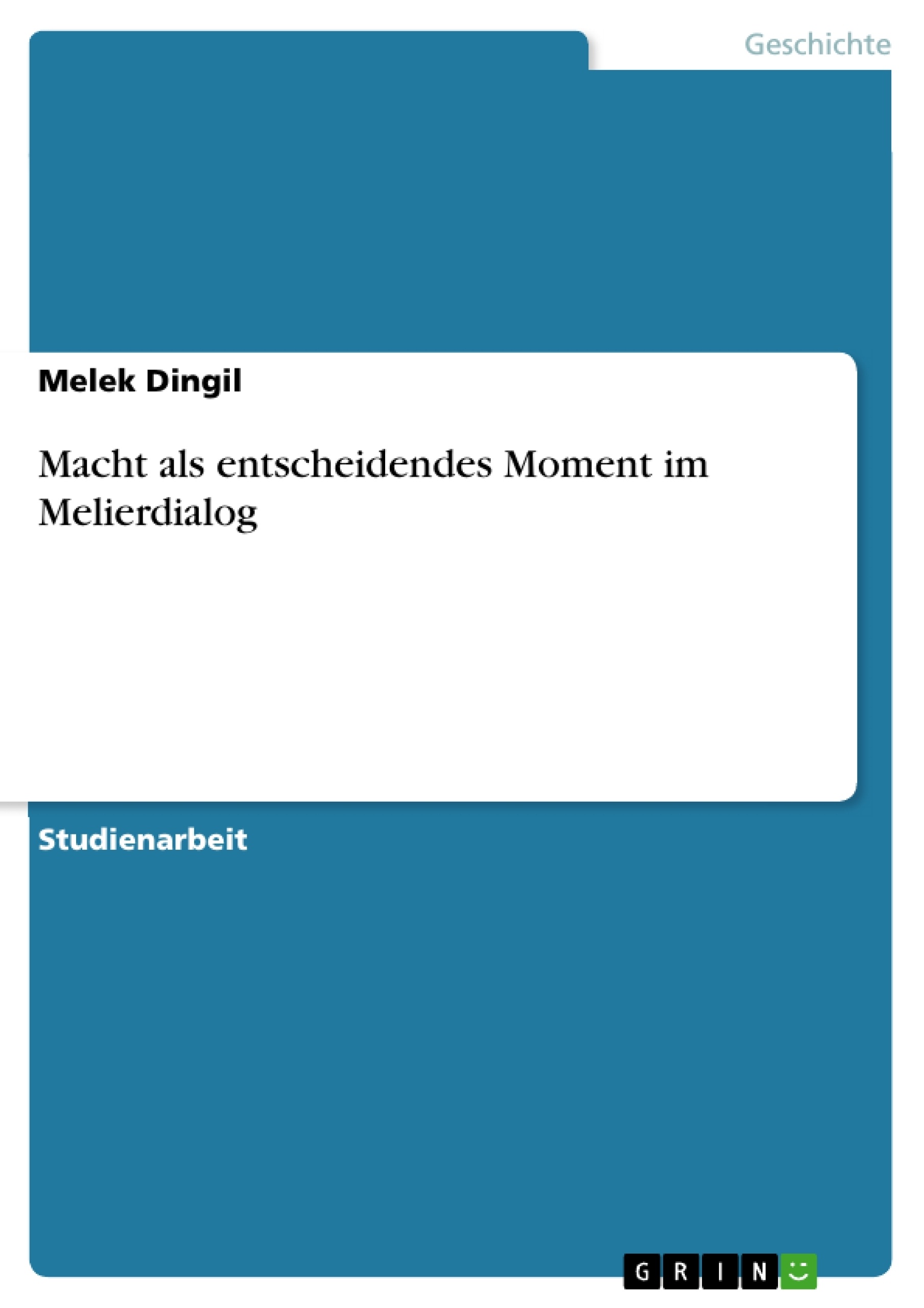Die vorliegende Arbeit hat den Melierdialog des Thukydides zum Gegenstand der
Untersuchung und beschäftigt sich dabei besonders mit der Frage, wieso es zu keinem
Kompromiss auf beiden Seiten kommen konnte.
Um dieser Frage sinnvoll nachgehen zu können, ist die Arbeit in zwei Teile gegliedert.
Dabei soll der erste Teil die Ausgangslage skizzieren, die der eigentlichen Verhandlung
vorausgeht und zugleich den Rahmen des Dialogs bildet. Ferner gilt es die jeweiligen
Standpunkte der Athener und Melier zu untersuchen, um einen möglichen
Zusammenhang mit dem Ausgang des Dialogs nachvollziehen zu können. Hierbei liegt
der Fokus der Analyse auf den Aspekten der Macht und des Rechts, in denen sich beide
Seiten unterscheiden.
Seine einzigartige, von Thukydides bewusst gewählte, Dialogform stellt den
Melierdialog nicht nur rein rhetorisch in den Mittelpunkt des Werkes, sondern bildet
dessen inhaltlichen Höhepunkt, indem er Einsichten in das Wesen der Menschen und
des Staates gewährt. Den Anspruch, dass sein Werk „ein Besitztum für alle Zeiten“ sein
soll, hat Thukydides mit dem Melierdialog insofern erfüllt, dass er anhand eines
konkreten Beispiels in der Geschichte das Allgemeine behandelt und beschreibt ohne
dabei für eine Seite Partei zu ergreifen oder gar seine eigene Meinung preiszugeben.
Auf Ursachen, die zu dem Feldzug der Athener gegen die Melier geführt haben
könnten, wie etwa die Ansicht des Historikers Max Treu, dass Melos ein
tributpflichtiges Mitglied des attischen Seebunds gewesen sei (Historia II, 1953/54, 253
ff.), kann in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden, zumal diese für unsere
Untersuchungen irrelevant sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ausgangslage
- Athen als überlegene Macht
- Rechtsanspruch und Machtbestreben
- Ablehnung des Rechts
- Neutralität als Zeichen von Schwäche
- Das Recht des Stärkeren
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Melierdialog aus Thukydides' "Der Peloponnesische Krieg" und untersucht, warum es zu keinem Kompromiss zwischen Athenern und Meliern kam. Sie gliedert sich in zwei Teile, die die Ausgangslage des Dialogs beleuchten und die Standpunkte beider Seiten untersuchen, um den Einfluss von Macht und Recht auf den Dialogverlauf nachzuvollziehen.
- Die Machtkonstellation zwischen Athen und Melos im Kontext des Peloponnesischen Krieges
- Die Rolle von Recht und Gerechtigkeit in der Argumentation der Athener und Melier
- Die Bedeutung von Rhetorik und Strategie im Melierdialog
- Die Darstellung des Konflikts zwischen Machtpolitik und Moral
- Thukydides' Geschichtsverständnis und sein Einsatz der Dialogform
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit stellt den Melierdialog als Gegenstand der Untersuchung vor und erläutert die Zielsetzung. Sie skizziert die Struktur der Arbeit, die sich in zwei Teile gliedert, die die Ausgangslage des Dialogs sowie die jeweiligen Standpunkte der Athener und Melier beleuchten.
Die Ausgangslage: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Umstände, die zur Belagerung von Melos durch die Athener führten. Es werden die militärischen Vorbereitungen der Athener beschrieben, die sich aus einer Überlegenheit in Macht und Ressourcen speisen. Die Neutralität von Melos wird als ein wesentlicher Aspekt des Dialogs hervorgehoben.
Athen als überlegene Macht: In diesem Kapitel wird der Fokus auf die Machtstellung der Athener im Verhältnis zu den Meliern gelegt. Die Athener versuchen, die Melier zu überzeugen, ohne ihnen vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Festlegung auf die Dialogform durch die Athener demonstriert ihre Überlegenheit.
Schlüsselwörter
Melierdialog, Thukydides, Peloponnesischer Krieg, Machtpolitik, Recht, Gerechtigkeit, Rhetorik, Strategie, Neutralität, Dialogform, Geschichtsverständnis.
- Quote paper
- Melek Dingil (Author), 2010, Macht als entscheidendes Moment im Melierdialog, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/206647