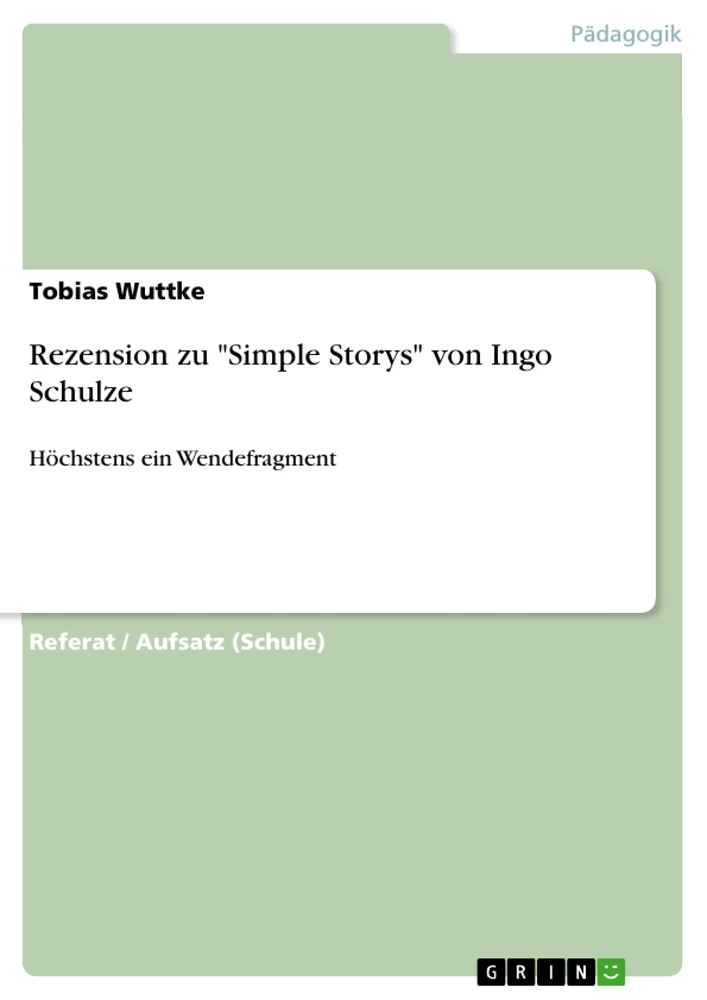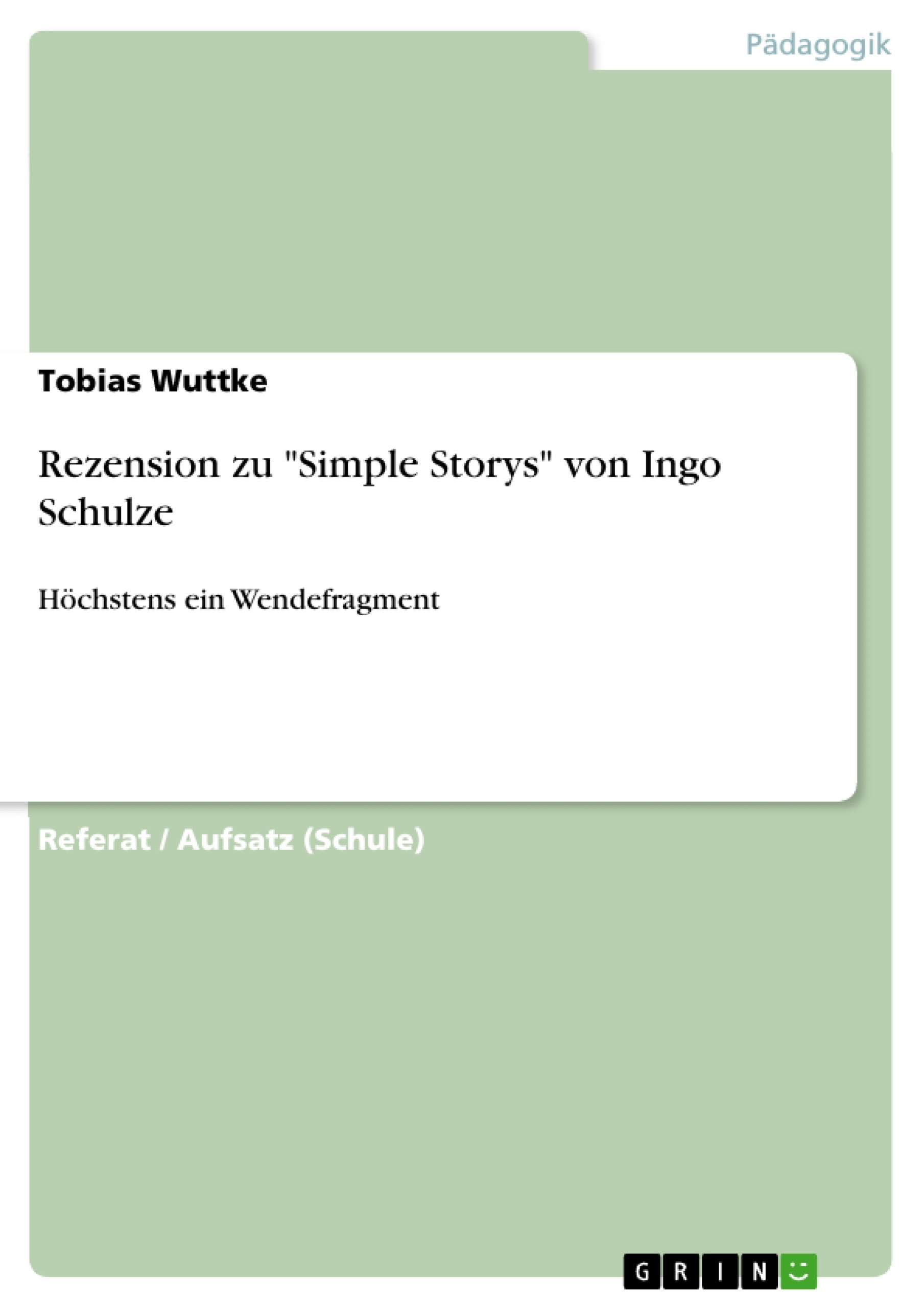Ingo Schulzes Erzählband „Simple Storys“ ist zwar sprachlich und stilistisch meisterhaft gelungen, darf aber nicht als der umfassende Wenderoman gelten...
Ingo Schulzes Erzählband „Simple Storys“ ist zwar sprachlich und stilistisch meisterhaft gelungen, darf aber nicht als der umfassende Wenderoman gelten.
Von Tobias Wuttke / 07.04.2012
Die Wiedervereinigung 1990 war das größte geschichtliche und gesellschaftliche Ereignis in der Bundesrepublik Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Manche sagen, die deutsche Wiedervereinigung und das mit ihr einhergehende Ende des Kalten Krieges habe erst das Ende des Zweiten Weltkriegs markiert. Fast alle Menschen in unserem Land, die sich mit Literatur befassen, sind sich deshalb einig, dass es ein Buch geben muss, dass dieses Thema würdig und umfassend umsetzt: Gesucht wird der „Wenderoman“. Der Literaturnobelpreisträger Günter Grass hat 1995 versucht, diesem allgemeinen Wunsch mit „Ein weites Feld“ nachzukommen. Er ist damals grandios gescheitert. Der Roman wurde von fast allen Kritikern und vor allem von Marcel Reich-Ranicki komplett verrissen.
Mit Ingo Schulzes Erzählband „Simple Storys“ dagegen schien das Buch zur Wende 1998 gefunden worden zu sein. Der damalige Kulturressortleiter des Magazins „Der Spiegel“, Wolfgang Höbel, sprach vom „lang ersehnten Roman über das vereinigte Deutschland“.
Der 1962 in Dresden geborene Schulze hatte zu der Zeit schon einen relativ hohen Bekanntheitsgrad und besaß die literarische Anerkennung, die ein Autor benötigt, um als Verfasser des „Wenderomans“ überhaupt in Frage zu kommen. Mit den Erzählungen „33 Augenblicke des Glücks“, die einen Querschnitt der postkommunistischen russischen Gesellschaft aus der Sicht eines Deutschen darlegen, hatte Schulze 1995 den literarischen Durchbruch geschafft. Von allen Seiten wurde der Autor für seine sprachliche und formale Begabung sowie seine Belesenheit, die sich durch Parallelen zu anderen Autoren der Weltliteratur in seinen eigenen Texten zeigte, gelobt. Nach seinem Debüt ließ sich Ingo Schulze drei Jahre Zeit, bis er 1998 mit „Simple Storys“ aufwartete. Er hatte zunächst mit dem Gedanken gespielt, ein Buch über seine Armee-Erfahrung zu verfassen, entschied sich aufgrund seiner Begeisterung für die amerikanische Erzählform der „Short Stories“ und den Episodenfilm „Short Cuts“, der auf Kurzgeschichten von Raymond Carver basiert, aber wieder für einen Erzählband.
„Simple Storys“ enthält 29 Kurzgeschichten, die verschiedene Schicksale in der thüringischen Stadt Altenburg zur Zeit der Wende oder kurz danach erzählen. Schulzes Erzählungen setzen häufig mitten in einer Situation ein. Manche Sachverhalte erschließen sich auch erst nach der Lektüre folgender Geschichten oder des Gesamtwerks. Insgesamt ergibt sich somit eine große ganze Geschichte, die die Situation der Bürger im sogenannten „Beitrittsgebiet“ erzählt. Die Anzahl der verschiedenen Charaktere ist überwältigend groß. So gibt es zum Beispiel den sein Leben lang SED-treuen Ernst Meurer, der nun orientierungslos vor sich hin vegetiert, seinen Stiefsohn Martin, der nach dem Unfalltod seiner Ehefrau und andauernder Arbeitslosigkeit am Ende „möglichst weit weg“ möchte, den erfolglosen und verzweifelten Künstler Enrico Friedrich, der schlussendlich im Treppenhaus verunglückt, sowie Edgar, Lydia, Patrick und Conni, deren Beziehungen reihenweise scheitern. Nahezu alle Charaktere wirken orientierungslos und irren durch ihr neues Leben, das sich durch die Wende entscheidend, offensichtlich aber nicht zum Positiven, verändert hat. Hinzu kommt, dass fast alle einsam sind, selbst die, die sich in Beziehungen befinden. Manch einer leidet auch unter dauerhaftem Geldmangel.
Dass dieses Bild der Tristesse und der Orientierungslosigkeit letztlich entsteht, ist auch dem Schreibstil Ingo Schulzes geschuldet. Er beschreibt alltägliche Situationen entsprechend seiner Orientierung an der amerikanischen „Short Story“ und verwendet dabei eine einfache, klare und deshalb unsentimentale Sprache. Dem Leser drängt sich eine kalte, beklemmende Atmosphäre auf. Dies liegt auch daran, dass ein auktorialer Erzähler, der das Unglück der Charaktere kommentiert oder begründet, fehlt. Stattdessen wird der Leser von einem distanzierten Erzähler durch die Geschichten geführt, der mitten in der Situation mit der Beschreibung beginnt und dem Leser die Zusammenhänge nie sofort erläutert. Insgesamt sind alle Erzählungen kunstvoll miteinander vernetzt, das unmittelbare Verständnis wird dadurch allerdings an einigen Stellen erheblich eingeschränkt, was den Leser das ein oder andere Mal entnerven kann. Dazu kommt, dass die Kurzgeschichten häufig aus der Ich-Perspektive des jeweiligen Protagonisten geschildert werden, was ebenfalls eine objektive Sicht und ein eindeutiges Verständnis erschwert. All dies führt allerdings dazu, dass der Leser genötigt wird, sich in die Charaktere hineinzuversetzen, da er sich nicht auf auktoriale Kommentare und Wertungen des Erzählers verlassen kann. Schulze gelingt es so in beeindruckender Manier, den Kontakt des Lesers mit der Lebenswelt der Personen trotz einer distanzierten Erzählweise herzustellen. Man könnte annehmen, dass bei einer solch kalten und sachlichen Sprache sprachliche Bilder in den Hintergrund treten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Beim Leser bleiben einige Bilder hängen, vorwiegend aufgrund ihrer grotesken Skurrilität. Nach der Lektüre erinnert man sich genau, auf welch tragikomische Weise Enrico Friedrich im Treppenhaus verunglückt ist. Man erinnert sich ebenfalls daran, wie Martin Meurer in der letzten Geschichte in seinem Fischkostüm verprügelt wird. All diese Bilder bleiben und verstärken das Gefühl des Unglücks und der Orientierungslosigkeit der Charaktere in Schulzes Erzählband. Es bleibt also zu sagen, dass Schulzes sprachliche und stilistische Fertigkeiten schlichtweg beeindruckend und eines „Wenderomans“ würdig sind.
[...]
- Quote paper
- Tobias Wuttke (Author), 2012, Rezension zu "Simple Storys" von Ingo Schulze, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/206465