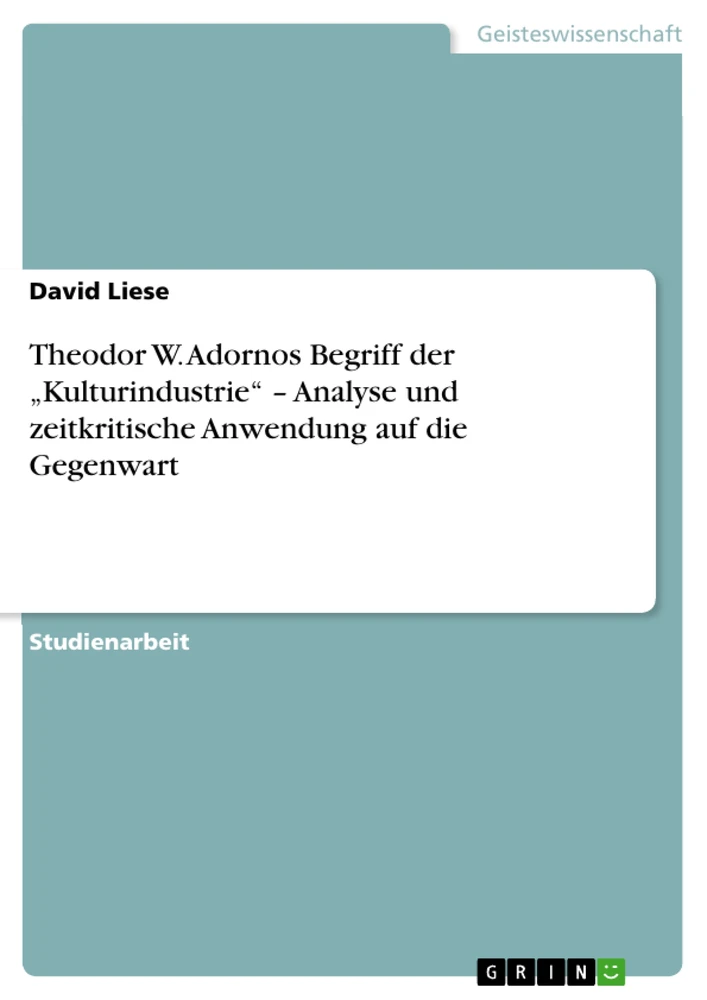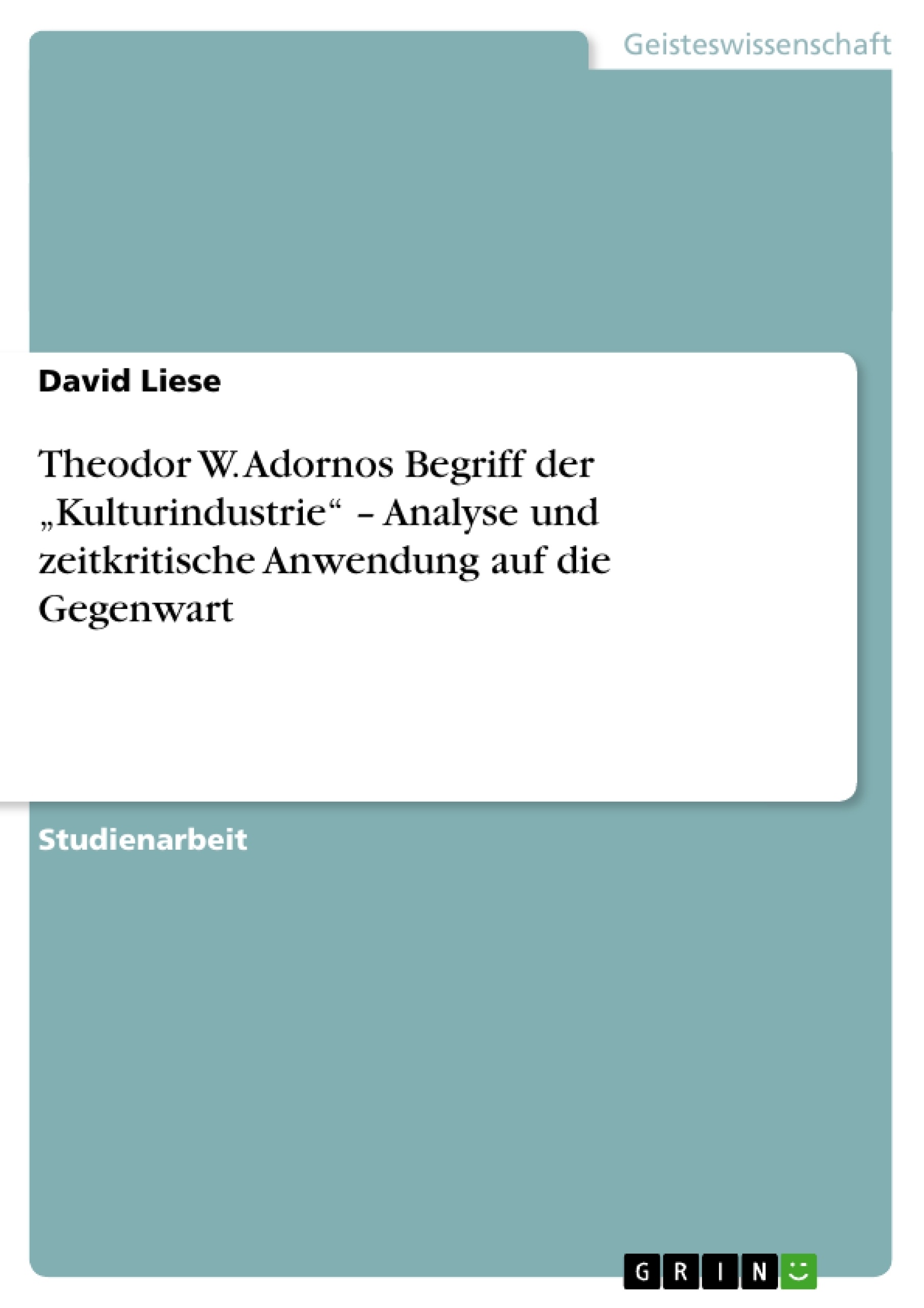Adornos Kulturkritik, die er in der „Dialektik der Aufklärung“ im Kapitel „Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug“ niederlegt, gilt als besonders einflussreich nicht nur in der Philosophie, sondern auch in benachbarten wissenschaftlichen Disziplinen wie etwa der Medientheorie. Gnadenlos und zynisch scheint Adorno die kulturelle Welt und ihren „autoritäre[n] Charakter gerade im demokratischsten Land“ zu entlarven, wenn er etwa von der perfekt kalkulierten Massenunterhaltung aus Hollywood oder dem immergleichen harmonischen Aufbau eines Songs in der Popularmusik spricht, den „fertige[n] Clichés, beliebig hier und dort zu verwenden, und allemal völlig definiert durch den Zweck“ ihrer Verkaufstauglichkeit.
Aus heutiger Sicht scheint die Frage interessant, inwiefern Adornos Kulturkritik des Spätkapitalismus sich auf das 21. Jahrhundert anwenden lässt. In vielen Bereichen gerade der Unterhaltungsbranche scheinen für die damalige Zeit völlig undenkbare neue Superlative erreicht und sämtliche Tabus gebrochen worden zu sein. Philosophie als Zeitkritik – inwiefern kann sie prophetische Züge tragen und nicht nur erklären, wie die Welt beschaffen ist, sondern auch prognostizieren, wie sie beschaffen sein wird?
Inhaltsverzeichnis
- Theodor W. Adorno als herausragender Philosoph der Moderne
- Theodor W. Adornos Begriff der „Kulturindustrie“ – Analyse und zeitkritische Anwendung auf die Gegenwart
- Drei Dimensionen von „Kulturindustrie“ in Theodor W. Adornos und Max Horkheimers „Dialektik der Aufklärung“
- Kulturindustrie als autoritäres Moment: Vereinheitlichung
- Kulturindustrie als Affirmation bestehender Herrschaft: Der Massenbetrug
- Vermehrung von Kapital als Sinn von Kultur: Kunst als Ware
- Übertrag von Adornos „Kulturindustrie“-Begriff auf die Gegenwart: Aktualität der Adorno'schen Zeitkritik
- Fortschreitende Kommerzialisierung und Materialisierung von Kultur
- Vereinheitlichung und Herrschaftsstabilisierung durch Medien und Kultur: Dialektik des Pluralismus
- Eine Gegenperspektive: Subversion und -kultur - Das Internet
- Philosophieren als Zeitkritik - Leistung und Grenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, den Begriff der „Kulturindustrie“, wie er von Theodor W. Adorno entwickelt wurde, zu analysieren und seine zeitkritische Relevanz für die Gegenwart zu beleuchten.
- Die Analyse der „Kulturindustrie“ als Ausdruck der autoritären Tendenzen in der modernen Gesellschaft.
- Die Kritik an der „Kulturindustrie“ als Instrument der Affirmation bestehender Machtverhältnisse.
- Die Kommerzialisierung und Vermarktung von Kultur als zentrales Merkmal der „Kulturindustrie“.
- Die Frage nach der Aktualität des Adorno'schen Begriffs im Kontext der gegenwärtigen Medienlandschaft.
- Die Möglichkeiten und Grenzen philosophischer Zeitkritik in Bezug auf die Entwicklung der „Kulturindustrie“.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Vorstellung Theodor W. Adornos als herausragendem Philosophen der Moderne. Es wird auf seine zentralen Denkanstöße und seine Kritik an der „Dialektik der Aufklärung“ eingegangen, die er gemeinsam mit Max Horkheimer entwickelte.
Im zweiten Kapitel wird Adornos Konzept der „Kulturindustrie“ eingehend analysiert. Es werden die drei Dimensionen der „Kulturindustrie“ – die Vereinheitlichung, die Affirmation bestehender Herrschaft und die Kommerzialisierung von Kultur – beleuchtet und durch Beispiele aus der Gegenwart illustriert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Frage, inwiefern Adornos philosophische Zeitkritik für die Gegenwart relevant ist. Es wird die Rolle der Medien und der digitalen Kultur im Kontext der „Kulturindustrie“ untersucht und die Möglichkeiten und Grenzen philosophischer Kritik diskutiert.
Schlüsselwörter
Kulturindustrie, Aufklärung, Kritik, Zeitkritik, Moderne, Kommerzialisierung, Medien, Digitalisierung, Subversion, Philosophie, Soziologie, Herrschaft, Autorität, Massenbetrug.
- Arbeit zitieren
- David Liese (Autor:in), 2011, Theodor W. Adornos Begriff der „Kulturindustrie“ – Analyse und zeitkritische Anwendung auf die Gegenwart, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/206175