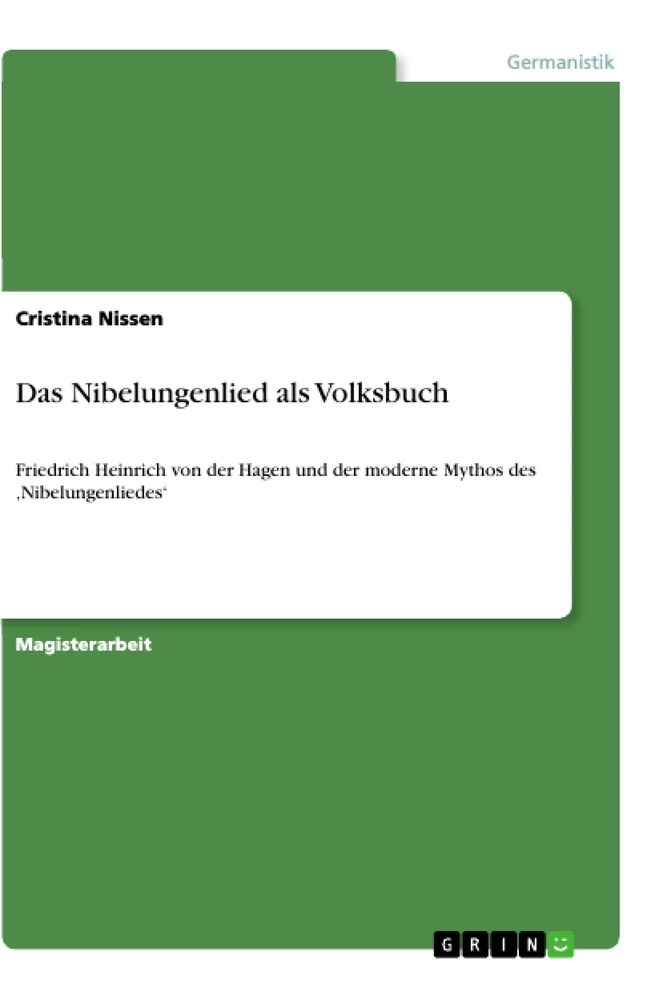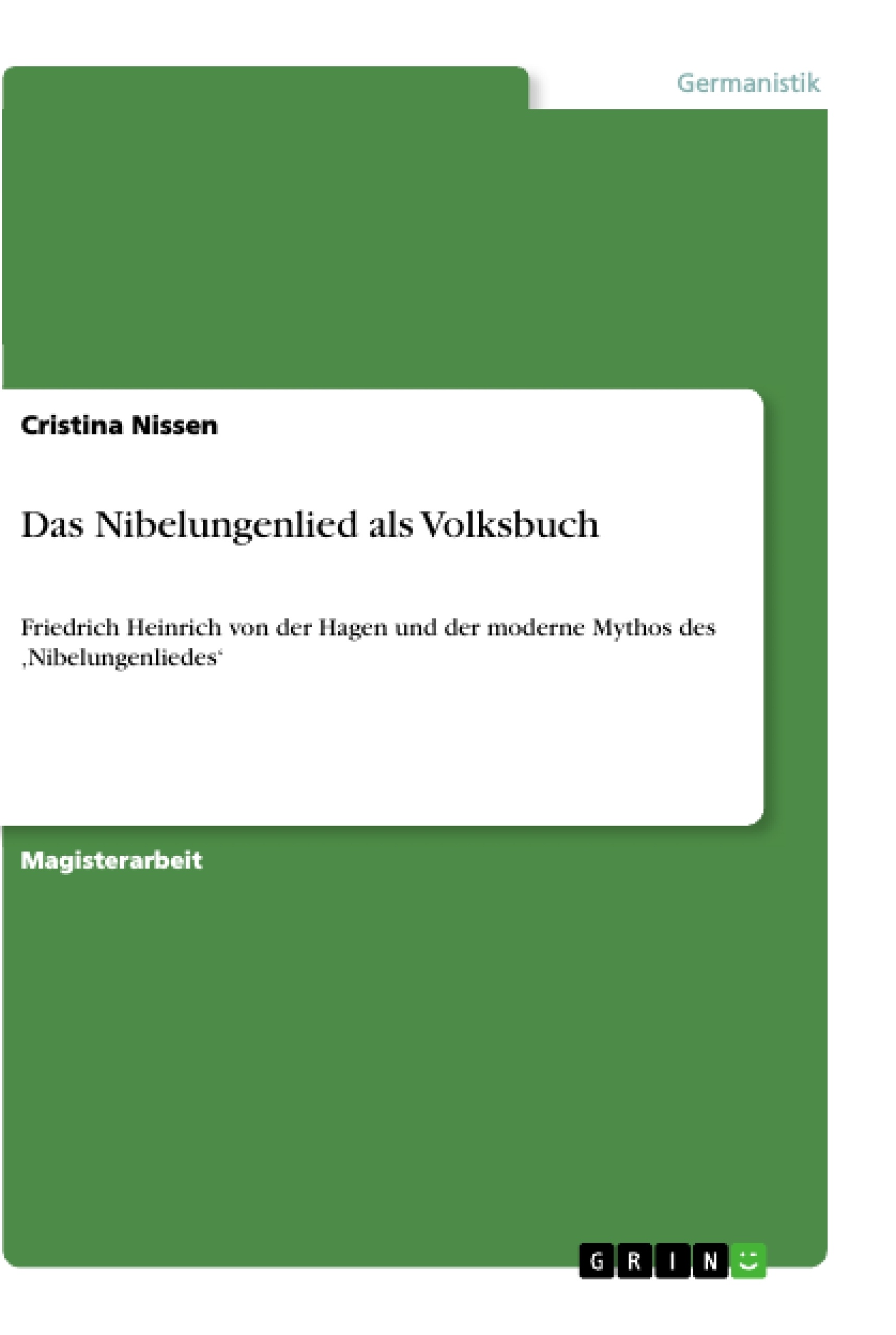Die Frage ist: was geschieht mit dem Epos "Nibelungenlied", wenn man sich mit ihm beschäftigt, ohne seine Rezeptionsgeschichte zu berücksichtigen? Ist es überhaupt möglich, ein solches Verfahren der Textanalyse anzubringen, und zu irgendwelchen befriedigenden Ergebnissen zu kommen?
In dieser Arbeit wird die These getestet, dass es keine Rezeption des
Nibelungenliedes gibt, die nicht direkt oder indirekt beeinflusst ist durch seine eigene, semantisch aufgeladene Rezeptionsgeschichte. Diese ist maßgeblich gekennzeichnet durch die völkisch-nationale Deutung Friedrich Heinrich von der Hagens; diejenige, die im Bewusstsein der Allgemeinheit überlebt hat und auch bis heute noch Echos in der wissenschaftlichen Bearbeitung findet, gewollt oder nicht.
Zu diesem Zweck wird auch darauf eingegangen, wie Zeitgenossen Hagens Arbeit bewertet haben, und welchen direkten und indirekten Einfluss er durch sein Werk auf die Nibelungenforschung, sowie auf die Popularität des Stoffes hatte. Speziell werden auch die Deutungstradition und die Schwierigkeiten einer Deutung dargelegt, denn dies ist wichtig um zu beweisen, dass auch die anti-nationale Rezeption stark von der frühen, ‚völkischen‘ geprägt ist. Zudem werden zwei verschiedene Rezeptionstraditionen unterschieden:
Nibelungen-Stoff und breite Masse (alles, was nicht akademisch ist) versus Nibelungenlied und akademische Rezeption.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Inhalt und methodische Ansätze
- 1.2. Gedanken über die verwendeten Quellen
- 2. Die Nibelungen: Von „Sage“ über „Epos" zum „Volksbuch"
- 2.1 Das Umfeld der Entstehung des Heldenepos Nibelungenlied
- 2.2. Das Nibelungenlied: Heldensage, Stoffkreis, Mythos: Begriffsdefinitionen und -abgrenzungen
- 2.3 Der germanisch-heroische Stoff und seine Rezeption
- 2.3.1 Das germanische Weltbild reflektiert im Nibelungenlied
- 2.3.2 Die Begriffe „deutsch“ und „germanisch“ in der Romantik: Die Suche nach einem positiven deutschen Gründungsmythos und das Nibelungenlied
- 2.4. Schwierigkeiten der Deutung des Nibelungenliedes
- 2.5 Die Suche nach nationaler Identität und einer deutschen „Volkspoesie"
- 2.5.1 Der Mythos vom Volksbuch und das Nibelungenlied
- 3. Die Möglichkeiten einer kontextfreien Rezeption
- 3.1. Sinnzuweisungsstrategien im Prozess des Verstehens: Theorien der Bedeutungszuweisungen bei literarischen Texten
- 3.2. Der Text, seine „Wahrheit“ und der Rezipient
- 3.3. „Bedeutungen“ eines Textes als Produkt der Ziele des Rezipienten
- 3.3.1. Die Psyche des Lesers als Regulierungsinstanz
- 3.3.2. Soziokulturelle Normierung als Regulierungsinstanz
- 4. Das Nibelungenlied- Der Werdegang des Mythos „Nationalepos"
- 4.1. Theorien zur Entstehung des Nibelungenliedes aus seinem „Sagenkreis"
- 4.1.1. Andreas Heuslers „Ältere Nibelungenôt“: Die Suche nach einem Archetypus
- 4.1.2. Johann Gottfried Herder, Karl Lachmann, die Brüder Grimm und die „Volkslied“-Theorie
- 4.2. Die „Wiederentdeckung“ des Epos: Ein künstlicher Ursprungsmythos
- 4.3. Die Nibelungen als „deutsches Nationalepos“: Die Verselbständigung der nationalen Deutungstradition vom Achtzehnten zum Zwanzigsten Jahrhundert
- 4.3.1. Die Zeit von 1755 bis 1871: „Heldische“ Lektüre als Legitimation von Vaterlandsgefühlen
- 4.3.2. Die Weimarer Republik: Veränderte politische Voraussetzungen für die Nibelungen-Rezeption
- 4.3.3. Kulminierung eines Rezeptionsmythos: Das überspitzte Nibelungen-Pathos im Nationalsozialismus
- 4.3.4. Post-1945: Distanzierungen von der Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes
- 4.4. Friedrich Heinrich von der Hagen und das Nibelungenlied
- 4.4.1. Von der Hagen und die Anfänge der Germanistik
- 4.4.2. Die „Erneuung“ von der Hagens: Methoden, Absichten und Ziele seiner Nibelungen-Überarbeitungen
- 4.4.3. Das „Nationalepos“ als „Buch für das Volk“: Das Nibelungenlied als Katalysator vaterländischer Gefühle
- 4.4.4. Von der Hagens Kritik an Bodmer
- 4.4.5. Von der Hagens „Erneuung“ und die Kritiker
- 5. Der „Nibelungen-Stoff“ und die nicht-wissenschaftliche Rezeption versus Nibelungenlied und akademische Rezeption
- 5.1 Populäre Kultur und die Nibelungen: Beispiele der Rezeption in Musik, Literatur und Film
- 5.1.1. Friedrich Hebbels „Nibelungen-Trilogie“
- 5.1.2. Richard Wagner und der Ring des Nibelungen
- 5.1.3. Fritz Langs Nibelungen
- 5.1.4. „Die Nibelungen für unsere Zeit erzählt“: Das Nibelungenlied in der Unterhaltungsliteratur nach 1945
- 5.1.5. „Nibelungentreue“- das Schlagwort in der populären Kultur des einundzwanzigsten Jahrhunderts
- 5.2. Spuren des Interpretationsmodells von der Hagens in der wissenschaftlichen Rezeption des Nibelungenliedes nach 1945
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von Friedrich Heinrich von der Hagen und die Entwicklung des Mythos um das „Nibelungenlied“ als deutsches Nationalepos. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Interpretationen und die Verknüpfung des Stoffes mit nationalen Identitätsvorstellungen in unterschiedlichen Epochen.
- Die Entstehung und Entwicklung des Nibelungen-Mythos
- Die Rolle des Nibelungenliedes in der Konstruktion nationaler Identität
- Die Interpretationen des Nibelungenliedes in verschiedenen Epochen
- Der Einfluss von Friedrich Heinrich von der Hagen auf die Rezeption des Nibelungenliedes
- Der Unterschied zwischen der wissenschaftlichen und der populären Rezeption des Nibelungenliedes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Bekanntheitsgrad des Nibelungenliedes und den Nibelungenstoffes in der breiten Bevölkerung. Sie hebt die unterschiedlichen Begriffsverständnisse und die vielschichtige Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes hervor, sowie dessen Verwendung im Nationalsozialismus und im heutigen Sprachgebrauch (Nibelungentreue). Sie deutet die zentrale Fragestellung der Arbeit an: die Untersuchung der Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes im Fokus auf Friedrich Heinrich von der Hagen und den Mythos des "Nationalepos".
2. Die Nibelungen: Von „Sage“ über „Epos" zum „Volksbuch": Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Nibelungenstoffes von der Sage zum Epos und schließlich zum Volksbuch. Es beleuchtet die Entstehung des Heldenepos im Kontext des mittelalterlichen germanischen Weltbildes und untersucht begriffliche Abgrenzungen wie Heldensage, Stoffkreis und Mythos. Der Einfluss der Romantik auf die Deutung des Nibelungenliedes als Ausdruck deutscher Identität und die Schwierigkeiten seiner Deutung werden ebenfalls diskutiert. Schließlich analysiert das Kapitel die Suche nach einer nationalen Identität im 19. Jahrhundert und den Mythos des Nibelungenliedes als „Volksbuch“.
3. Die Möglichkeiten einer kontextfreien Rezeption: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Theorien der Bedeutungszuweisung bei literarischen Texten und diskutiert, wie der Rezipient den Text interpretiert. Es analysiert den Einfluss der Psyche des Lesers und soziokultureller Normen auf die Bedeutung, die einem Text zugeschrieben wird. Der Fokus liegt darauf, wie subjektive und gesellschaftliche Faktoren die Interpretation des Nibelungenliedes beeinflussen.
4. Das Nibelungenlied- Der Werdegang des Mythos „Nationalepos": Dieses Kapitel analysiert die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes als "Nationalepos". Es beginnt mit Theorien zu seiner Entstehung und der „Wiederentdeckung“ im 18. Jahrhundert, beleuchtet die unterschiedliche Nutzung und Interpretation des Nibelungenliedes in verschiedenen historischen Perioden – von der Romantik über die Weimarer Republik bis zum Nationalsozialismus. Es befasst sich mit der Rolle von Friedrich Heinrich von der Hagen und seinen Bemühungen, das Nibelungenlied als "Buch für das Volk" zu etablieren, und untersucht die kritischen Reaktionen auf seine Arbeit.
5. Der „Nibelungen-Stoff“ und die nicht-wissenschaftliche Rezeption versus Nibelungenlied und akademische Rezeption: Dieses Kapitel vergleicht die nicht-wissenschaftliche (populäre) und die akademische Rezeption des Nibelungenliedes. Es präsentiert Beispiele für die Rezeption in Musik, Literatur und Film, von Hebbels Nibelungentriologie bis hin zu Wagner und Lang. Es untersucht die Verwendung des „Nibelungentreue“-Motivs in der Populärkultur und analysiert den Einfluss von von der Hagens Interpretationsmodell auf die spätere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Nibelungenlied.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Nibelungensage, Nibelungenstoff, Nationalepos, Volksbuch, Friedrich Heinrich von der Hagen, Rezeptionsgeschichte, nationale Identität, Germanistik, Romantik, Nationalsozialismus, Populärkultur, wissenschaftliche Rezeption.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Nibelungenlied: Rezeptionsgeschichte und der Einfluss von Friedrich Heinrich von der Hagen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes, insbesondere die Rolle von Friedrich Heinrich von der Hagen und die Entwicklung des Mythos um das Nibelungenlied als deutsches Nationalepos. Sie beleuchtet verschiedene Interpretationen und die Verknüpfung des Stoffes mit nationalen Identitätsvorstellungen in unterschiedlichen Epochen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung des Nibelungen-Mythos, die Rolle des Nibelungenliedes in der Konstruktion nationaler Identität, dessen Interpretationen in verschiedenen Epochen, den Einfluss von Friedrich Heinrich von der Hagen auf die Rezeption, und den Unterschied zwischen wissenschaftlicher und populärer Rezeption.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik, Bekanntheitsgrad des Nibelungenliedes, unterschiedliche Begriffsverständnisse, vielschichtige Rezeptionsgeschichte, Verwendung im Nationalsozialismus und heutiger Sprachgebrauch ("Nibelungentreue"), zentrale Fragestellung der Arbeit.
Kapitel 2 (Die Nibelungen: Von „Sage“ über „Epos" zum „Volksbuch"): Entwicklung des Nibelungenstoffes von der Sage zum Epos und Volksbuch, Entstehung des Heldenepos im Kontext des mittelalterlichen germanischen Weltbildes, begriffliche Abgrenzungen (Heldensage, Stoffkreis, Mythos), Einfluss der Romantik, Schwierigkeiten der Deutung, Suche nach nationaler Identität im 19. Jahrhundert und der Mythos des Nibelungenliedes als „Volksbuch“.
Kapitel 3 (Die Möglichkeiten einer kontextfreien Rezeption): Theorien der Bedeutungszuweisung bei literarischen Texten, Interpretation des Textes durch den Rezipienten, Einfluss der Psyche des Lesers und soziokultureller Normen auf die Bedeutung eines Textes, subjektive und gesellschaftliche Faktoren bei der Interpretation des Nibelungenliedes.
Kapitel 4 (Das Nibelungenlied- Der Werdegang des Mythos „Nationalepos"): Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes als "Nationalepos", Theorien zur Entstehung, „Wiederentdeckung“ im 18. Jahrhundert, unterschiedliche Nutzung und Interpretation in verschiedenen historischen Perioden (Romantik, Weimarer Republik, Nationalsozialismus), Rolle von Friedrich Heinrich von der Hagen, kritische Reaktionen auf seine Arbeit.
Kapitel 5 (Der „Nibelungen-Stoff“ und die nicht-wissenschaftliche Rezeption versus Nibelungenlied und akademische Rezeption): Vergleich zwischen nicht-wissenschaftlicher (populärer) und akademischer Rezeption, Beispiele für die Rezeption in Musik, Literatur und Film (Hebbels Nibelungentriologie, Wagner, Lang), Verwendung des „Nibelungentreue“-Motivs in der Populärkultur, Einfluss von von der Hagens Interpretationsmodell auf die spätere wissenschaftliche Auseinandersetzung.
Welche Rolle spielt Friedrich Heinrich von der Hagen?
Die Arbeit untersucht ausführlich die Rolle von Friedrich Heinrich von der Hagen und seinen Einfluss auf die Rezeption des Nibelungenliedes. Seine Bemühungen, das Nibelungenlied als "Buch für das Volk" zu etablieren, und die darauf folgenden kritischen Reaktionen werden analysiert.
Wie wird das Nibelungenlied in der Populärkultur rezipiert?
Die Arbeit beleuchtet die Rezeption des Nibelungenstoffes in der Populärkultur anhand von Beispielen aus Musik, Literatur und Film. Die Verwendung des Begriffs "Nibelungentreue" in der heutigen Populärkultur wird ebenfalls analysiert.
Wie unterscheidet sich die wissenschaftliche von der populären Rezeption des Nibelungenliedes?
Die Arbeit vergleicht die wissenschaftliche und die populäre Rezeption des Nibelungenliedes und untersucht die Unterschiede in den Interpretationsansätzen und den jeweiligen Zielen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Nibelungenlied, Nibelungensage, Nibelungenstoff, Nationalepos, Volksbuch, Friedrich Heinrich von der Hagen, Rezeptionsgeschichte, nationale Identität, Germanistik, Romantik, Nationalsozialismus, Populärkultur, wissenschaftliche Rezeption.
- Quote paper
- Cristina Nissen (Author), 2011, Das Nibelungenlied als Volksbuch, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/205978