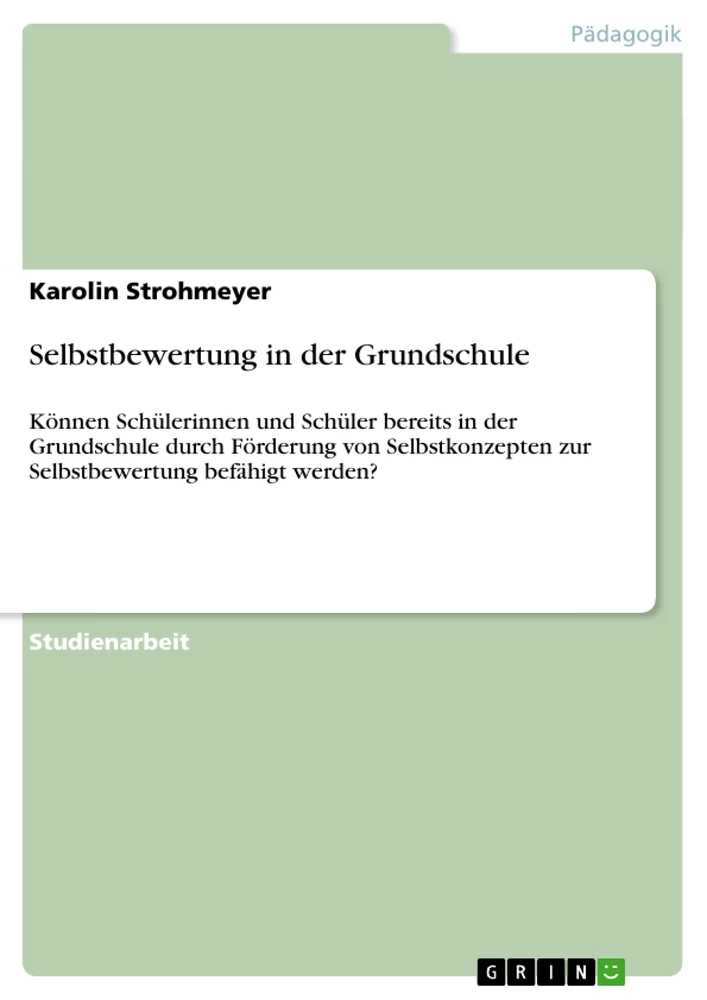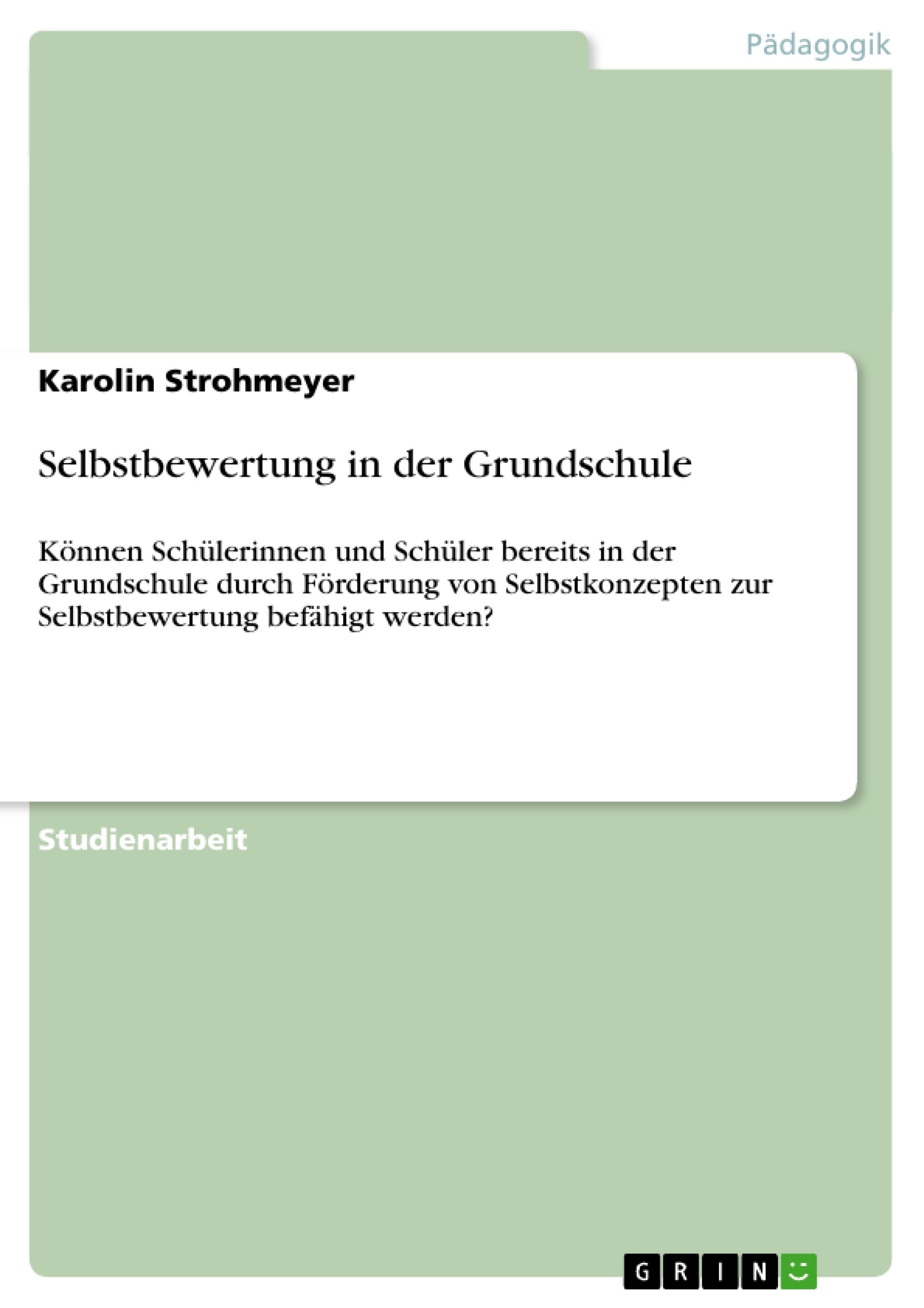Besonders beim Eintritt in die erste Klasse in der Grundschule fragen sich die Schüler bzw. Schülerinnen, aber auch Elternteile: bin ich/ ist mein Kind den Anforderungen gewachsen, kann man das ABC genauso schnell und gut lernen wie der Sitznachbar? Was ist, wenn ich nicht gut lernen kann und eine schlechte Note mit nach Hause bringe? Dieser Leistungsdruck im schulischen Lernen fordert und fördert eine Art von Selbstbewährung und zwar zum einen bei Erfolg, aber auch bei Misserfolg. "Zufriedenheit, Stolz, aber auch Selbstzweifel und Selbstabwertung stehen am Ende solcher Selbst- und Fremdbewertungsprozesse." In der vorliegenden Hausarbeit wird auf die Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung einschließlich der Bezugsnormen und der Fehlerquellen eingegangen. Weiter hin werden die Anforderungen an Leistungsbewertung dargelegt. Will man nun Schülerinnen und Schüler zum selbsttätigen Lernen befähigen, dann müssen sie ebenso eine Fähigkeit zur Selbstbeurteilung entwickeln können. Somit stellt sich die Frage, ob Schülerinnen und Schüler bereits in der Grundschule durch Förderung von Selbstkonzepten in der Lage sind, ihre Leistungen selbst zu bewerten. So liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf Möglichkeiten zur Entwicklung von Selbstkonzepten in der Grundschule, insbesondere mit der Zielsetzung zur Befähigung zur Selbstbewertung. Das letzte Kapitel stellt die Konsequenzen für den Schulalltag dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung
- 2.1 Definition des Leistungsbegriffs
- 2.2 Geschichtlicher Abriss
- 2.3 Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung
- 2.4 Fehlerquellen bei der Leistungsbeurteilung
- 3. Anforderungen an Leistungsbewertung in Grundschulen
- 4. Selbstkonzepte in der Grundschule
- 4.1 Definition Selbstkonzept
- 4.2 Ansätze und Modelle
- 4.3 Einflussfaktoren auf die Genese von Selbstkonzepten bei Grundschulkindern
- 4.2 Selbstbewertung
- 4.2.1 Funktion und Ziele
- 4.2.2 Selbstbewertung lernen
- 4.2.3 Selbstbewertung in der Grundschule
- 4.2.4 Einwände gegen Selbstbewertung
- 5. Konsequenzen für den Schulalltag
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung in der Grundschule und fragt, ob die Förderung von Selbstkonzepten Schülerinnen und Schüler zur Selbstbewertung befähigen kann. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Selbstkonzepten und deren Beitrag zur Selbstbewertungsfähigkeit.
- Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung
- Definition und geschichtlicher Abriss des Leistungsbegriffs
- Anforderungen an die Leistungsbewertung in der Grundschule
- Entwicklung von Selbstkonzepten in der Grundschule
- Selbstbewertung als Ziel und Methode
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Leistungsbewertung in der Grundschule ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Befähigung von Schülerinnen und Schülern zur Selbstbewertung durch Förderung von Selbstkonzepten. Sie hebt die Bedeutung von Selbstbewältigungsprozessen im Kontext von Erfolg und Misserfolg hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung, Anforderungen an diese, sowie die Entwicklung von Selbstkonzepten und Selbstbewertung in der Grundschule umfasst. Die Arbeit fokussiert sich auf die Möglichkeiten, Selbstkonzepte zu fördern, um die Selbstbewertungskompetenz zu entwickeln, und schließt mit einem Ausblick auf die Konsequenzen für den Schulalltag.
2. Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung: Dieses Kapitel analysiert den vielschichtigen Leistungsbegriff, indem es zwischen gesellschaftlichen, psychologischen und pädagogischen Dimensionen unterscheidet. Es beleuchtet die gesellschaftlichen Funktionen von Schule im Zusammenhang mit Leistung (Qualifikation, Selektion, Legitimation, Information, Sozialisierung) und diskutiert die Schwierigkeiten bei der Definition pädagogischer Leistungsanforderungen, die von unreflektierten Traditionen, impliziten Vorstellungen von Bildung und Erwartungen externer Systeme beeinflusst werden. Es wird kritisch hinterfragt, was ein Schüler in einem bestimmten Alter tatsächlich können muss und welche pädagogischen Prinzipien bei der Leistungsbeurteilung berücksichtigt werden sollten, wie z.B. die Berücksichtigung des subjektiven Lebens des Kindes, der Prozessorientierung und der Vermeidung von Konkurrenzlernen. Der historische Abriss zeigt auf, dass die Diskussion um Leistungsbewertung und gerechte Alternativen bereits seit den 70er Jahren geführt wird.
Häufig gestellte Fragen zu: Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung in der Grundschule und die Förderung von Selbstkonzepten
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung in der Grundschule. Der zentrale Fokus liegt auf der Frage, ob die Förderung von Selbstkonzepten Schülerinnen und Schüler zur Selbstbewertung befähigen kann. Die Arbeit analysiert die Entwicklung von Selbstkonzepten und deren Beitrag zur Selbstbewertungsfähigkeit.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung, Definition und geschichtlicher Abriss des Leistungsbegriffs, Anforderungen an die Leistungsbewertung in der Grundschule, Entwicklung von Selbstkonzepten in der Grundschule und Selbstbewertung als Ziel und Methode. Sie umfasst eine detaillierte Betrachtung der Entwicklung von Selbstkonzepten und deren Einfluss auf die Fähigkeit zur Selbstbewertung.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Chancen und Grenzen der Leistungsbewertung (inkl. Definition des Leistungsbegriffs, geschichtlicher Abriss, Bezugsnormen und Fehlerquellen), Anforderungen an Leistungsbewertung in Grundschulen, Selbstkonzepte in der Grundschule (inkl. Definition, Ansätze, Einflussfaktoren und Selbstbewertung mit ihren Funktionen, Zielen, Lernprozessen, Anwendung in der Grundschule und Einwänden dagegen), Konsequenzen für den Schulalltag und Fazit.
Wie wird der Leistungsbegriff in der Arbeit definiert?
Der Leistungsbegriff wird vielschichtig analysiert, indem zwischen gesellschaftlichen, psychologischen und pädagogischen Dimensionen unterschieden wird. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftlichen Funktionen von Schule im Zusammenhang mit Leistung (Qualifikation, Selektion, Legitimation, Information, Sozialisierung) und diskutiert die Schwierigkeiten bei der Definition pädagogischer Leistungsanforderungen.
Welche Bedeutung haben Selbstkonzepte in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung von Selbstkonzepten in der Grundschule und deren Einfluss auf die Selbstbewertungsfähigkeit. Sie analysiert Einflussfaktoren auf die Genese von Selbstkonzepten und betrachtet Selbstbewertung als Ziel und Methode zur Förderung der Selbstbewertungskompetenz. Die Arbeit erörtert, wie die Förderung von Selbstkonzepten zur Befähigung von Schülerinnen und Schülern zur Selbstbewertung beitragen kann.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die Konsequenzen der Untersuchung für den Schulalltag aufzeigt. Sie fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen. Die genauen Schlussfolgerungen werden im Kapitel "Fazit" detailliert dargelegt.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methode. Sie untersucht und analysiert bestehende Literatur und Theorien zur Leistungsbewertung und Selbstkonzeptentwicklung. Die Arbeit stützt sich auf eine kritische Auseinandersetzung mit der Literatur und deren Interpretation.
- Arbeit zitieren
- Karolin Strohmeyer (Autor:in), 2012, Selbstbewertung in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/205236