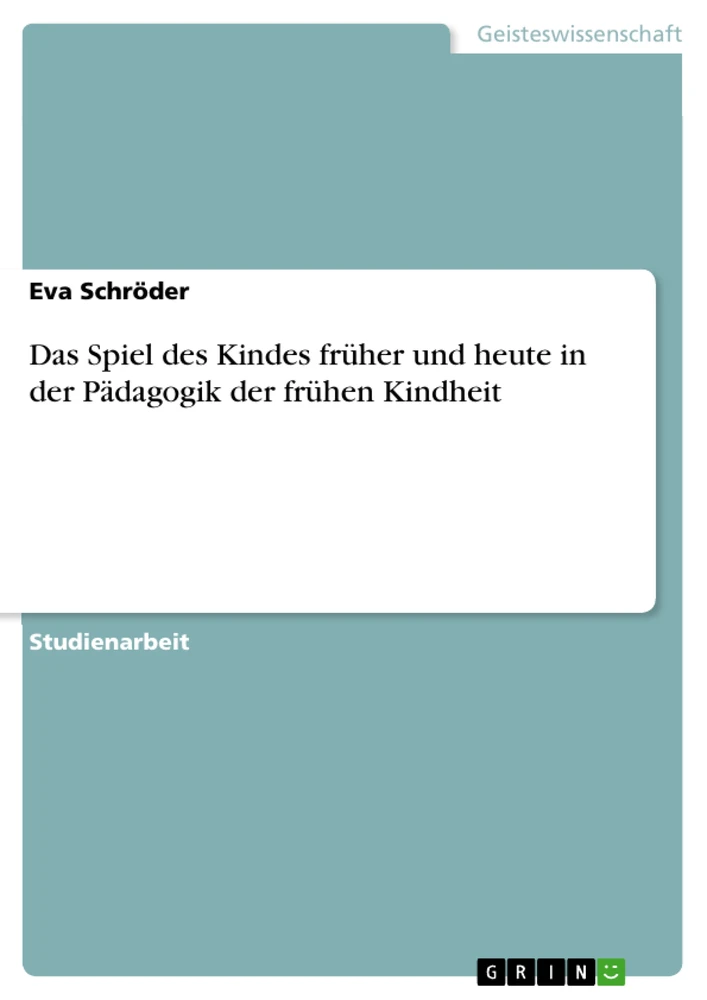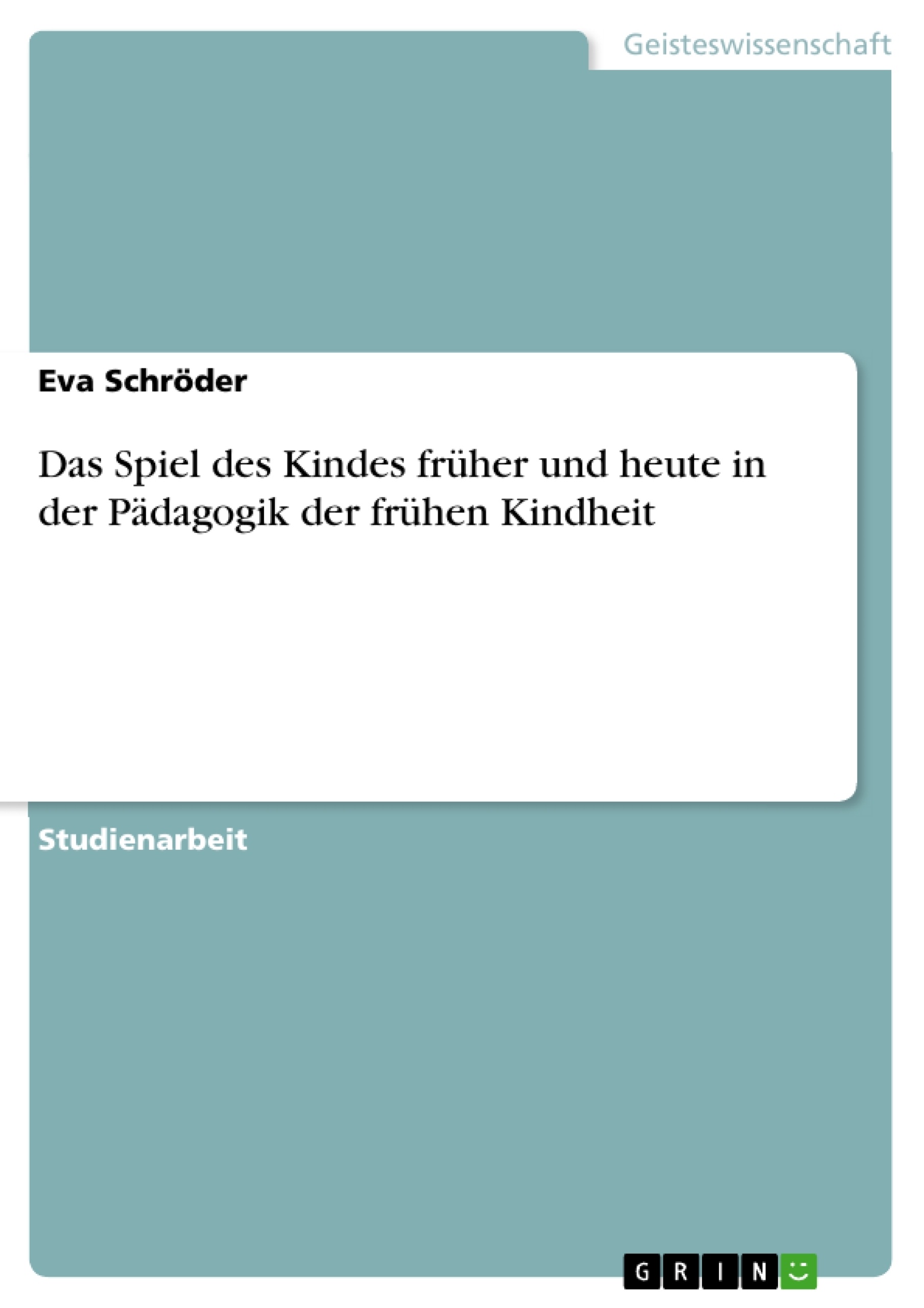Das Thema der Hausarbeit ist das Spiel des Kindes und seine Sicht früher und heute in der Pädagogik der frühen Kindheit.
Es soll gezeigt werden, inwieweit die Pädagogik des Spiels sich verändert hat bzw. noch heute ihre Gültigkeit besitzt.
In einer Zeit der Bildungsreformen ist dieser Blick auf die Vergangenheit und in die heutige Sicht der Pädagogik ein notwendiger Schritt zu evaluieren und den Fortschritt der notwendigen Veränderungen voran zu treiben.
Für die Darstellung vom Spiel des Kindes aus historischer Sicht bietet sich die Pädagogik des Pädagogen, Lehrers und Entwicklers Friedrich Wilhelm August Fröbel an. Er ist neben Maria Montessori, Johann Heinrich Pestalozzi und Rudolf Steiner einer der Klassiker der Pädagogik der frühen Kindheit und hat sich explizit mit dem Spiel des Kindes auseinandergesetzt.
Weiterführend wird diese Arbeit die heutige Sicht vom Spiel des Kindes beleuchten. Die aktuellen Bildungsrahmenpläne der Bundesländer Hessen und Berlin bilden hier die Grundlage.
Abschließend wird diese Arbeit sich mit der Analyse der beiden vorgestellten Pädagogika auseinandersetzen und einen direkten Vergleich ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Spiel des Kindes und seine Sicht früher in der Pädagogik der frühen Kindheit
- Biographie Friedrich Fröbel
- Grundgedanken Friedrich Fröbels
- Spieltheorie
- Pädagogische Umsetzung der Spieltheorie
- Mutter- und Koselieder
- Spielgaben
- Das Spiel des Kindes und seine Sicht heute
- in der Pädagogik der frühen Kindheit
- Hintergründe
- Bildungspolitik in der DDR
- Bildungspolitik in der BRD
- Bildungsreform 2001
- Bildungsrahmenpläne am Beispiel von Berlin und Hessen
- Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageeinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt
- Bildung von Anfang an. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen
- Das Spiel des Kindes und seine Sicht früher und heute in der Pädagogik der frühen Kindheit
- Grundannahmen im Vergleich
- Grundannahmen früher in der Pädagogik der frühen Kindheit
- Grundannahmen heute in der Pädagogik der frühen Kindheit
- Berliner Bildungsprogramm
- Bildungs- und Erziehungsplan Hessen
- Vergleich
- Das Spiel des Kindes und seine Sicht im Vergleich
- Das Spiel des Kindes und seine Sicht früher
- Das Spiel des Kindes und seine Sicht heute
- Berliner Bildungsprogramm
- Bildungs- und Erziehungsplan Hessen
- Vergleich
- Persönliches Fazit
- Biographie und pädagogische Ansätze Friedrich Fröbels
- Vergleich der Spieltheorien und -praktiken früher und heute
- Analyse aktueller Bildungsrahmenpläne (Berlin und Hessen)
- Entwicklung des Verständnisses von Kinderspiel im Laufe der Zeit
- Relevanz von Fröbels Pädagogik im modernen Kontext
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Verständnisses von Kinderspiel in der frühen Kindheitspädagogik, vom historischen Kontext bis zur Gegenwart. Sie analysiert, inwieweit sich die Pädagogik des Spiels verändert hat und welche Aspekte weiterhin relevant sind. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Bildungsreformen für die heutige Sichtweise und zielt darauf ab, den Fortschritt notwendiger Veränderungen zu evaluieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, nämlich den Vergleich des Verständnisses von Kinderspiel in der frühen Kindheitspädagogik zwischen früher und heute. Sie betont die Notwendigkeit dieser Untersuchung im Kontext von Bildungsreformen und nennt Friedrich Fröbel als wichtigen Bezugspunkt für die historische Perspektive, sowie die Bildungsrahmenpläne Berlins und Hessens für die heutige Sichtweise. Der Fokus liegt auf der Evaluation des Fortschritts und der notwendigen Veränderungen in der Pädagogik des Spiels.
Das Spiel des Kindes und seine Sicht früher in der Pädagogik der frühen Kindheit: Dieses Kapitel beginnt mit einer detaillierten Biographie Friedrich Fröbels, die seinen Werdegang und die prägenden Einflüsse auf seine Pädagogik beleuchtet. Anschließend werden seine Grundgedanken und seine Spieltheorie vorgestellt, die sich eng an die Konzepte Rousseaus und Pestalozzis anlehnen. Der Fokus liegt auf Fröbels Verständnis von Kinderspiel als Ausdruck der kindlichen Entwicklung und der Rolle des Spiels in der ganzheitlichen Erziehung. Die Umsetzung dieser Spieltheorie anhand von Fröbels Mutter- und Koseliedern sowie seinen Spielgaben wird detailliert erklärt.
Das Spiel des Kindes und seine Sicht heute in der Pädagogik der frühen Kindheit: Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Stand des Verständnisses von Kinderspiel im Kontext der frühen Kindheitspädagogik. Es untersucht die Hintergründe, insbesondere die Bildungspolitik in der DDR und der BRD sowie die Bildungsreform von 2001. Der Schwerpunkt liegt auf einem Vergleich der Berliner und Hessischen Bildungsrahmenpläne, wobei die unterschiedlichen Ansätze und Schwerpunkte im Umgang mit dem Kinderspiel herausgearbeitet werden. Es wird detailliert auf die jeweiligen Bildungsprogramme eingegangen und deren Relevanz für das Verständnis von Kinderspiel beleuchtet.
Das Spiel des Kindes und seine Sicht früher und heute in der Pädagogik der frühen Kindheit: Dieses Kapitel vergleicht die Grundannahmen und Sichtweisen auf das Kinderspiel früher und heute. Es setzt Fröbels Pädagogik in Relation zu den aktuellen Bildungsrahmenplänen Berlins und Hessens, analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede und zieht abschließende Schlussfolgerungen aus dem Vergleich. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des pädagogischen Denkens über die Bedeutung des Kinderspiels und der daraus resultierenden Konsequenzen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Kinderspiel, Frühe Kindheitspädagogik, Friedrich Fröbel, Spieltheorie, Bildungsrahmenpläne, Berlin, Hessen, Bildungspolitik, DDR, BRD, Bildungsreformen, Vergleich, Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung des Verständnisses von Kinderspiel in der frühen Kindheitspädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Verständnisses von Kinderspiel in der frühen Kindheitspädagogik, vom historischen Kontext bis zur Gegenwart. Sie vergleicht die Sichtweisen auf Kinderspiel früher (am Beispiel Friedrich Fröbels) und heute (anhand aktueller Bildungsrahmenpläne in Berlin und Hessen).
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet ausführlich die Biographie und die pädagogischen Ansätze Friedrich Fröbels. Seine Spieltheorie, die Umsetzung in Mutter- und Koseliedern sowie Spielgaben, und der Einfluss von Rousseau und Pestalozzi werden detailliert dargestellt. Der historische Kontext der Pädagogik des Spiels wird beleuchtet.
Welche modernen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert die aktuelle Sichtweise auf Kinderspiel im Kontext der frühen Kindheitspädagogik. Dabei werden die Hintergründe, insbesondere die Bildungspolitik in der DDR und BRD sowie die Bildungsreform von 2001, berücksichtigt. Im Mittelpunkt stehen die Berliner und Hessischen Bildungsrahmenpläne, deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Umgang mit dem Kinderspiel analysiert werden.
Welche konkreten Bildungsrahmenpläne werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das „Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageeinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt“ und den „Bildung von Anfang an. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen“.
Wie werden die historischen und modernen Ansichten verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Grundannahmen und Sichtweisen auf das Kinderspiel früher (Fröbel) und heute (Berliner und Hessischer Bildungsplan). Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden analysiert, um Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis zu ziehen. Die Entwicklung des pädagogischen Denkens über die Bedeutung des Kinderspiels steht im Fokus.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Wandel des Verständnisses von Kinderspiel in der frühen Kindheitspädagogik zu dokumentieren und zu analysieren. Sie untersucht die Bedeutung von Bildungsreformen für die heutige Sichtweise und evaluiert den Fortschritt notwendiger Veränderungen. Die Relevanz von Fröbels Pädagogik im modernen Kontext wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Kinderspiel, Frühe Kindheitspädagogik, Friedrich Fröbel, Spieltheorie, Bildungsrahmenpläne, Berlin, Hessen, Bildungspolitik, DDR, BRD, Bildungsreformen, Vergleich, Entwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Fröbels Pädagogik, der heutigen Sichtweise auf Kinderspiel, einem Vergleich beider Perspektiven und einem persönlichen Fazit. Sie enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen.
- Quote paper
- Eva Schröder (Author), 2012, Das Spiel des Kindes früher und heute in der Pädagogik der frühen Kindheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/204847