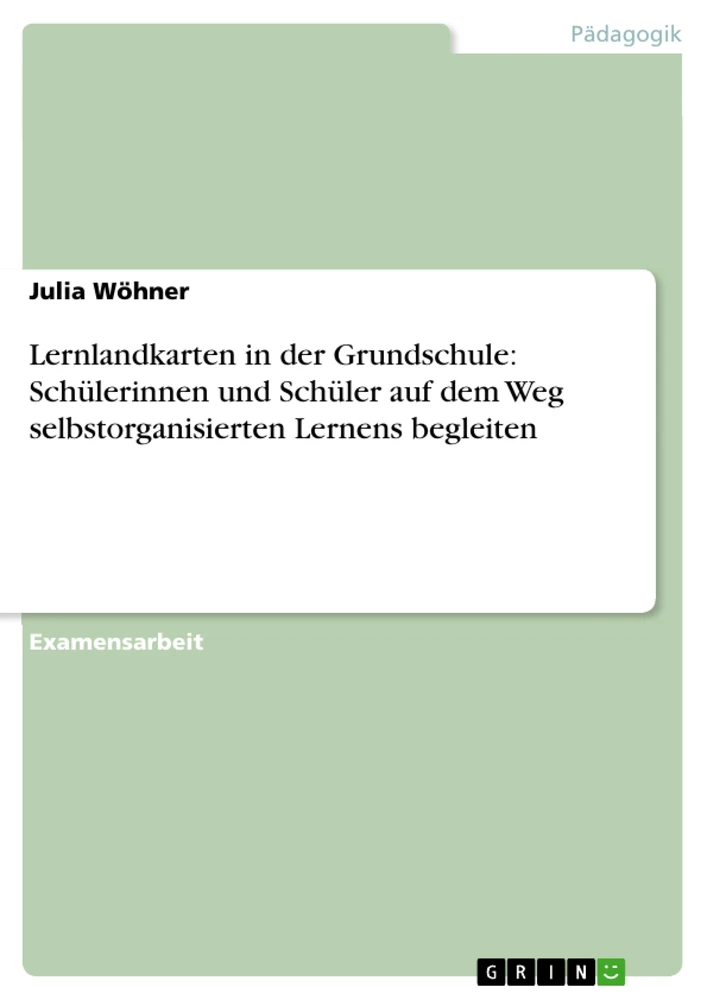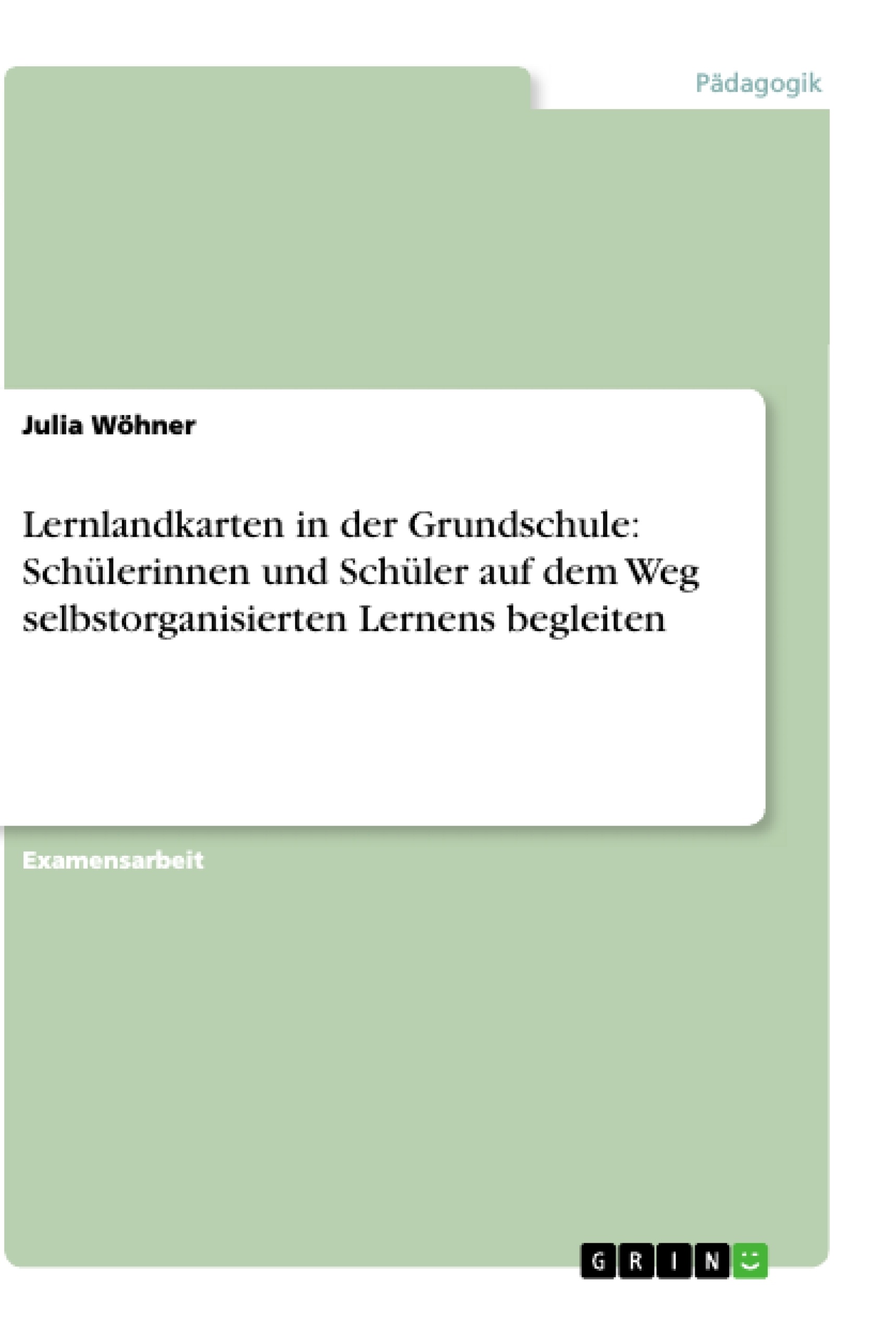Lernlandkarten sind eine relativ junge Methode, die erst seit 2007 in der Fachliteratur diskutiert wird und bezeichnen die Visualisierung des „kognitive[n] Netzwerk[s] einer Person von einem bestimmten Lerngegenstand […] [Dabei helfen sie,] sich im individuellen Lernprozess besser orientieren zu können“. Lernlandkarten bieten vielversprechende Ansätze, den Zielen für eine modernisierte Lernkultur gerecht zu werden, wie sie in den Pädagogischen Leitideen für die Primarstufe beschrieben werden: „Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, dem lernwilligen und lebensneugierigen Kind zu vermitteln, wie es sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. […] Jedes Kind entwickelt für sich ein eigenes Lernsystem mit eigenen Strategien“.
Selbstorganisiertes Lernen und die Erreichung von erwarteten Kompetenzzielen setzen eine reale Selbsteinschätzung voraus, die auf einer klaren Zieltransparenz basiert Transparenz bedeutet in diesem Kontext, dass die Schülerinnen und Schüler Klarheit über Ziele, Inhalte und Leistungskriterien haben. Daher wird in dieser Arbeit nicht die bloße Einführung von Lernlandkarten vorgestellt, sondern den konkreten Forschungsfragen nachgegangen, inwiefern die Selbsteinschätzung mit Hilfe von Kompetenzformulierungen die Auseinandersetzung mit dem individuellen Lernstand fördert und sich die Schülerinnen und Schüler dadurch eigene Ziele setzen.
Im Folgenden beginnt die Arbeit mit einer zusammenfassenden Darstellung wesentlicher Merkmale von Lernlandkarten. Anschließend stelle ich meine praktische Umsetzung vor und gehe auf die Forschungsmethodik ein. Abschließend folgen die empirischen Ergebnisse, deren Auswertung und ein Fazit mit Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Methode Lernlandkarte
- 2.1 Entwicklung und Definition
- 2.2 Formen von Lernlandkarten
- 3 Einsatz einer Lernlandkarte in der Grundschule Arsten
- 3.1 Darstellungsform und Aufbau
- 3.2 Ziele
- 3.2.1 Transparenz
- 3.2.2 Selbsteinschätzung
- 4 Methodik
- 4.1 Erhebungsmethode und Stichprobenauswahl
- 4.2 Untersuchungsvorgehen
- 4.2.1 Untergliederung der Forschungsfragen
- 4.2.2 Entwicklung des Fragenkatalogs
- 5 Zusammenfassung der Interviewantworten
- 5.1 Weg zur Selbsteinschätzung
- 5.2 Qualität der Selbsteinschätzung
- 5.3 Konsequenzen der Selbsteinschätzung
- 6 Auswertung
- 6.1 Weg zur Selbsteinschätzung
- 6.2 Qualität der Selbsteinschätzung
- 6.3 Konsequenzen der Selbsteinschätzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einsatz von Lernlandkarten in einer zweiten Grundschulklasse. Ziel ist es, die Methode zur Förderung der Selbsteinschätzung und Zieltransparenz zu evaluieren und deren Einfluss auf den individuellen Lernprozess zu analysieren. Die praktische Umsetzung und Reflexion der Einführung dieser neuen Methode an der Schule stehen im Mittelpunkt.
- Einführung und Anwendung von Lernlandkarten als Unterrichtsmethode
- Förderung der Selbsteinschätzung bei Schülerinnen und Schülern
- Analyse der Zieltransparenz durch den Einsatz von Lernlandkarten
- Auswertung der Auswirkungen auf den individuellen Lernprozess
- Reflexion der Methode und Impulsesetzung für den kollegialen Austausch
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit Lernlandkarten auseinanderzusetzen, basierend auf positiven Erfahrungen mit der Methode. Sie erläutert die Ziele der Arbeit: Erweiterung der Methodenkompetenz der Autorin, Angebot offener Unterrichtsformen für die Schüler, Weiterentwicklung der begleitenden und beratenden Kompetenzen der Autorin, sowie die Impulsesetzung für den kollegialen Austausch an der Schule. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Selbsteinschätzung und Zieltransparenz durch den Einsatz von Lernlandkarten.
2 Die Methode Lernlandkarte: Dieses Kapitel definiert Lernlandkarten als Methode zur Visualisierung des kognitiven Netzwerks einer Person bezüglich eines bestimmten Lerngegenstands. Es beschreibt die Entwicklung der Methode, die Kombination von Concept Maps und Mind Maps mit der Darstellungsform einer Landkarte. Die verschiedenen Arten von Lernlandkarten (fremd- und selbsterstellt) werden unterschieden und ihre jeweiligen Funktionen im Lernprozess erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung der Visualisierung für die Orientierung und Planung im Lernprozess.
3 Einsatz einer Lernlandkarte in der Grundschule Arsten: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung der Lernlandkarten in der untersuchten Grundschulklasse. Es beleuchtet die gewählte Darstellungsform und den Aufbau der Lernlandkarten sowie die definierten Ziele, insbesondere die Transparenz und Selbsteinschätzung als Kernaspekte. Der Fokus liegt auf der konkreten Anwendung der Methode im Unterricht und der Vorbereitung der Schüler auf die Selbsteinschätzung.
4 Methodik: Dieses Kapitel detailliert die angewandte Erhebungsmethode und die Stichprobenauswahl. Es beschreibt das Untersuchungsvorgehen, die Untergliederung der Forschungsfragen und die Entwicklung des Fragenkatalogs für die Interviews. Der Schwerpunkt liegt auf der wissenschaftlichen Fundierung des Vorgehens und der Gewährleistung der methodischen Validität der Untersuchung.
5 Zusammenfassung der Interviewantworten: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der durchgeführten Interviews zusammen. Es analysiert den Weg der Schüler zur Selbsteinschätzung, die Qualität der Selbsteinschätzung und die daraus resultierenden Konsequenzen für den Lernprozess. Die Kapitelstruktur gibt Aufschluss über die verschiedenen Facetten der Analyse. Der Schwerpunkt liegt auf der Interpretation der empirischen Daten und ihrer Relevanz für die Forschungsfragen.
6 Auswertung: Das Kapitel bewertet die Daten aus den Interviews, fokussiert auf den Weg zur Selbsteinschätzung, die Qualität der Selbsteinschätzung und die daraus resultierenden Konsequenzen. Es verbindet die empirischen Ergebnisse mit der theoretischen Grundlage und zieht erste Schlüsse aus der Untersuchung. Die Kapitelstruktur zeigt die einzelnen Auswertungsschritte.
Schlüsselwörter
Lernlandkarten, Selbsteinschätzung, Zieltransparenz, selbstorganisiertes Lernen, Kompetenzentwicklung, Grundschule, qualitative Forschung, Interview.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit "Einsatz von Lernlandkarten in der Grundschule"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einsatz von Lernlandkarten in einer zweiten Grundschulklasse. Der Fokus liegt auf der Evaluierung der Methode zur Förderung der Selbsteinschätzung und Zieltransparenz sowie der Analyse ihres Einflusses auf den individuellen Lernprozess.
Welche Methode wird untersucht?
Die Arbeit untersucht die Methode der "Lernlandkarten". Diese werden als Visualisierung des kognitiven Netzwerks einer Person bezüglich eines bestimmten Lerngegenstands definiert und kombinieren Elemente von Concept Maps und Mind Maps in der Form einer Landkarte.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Einsatz von Lernlandkarten in der Grundschule zu evaluieren. Konkret werden die Förderung der Selbsteinschätzung und die Steigerung der Zieltransparenz durch den Einsatz dieser Methode untersucht. Zusätzlich dient die Arbeit der Erweiterung der Methodenkompetenz der Autorin und der Impulsesetzung für den kollegialen Austausch an der Schule.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, die Methode Lernlandkarte, Einsatz in der Grundschule Arsten, Methodik, Zusammenfassung der Interviewantworten und Auswertung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Untersuchung, beginnend mit der Einführung und der Definition der Methode, über die praktische Umsetzung und die gewählte Methodik bis hin zur Auswertung der Ergebnisse.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung verwendet?
Die Datenerhebung erfolgte mittels Interviews. Das Kapitel "Methodik" beschreibt detailliert die angewandte Erhebungsmethode, die Stichprobenauswahl, das Untersuchungsvorgehen, die Untergliederung der Forschungsfragen und die Entwicklung des Fragenkatalogs.
Welche Aspekte der Selbsteinschätzung werden analysiert?
Die Analyse der Selbsteinschätzung umfasst drei Aspekte: den Weg der Schüler zur Selbsteinschätzung, die Qualität der Selbsteinschätzung und die daraus resultierenden Konsequenzen für den Lernprozess. Diese Aspekte werden sowohl in der Zusammenfassung der Interviewantworten als auch in der Auswertung detailliert behandelt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lernlandkarten, Selbsteinschätzung, Zieltransparenz, selbstorganisiertes Lernen, Kompetenzentwicklung, Grundschule, qualitative Forschung, Interview.
Welche konkreten Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Interviews. Diese werden in Bezug auf den Weg zur Selbsteinschätzung, die Qualität der Selbsteinschätzung und die Konsequenzen für den Lernprozess analysiert und interpretiert. Die Ergebnisse werden im Kapitel "Zusammenfassung der Interviewantworten" und "Auswertung" detailliert dargestellt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen und verbindet diese mit der theoretischen Grundlage. Die konkreten Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Auswertung" zu finden.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende an Grundschulen, die an der Verbesserung der Methoden zur Förderung der Selbsteinschätzung und Zieltransparenz interessiert sind. Sie bietet zudem Einblicke in die qualitative Forschung und den Einsatz von Lernlandkarten im Unterricht.
- Quote paper
- Julia Wöhner (Author), 2011, Lernlandkarten in der Grundschule: Schülerinnen und Schüler auf dem Weg selbstorganisierten Lernens begleiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/204227