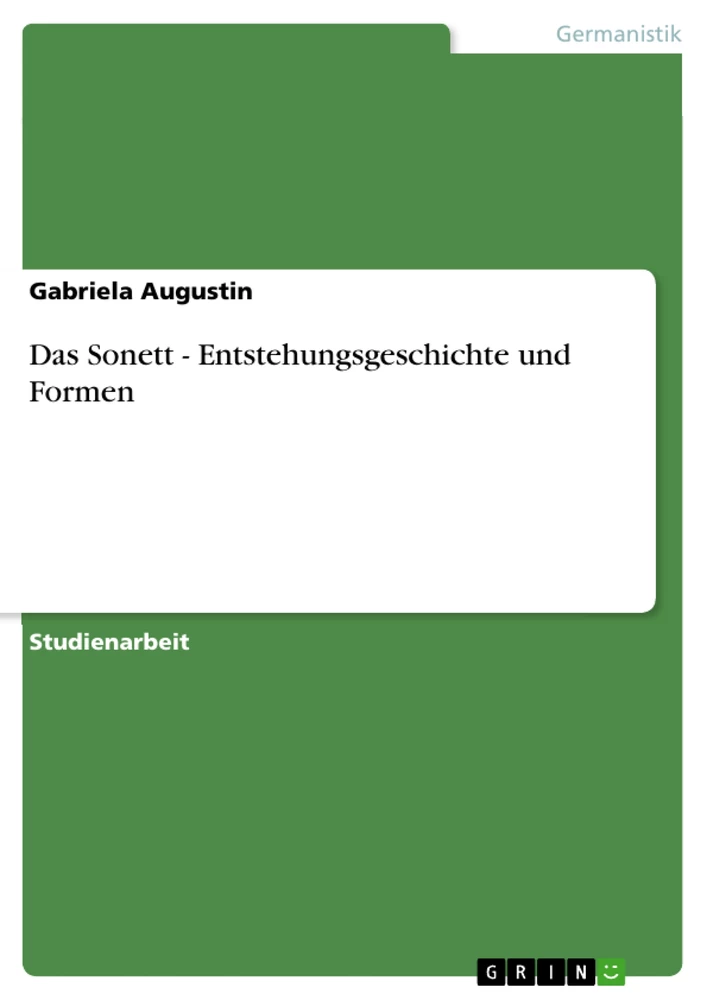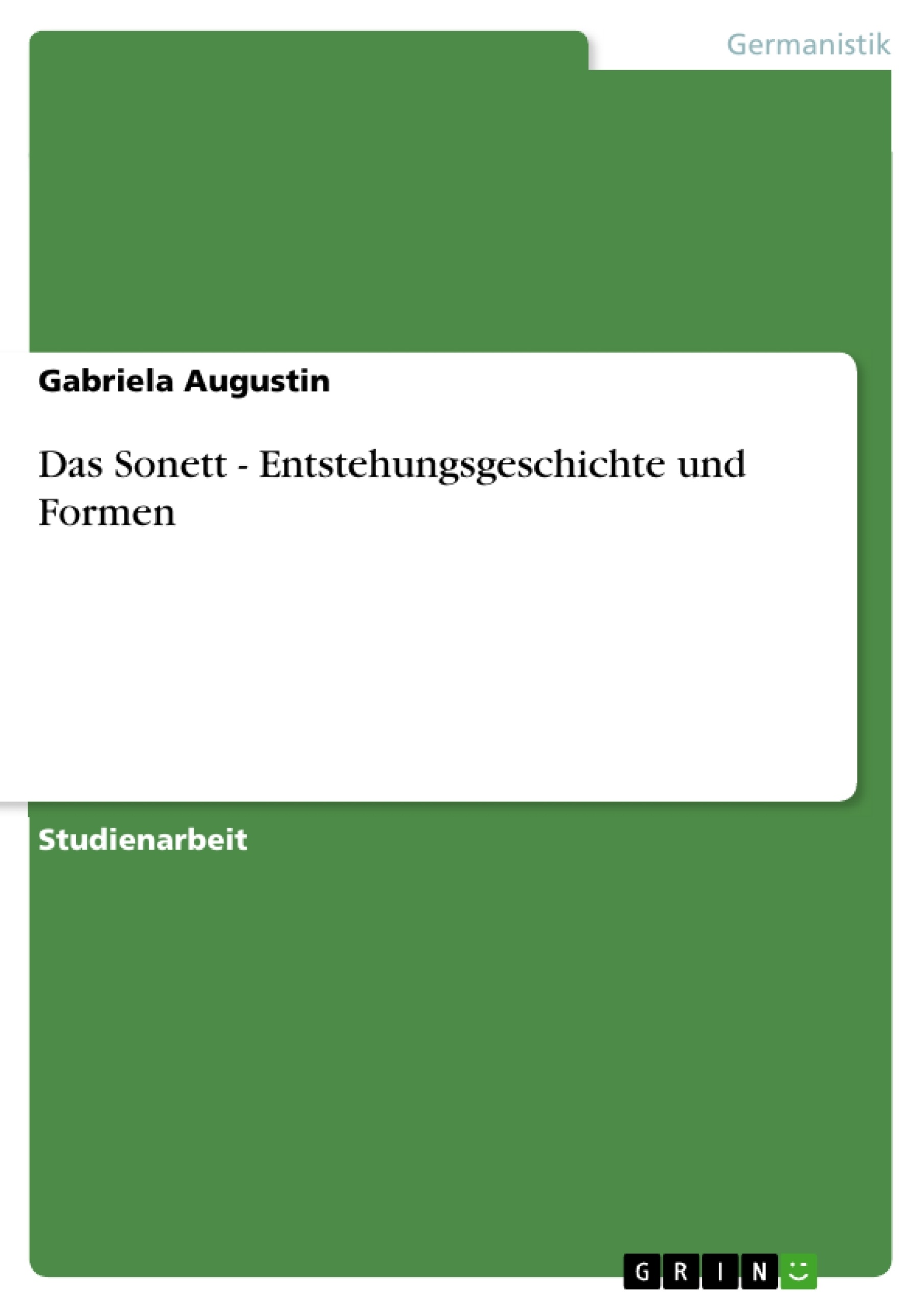Die Entstehungsgeschichte des Sonetts und dessen Entwicklung wird nachgezeichnet. Anschließend werden die paradigmatischen Formen des italienischen, des französischen, des englischen und des deutschen Sonetts erläutert, wobei die Entwicklung des deutschsprachigen Sonetts bis zur Gegenwart aufgezeigt werden soll. Anhand zweier Beispiele werden formgerechte Anwendungen und Umsetzung einzelner Autoren kurz analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte
- 3. Das Sonett in seinen paradigmatischen Formen
- 3.1. Das italienische Sonett
- 3.2. Das französische Sonett
- 3.3. Das englische Sonett
- 3.4. Das deutsche Sonett
- 4. Beispiele
- 4.1. Andreas Gryphius' Es ist alles eitel
- 4.2. Robert Gernhards Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Sonetts nachzuzeichnen, sowie die paradigmatischen Formen des italienischen, französischen, englischen und deutschen Sonetts zu erläutern. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung des deutschsprachigen Sonetts bis in die Gegenwart. Anhand von Beispielen werden formgerechte Anwendungen und Umsetzungen einzelner Autoren kurz analysiert.
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Sonetts
- Paradigmatische Formen des Sonetts in verschiedenen Sprachen
- Formale Merkmale und innere Struktur des Sonetts
- Analyse von Beispielen formgerechter Sonette
- Die Popularität und "Sonettwut" im deutschsprachigen Raum
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die lange Tradition und Popularität des Sonetts als Gedichtform heraus, trotz seiner strengen formalen Regeln. Sie erwähnt die überraschende „Sonettwut“ der späten 1970er und 1990er Jahre im deutschsprachigen Raum und kündigt die folgende Untersuchung der Entstehungsgeschichte, der Entwicklung und der paradigmatischen Formen des Sonetts an, inklusive einer Analyse ausgewählter Beispiele.
2. Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Sonetts um 1230 am Hofe Friedrichs II. in Sizilien, wobei Giacomo da Lentini als Erfinder gilt. Es wird die klassische italienische Sonettform als „ästhetisch besonders befriedigende Gedichtgestalt“ hervorgehoben, die seine anhaltende Popularität erklärt. Das Kapitel diskutiert verschiedene Theorien über mögliche Vorbilder des Sonetts in volkstümlichen literarischen Formen, wie der provenzalischen Kanzonenstrophe oder dem sizilianischen Strambotto. Die etymologische Entwicklung des Begriffs „Sonett“ vom lateinischen „sonus“ wird nachgezeichnet. Schließlich wird die klassische Form des Sonetts mit 14 Zeilen (Oktett und Sextett) und deren innerer Gliederung im Bezug auf die Gedankenführung (monistisch, dualistisch, dialektisch/triassisch) beschrieben. Die Bedeutung der Kürze des Sonetts und die daraus resultierende Notwendigkeit der Konzentration und des Reflexiven werden betont. Es wird die Möglichkeit der Verbindung mehrerer Sonette zu Zyklen, besonders des Sonettkranzes, erwähnt.
3. Das Sonett in seinen paradigmatischen Formen: Dieses Kapitel widmet sich den unterschiedlichen paradigmatischen Formen des Sonetts in verschiedenen europäischen Sprachen. Es hebt die Bedeutung von Übersetzungen, insbesondere der Werke von Petrarca, Baudelaire und Shakespeare für die Entwicklung des Sonetts in anderen Ländern, inklusive Deutschlands hervor. Das Kapitel beschreibt das italienische Sonett als klassische Form, charakterisiert durch vorwiegend umschließende Reime im Quartett und ein freieres Reimschema im Terzett (abba abba cdc dcd oder cde cde).
Schlüsselwörter
Sonett, Entstehungsgeschichte, Entwicklungsgeschichte, paradigmatische Formen, italienisches Sonett, französisches Sonett, englisches Sonett, deutsches Sonett, Reimschema, Oktett, Sextett, Gedankenführung, Lyrik, Literaturgeschichte, Form, Struktur, Beispiele, Andreas Gryphius, Robert Gernhard.
Häufig gestellte Fragen zum Sonett
Was ist der Inhalt dieser Arbeit über das Sonett?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Sonett. Sie behandelt die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte, die paradigmatischen Formen des Sonetts in verschiedenen Sprachen (Italienisch, Französisch, Englisch, Deutsch), und analysiert ausgewählte Beispiele von Andreas Gryphius und Robert Gernhard. Die Arbeit beleuchtet auch die formale Struktur, die Reimschemata und die Gedankenführung innerhalb des Sonetts. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung des deutschsprachigen Sonetts.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Sonetts, paradigmatische Formen des Sonetts in verschiedenen Sprachen (mit Schwerpunkt auf den Unterschieden), formale Merkmale und innere Struktur (Oktett, Sextett, Reimschemata), Analyse von Beispielen, die Popularität des Sonetts, insbesondere die "Sonettwut" im deutschsprachigen Raum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Sonetts, Das Sonett in seinen paradigmatischen Formen (inkl. italienisch, französisch, englisch und deutsch), und Beispiele für Sonette (Andreas Gryphius und Robert Gernhard).
Wie wird die Entstehungsgeschichte des Sonetts dargestellt?
Die Entstehungsgeschichte wird auf den sizilianischen Hof Friedrichs II. um 1230 zurückgeführt, wobei Giacomo da Lentini als Erfinder gilt. Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien über mögliche Vorbilder und die etymologische Entwicklung des Begriffs „Sonett“ vom lateinischen „sonus“. Die klassische Form des Sonetts mit 14 Zeilen (Oktett und Sextett) und deren innere Gliederung im Bezug auf die Gedankenführung wird beschrieben.
Welche paradigmatischen Formen des Sonetts werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die paradigmatischen Formen des italienischen, französischen, englischen und deutschen Sonetts. Der Einfluss von Übersetzungen bedeutender Autoren wie Petrarca, Baudelaire und Shakespeare auf die Entwicklung des Sonetts in anderen Ländern wird hervorgehoben. Das italienische Sonett wird als klassische Form mit seinen charakteristischen Reimschemata detailliert erklärt.
Welche Beispiele für Sonette werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Beispiele von Andreas Gryphius ("Es ist alles eitel") und Robert Gernhard ("Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs").
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sonett, Entstehungsgeschichte, Entwicklungsgeschichte, paradigmatische Formen, italienisches Sonett, französisches Sonett, englisches Sonett, deutsches Sonett, Reimschema, Oktett, Sextett, Gedankenführung, Lyrik, Literaturgeschichte, Form, Struktur, Beispiele, Andreas Gryphius, Robert Gernhard.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Sonetts nachzuzeichnen, die paradigmatischen Formen in verschiedenen Sprachen zu erläutern und anhand von Beispielen formgerechte Anwendungen und Umsetzungen zu analysieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung des deutschsprachigen Sonetts.
- Quote paper
- Gabriela Augustin (Author), 2010, Das Sonett - Entstehungsgeschichte und Formen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/203922