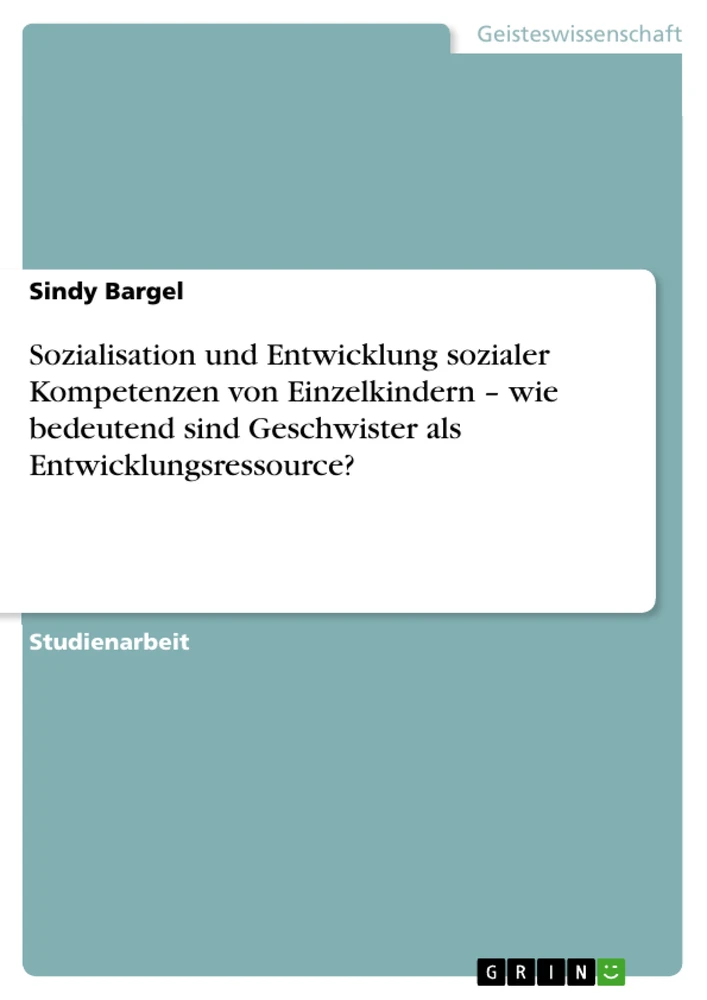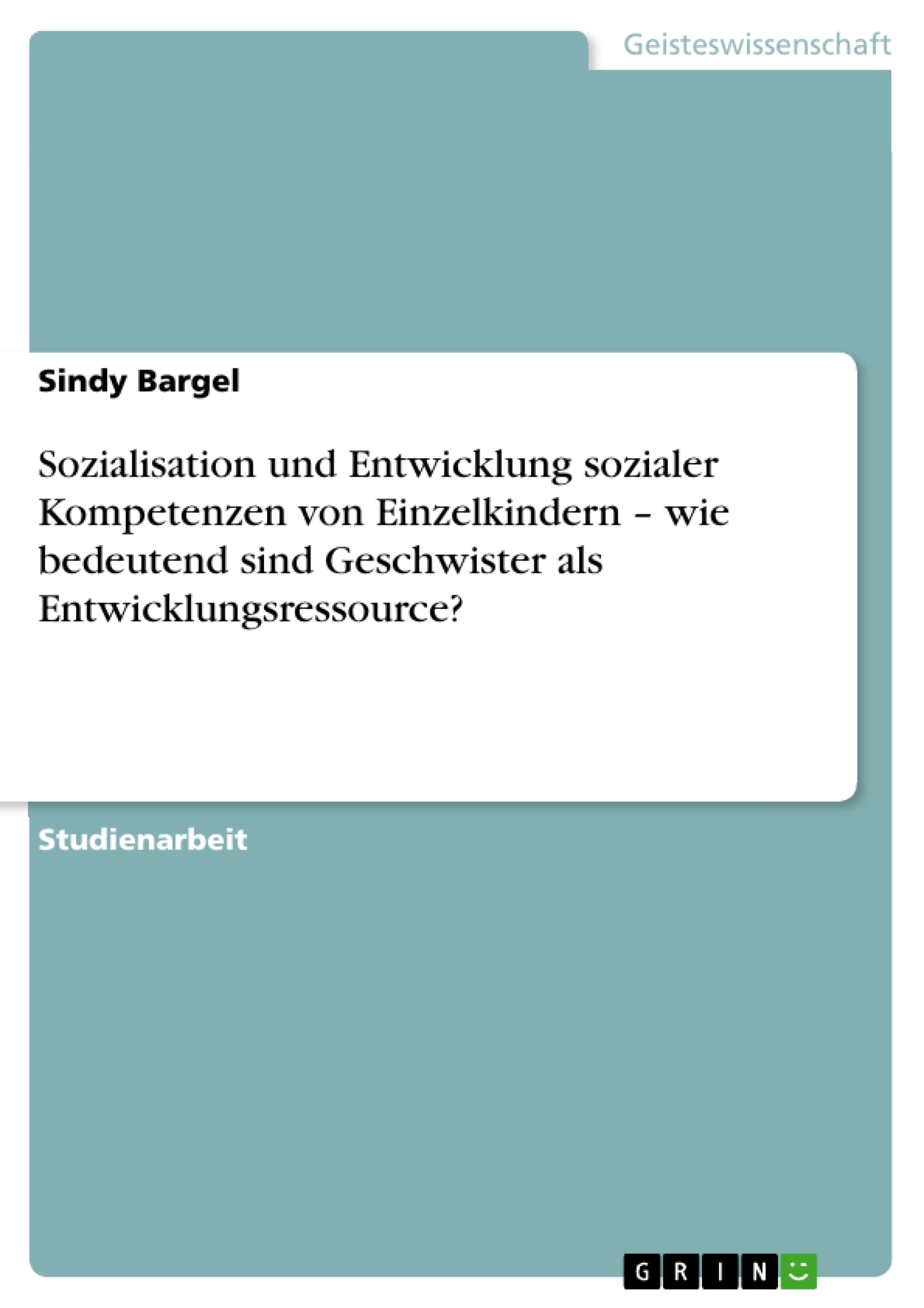Familiäres und familienähnliches Zusammenleben findet heute in immer vielfältigeren Formen statt. Die Familie als Ort primärer Sozialisation und dessen besondere Bedeutung ist unumstritten. Das Familiensystem beinhaltet mehrere Subsysteme, u. a. die Geschwisterbeziehung. Lange Zeit wurde der Geschwisterbeziehung jedoch wenig Aufmerksamkeit geschenkt, ist deren Bedeutung aber für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation doch evident. Geschwister verbringen viel Zeit miteinander, teilen Geheimnisse, helfen einander und solidarisieren sich gemeinsam gegen die Eltern. Geschwister wirken aufeinander ein und beeinflussen damit gegenseitig ihre Entwicklung.
In dieser Arbeit werden zwei zentrale Lebensbereiche von Kindern beschrieben und auf entwicklungsrelevante Unterschiede geprüft: die Familie mit dem Schwerpunkt der Einzel- und Geschwisterkinder und die Beziehung zu Gleichaltrigen. Dahinter steht die Frage, ob Geschwister einen entwicklungsrelevanten Einfluss besitzen, also als Ressource dienen, die Einzelkindern vorenthalten bleibt. Hierfür werden diese kindlichen Umfelder beschrieben und Unterschiede zwischen Einzel- und Geschwisterkindern aufgezeigt, um damit die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen zu deren Entwicklung darzustellen. Somit soll die Frage geklärt werden, ob es Einzelkindern schwerer fällt, Freundschaften zu schließen, sich in Gleichaltrigengruppen zu integrieren und ob ihre soziale Entwicklung und der Erwerb sozialer Kompetenzen, im Vergleich zu Kindern mit Geschwistern, erschwert ist.
Einzelkinder sind in der Öffentlichkeit immer noch mit starken Vorurteilen defizitären Charakters belastet; sie seien verwöhnt, kontaktscheu, egoistisch und könnten nicht teilen. Sie wurden lange Zeit als introvertiert und insgesamt unsozialer angesehen. Dies wurde zum einen durch die „Übermacht“ der Eltern und dadurch begründet, „dass Einzelkindern der alltägliche, weitgehend gleichberechtigte Kontakt mit Gleichaltrigen fehle und sie deshalb Entwicklungsnachteile gegenüber Geschwisterkindern hätten, was sich in einem geringen Einfühlungsvermögen und Anschlussbedürfnis äußere.“
Rund 30 Prozent der Kinder wachsen in Deutschland ohne Geschwister auf. Einzelkinder werden in den meisten Familien nicht geplant, sondern sind das Ergebnis bestimmter gesellschaftlicher und privater Lebensumstände und Erfahrungen ihrer Eltern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demographische Entwicklung / Statistischer Überblick
- Grundlegende Konzeptionen der sozialen Entwicklung
- Sozialisation
- Soziale Kompetenz und Sozialverhalten
- Soziale Entwicklung aus lerntheoretischer und psychoanalytischer Sicht
- Erkenntnisse aus der Geschwisterforschung
- Merkmale von Geschwisterbeziehungen
- Geschwisterrivalität
- Bewältigung bei Veränderung der elterlichen Paarbeziehung
- Funktionen von Geschwisterbeziehungen
- Die Lebenswelt von Kindern ohne Geschwister
- Die Lebensverhältnisse von Einzelkindern
- Einzelkinder im Erwachsenenalter
- Soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sozialisation und Entwicklung sozialer Kompetenzen von Einzelkindern im Vergleich zu Kindern mit Geschwistern. Sie untersucht, ob Geschwisterbeziehungen als Entwicklungsressource dienen, die Einzelkindern fehlen. Im Zentrum steht die Frage, ob Einzelkinder Schwierigkeiten haben, Freundschaften zu schließen, sich in Gleichaltrigengruppen zu integrieren und ob ihre soziale Entwicklung und der Erwerb sozialer Kompetenzen im Vergleich zu Kindern mit Geschwistern erschwert sind.
- Demographische Entwicklung von Ein-Kind-Familien
- Sozialisation und soziale Kompetenzen
- Funktionen von Geschwisterbeziehungen
- Lebensbedingungen von Einzelkindern
- Soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung der Familie als Ort primärer Sozialisation und beleuchtet die bisherige Forschungslücke bezüglich der Geschwisterbeziehung und deren Einfluss auf die individuelle Entwicklung. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Geschwisterbeziehungen als Ressource dienen, die Einzelkindern fehlen. Der zweite Teil beleuchtet die demographische Entwicklung von Ein-Kind-Familien und gibt einen statistischen Überblick über die Verbreitung dieser Familienform in Deutschland.
Kapitel 3 diskutiert grundlegende Konzeptionen der sozialen Entwicklung, darunter die Definition von Sozialisation und sozialen Kompetenzen. Es beleuchtet auch verschiedene lerntheoretische und psychoanalytische Ansätze zur sozialen Entwicklung. Kapitel 4 befasst sich mit Erkenntnissen aus der Geschwisterforschung, die Merkmale von Geschwisterbeziehungen, Geschwisterrivalität und die Bewältigung von Veränderungen in der elterlichen Paarbeziehung untersuchen.
Das fünfte Kapitel untersucht die Funktionen von Geschwisterbeziehungen und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Kindern. Kapitel 6 analysiert die Lebenswelt von Kindern ohne Geschwister, wobei es auf die Lebensverhältnisse von Einzelkindern und deren Erfahrungen im Erwachsenenalter eingeht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Einzelkinder, Sozialisation, soziale Kompetenzen, Geschwisterbeziehungen, Entwicklungsressource, Gleichaltrige, Freundschaften, Integration, Familienform, Demographie.
- Quote paper
- Sindy Bargel (Author), 2012, Sozialisation und Entwicklung sozialer Kompetenzen von Einzelkindern – wie bedeutend sind Geschwister als Entwicklungsressource?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/203531