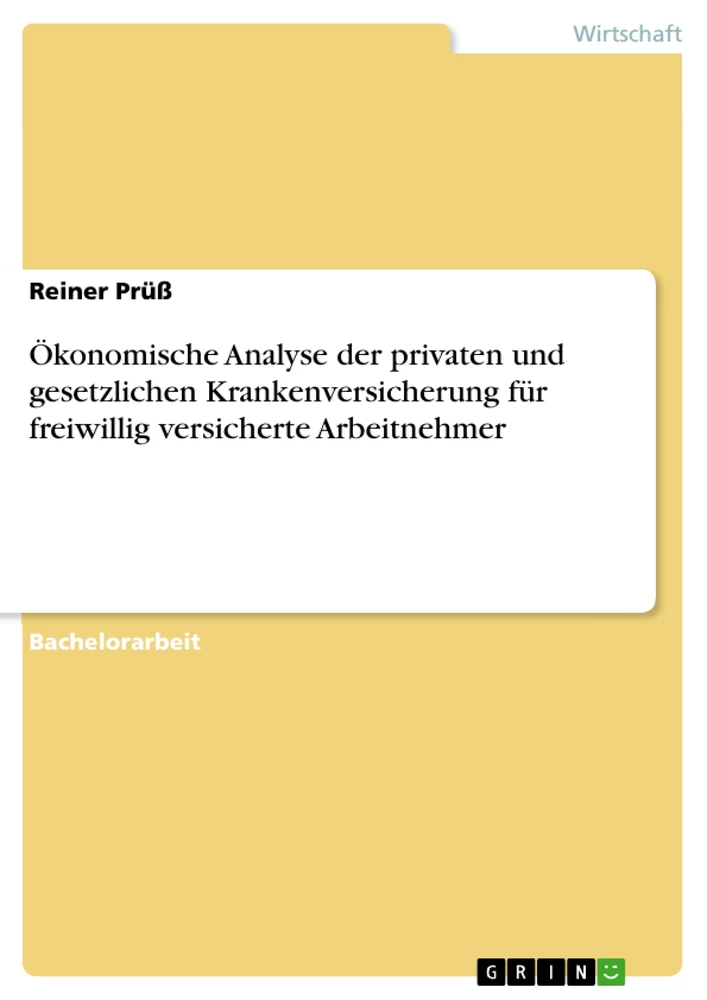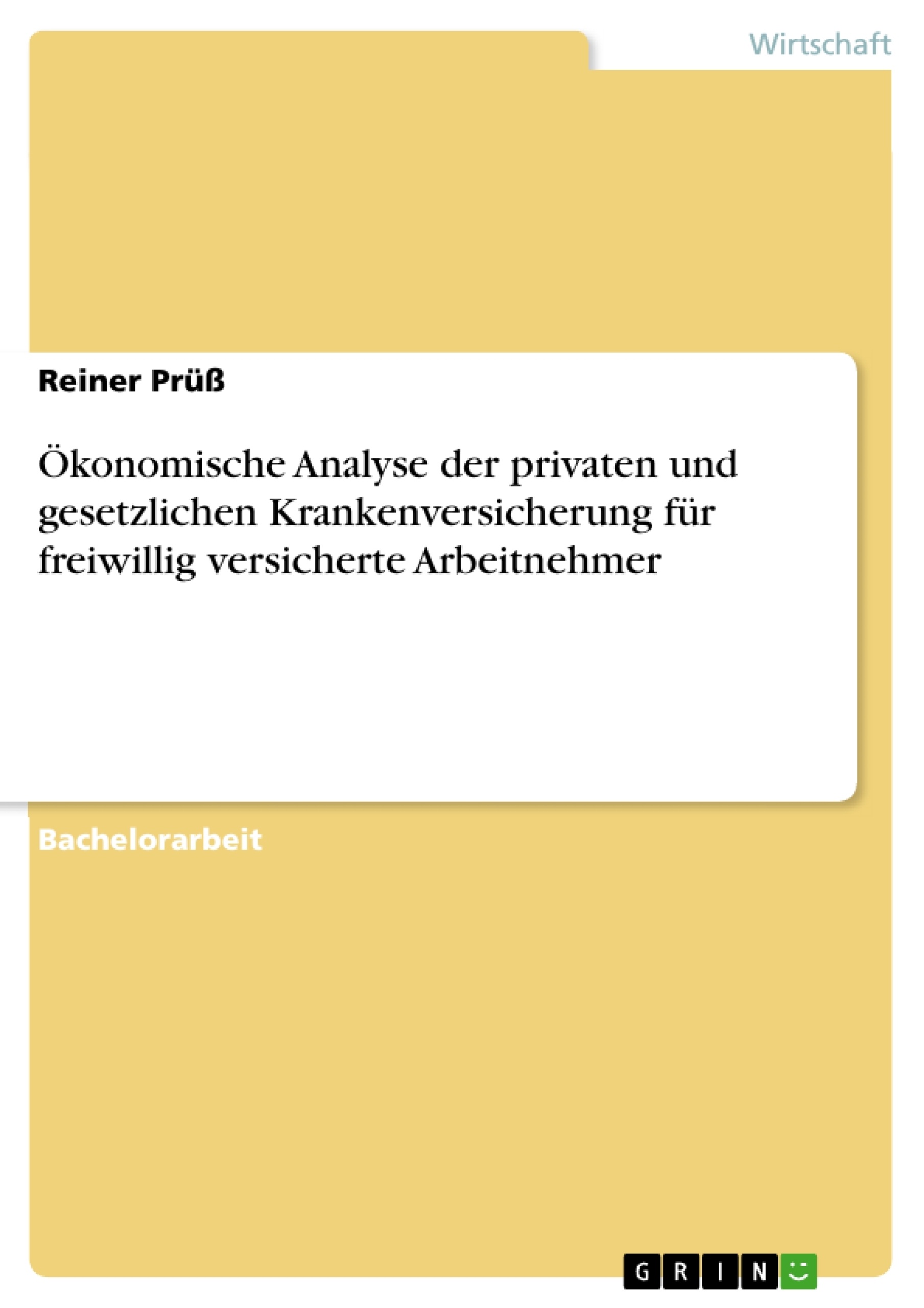Ziel dieser Arbeit ist es, einen ökonomischen Vergleich zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung anzustellen. Dem Leser sollen zunächst die theoretischen Grundlagen beider Systeme verdeutlicht werden. Darauf aufbauend werden die Vor- und Nachteile näher beleuchtet. Zur Bewertung der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung wird eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Da sowohl die Bewertungskriterien als auch die Gewichtung und die Bewertung transparent dargelegt werden, hat der Leser die Möglichkeit, die Sachverhalte nachvollziehen zu können. Darüber hinaus soll die Nutzwertanalyse eine Möglichkeit für den Leser sein, eine Priorisierung aufgrund seiner individuellen Bedürfnisse anzustellen. Im Anschluss an die Nutzwertanalyse folgt die Durchführung von Fallbespielen. Hierbei werden Beitragsentwicklungen modellhaft dargelegt. Durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensalter und Lebenssituation soll dem Leser ein Einblick in zukünftige Beitragsentwicklungen geboten werden. Nach Durchführung von Vergleichen und Analysen soll es dem Leser möglich sein, Vor- und Nachteile beider Systeme abwägen zu können. Durch Festlegung individueller Bedürfnisse und unter Berücksichtigung essenzieller Kriterien soll der Leser befähigt sein, eine eigenständige Auswahl zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung zu treffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Geschichte des Gesundheitssystems in Deutschland
- 2.1.1 Entstehung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
- 2.1.2 Entstehung der privaten Krankenversicherung (PKV)
- 2.2 Funktionsweise der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung
- 2.2.1 Gesetzliche Krankenversicherung
- 2.2.2 Private Krankenversicherung
- 2.3 Versicherungsfreiheit und Versicherungspflicht des Arbeitnehmers
- 2.4 Wechsel von der GKV in die PKV
- 2.5 Wechsel von der PKV in die GKV
- 2.6 Krankenversicherungsträger
- 2.6.1 Gesetzliche Krankenversicherung
- 2.6.2 Private Krankenversicherung
- 2.7 Zusammenfassung
- 3. Qualitative Bewertung der Krankenversicherungssysteme
- 3.1 SWOT-Analyse
- 3.1.1 Gesetzliche Krankenversicherung
- 3.1.2 Private Krankenversicherung
- 3.2 Nutzwertanalyse
- 3.2.1 Vorgehensweise
- 3.2.2 Durchführung
- 3.2.3 Auswertung der Nutzwertanalyse
- 4. Ökonomische Bewertung der Krankenversicherungssysteme anhand von Fallbeispielen
- 4.1 Vorgehensweise
- 4.2 Fallbeispiel I
- 4.3 Fallbeispiel II
- 4.4 Fallbeispiel III
- 4.5 Fazit der ökonomischen Bewertung der Krankenversicherungssysteme anhand von Fallbeispielen
- 5. Fazit und Ausblick
- 5.1 Zusammenfassung der Kapitel
- 5.2 Schlussfolgerung
- 5.3 offene Ansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ökonomischen Aspekte der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland aus der Perspektive eines freiwillig versicherten Arbeitnehmers. Ziel ist es, die Entscheidungsproblematik zwischen beiden Versicherungssystemen zu beleuchten und die jeweiligen Vor- und Nachteile anhand von Fallbeispielen zu verdeutlichen.
- Vergleich der Funktionsweisen von GKV und PKV
- Qualitative Bewertung der Systeme mittels SWOT- und Nutzwertanalyse
- Ökonomische Bewertung anhand konkreter Fallbeispiele
- Analyse der Entscheidungskriterien für einen Arbeitnehmer
- Aufzeigen der Vor- und Nachteile beider Systeme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein. Es beschreibt die Problemstellung, die sich aus der Entscheidung eines Arbeitnehmers zwischen GKV und PKV ergibt, und benennt die Zielsetzung der Arbeit, nämlich einen ökonomischen Vergleich beider Systeme zu ermöglichen. Der Aufbau der Arbeit wird ebenfalls skizziert, um dem Leser einen klaren Überblick über den weiteren Verlauf zu geben.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die notwendigen theoretischen Grundlagen zum Verständnis der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung in Deutschland. Es beleuchtet die historische Entwicklung beider Systeme, beschreibt detailliert ihre Funktionsweisen (Solidaritätsprinzip vs. Äquivalenzprinzip, Umlageverfahren vs. Anwartschaftsdeckungsverfahren etc.), und behandelt die Themen Versicherungsfreiheit, -pflicht und den Wechsel zwischen den Systemen. Die Kapitel vermitteln ein umfassendes Verständnis der institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen beider Versicherungssysteme.
3. Qualitative Bewertung der Krankenversicherungssysteme: In diesem Kapitel werden die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungssysteme qualitativ bewertet. Dazu werden SWOT-Analysen durchgeführt, um Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken beider Systeme herauszuarbeiten. Ergänzend wird eine Nutzwertanalyse vorgenommen, um die verschiedenen Kriterien systematisch zu gewichten und zu einem Gesamtvergleich zu gelangen. Diese Analysen bieten eine strukturierte und umfassende qualitative Bewertung der beiden Systeme.
4. Ökonomische Bewertung der Krankenversicherungssysteme anhand von Fallbeispielen: Dieses Kapitel führt die ökonomische Bewertung der Krankenversicherungssysteme durch. Anhand von Fallbeispielen werden die Kosten der GKV und der PKV (inklusive Basistarif und erweiterter Tarife) für verschiedene Arbeitnehmerprofile verglichen. Durch die detaillierte Gegenüberstellung der Kosten und Leistungen wird die ökonomische Entscheidungsproblematik für den Arbeitnehmer konkretisiert und nachvollziehbar dargestellt. Die Auswertung der Fallbeispiele bietet eine praktische Anwendung der theoretischen Grundlagen.
Schlüsselwörter
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Private Krankenversicherung (PKV), Solidarprinzip, Äquivalenzprinzip, Umlageverfahren, Anwartschaftsdeckungsverfahren, ökonomische Bewertung, SWOT-Analyse, Nutzwertanalyse, Fallbeispiele, Arbeitnehmerentscheidung, Basistarif.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Ökonomischer Vergleich der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den ökonomischen Vergleich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der privaten Krankenversicherung (PKV) in Deutschland aus der Perspektive eines freiwillig versicherten Arbeitnehmers. Sie beleuchtet die Entscheidungsproblematik zwischen beiden Systemen und verdeutlicht die Vor- und Nachteile anhand von Fallbeispielen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Vergleich der Funktionsweisen von GKV und PKV, eine qualitative Bewertung mittels SWOT- und Nutzwertanalyse, eine ökonomische Bewertung anhand konkreter Fallbeispiele, eine Analyse der Entscheidungskriterien für Arbeitnehmer und eine Darstellung der Vor- und Nachteile beider Systeme. Die historischen Entwicklungen beider Systeme werden ebenso beleuchtet wie die rechtlichen Rahmenbedingungen (Versicherungsfreiheit, -pflicht, Systemwechsel).
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet sowohl qualitative als auch quantitative Methoden. Qualitative Methoden umfassen SWOT-Analysen und Nutzwertanalysen zur Bewertung der Systeme. Quantitative Methoden beinhalten die ökonomische Bewertung anhand von Fallbeispielen, um die Kosten und Leistungen beider Systeme für verschiedene Arbeitnehmerprofile zu vergleichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Problemstellung und die Zielsetzung definiert. Es folgt ein Kapitel mit theoretischen Grundlagen zu GKV und PKV, inklusive ihrer historischen Entwicklung und Funktionsweise. Die qualitative und quantitative Bewertung der Systeme erfolgt in separaten Kapiteln. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick ab.
Welche konkreten Aspekte der GKV und PKV werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die Funktionsweisen (Solidaritätsprinzip vs. Äquivalenzprinzip, Umlageverfahren vs. Anwartschaftsdeckungsverfahren), die Kosten (inklusive Basistarif und erweiterter Tarife für verschiedene Arbeitnehmerprofile), die Leistungen und die Entscheidungskriterien für einen Arbeitnehmer, der zwischen beiden Systemen wählen muss.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert eine fundierte ökonomische Bewertung der GKV und PKV für freiwillig versicherte Arbeitnehmer. Sie ermöglicht es dem Leser, die Vor- und Nachteile beider Systeme abzuwägen und eine informierte Entscheidung zu treffen. Die Ergebnisse basieren auf theoretischen Grundlagen, qualitativen Analysen (SWOT, Nutzwertanalyse) und quantitativen Fallbeispielen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für freiwillig versicherte Arbeitnehmer, die sich zwischen GKV und PKV entscheiden müssen. Sie ist auch relevant für Studierende, die sich mit dem deutschen Gesundheitssystem und ökonomischen Aspekten der Krankenversicherung auseinandersetzen. Darüber hinaus kann sie für Personen nützlich sein, die sich allgemein für die Funktionsweise und den Vergleich der beiden Versicherungssysteme interessieren.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Private Krankenversicherung (PKV), Solidarprinzip, Äquivalenzprinzip, Umlageverfahren, Anwartschaftsdeckungsverfahren, ökonomische Bewertung, SWOT-Analyse, Nutzwertanalyse, Fallbeispiele, Arbeitnehmerentscheidung, Basistarif.
- Quote paper
- Reiner Prüß (Author), 2012, Ökonomische Analyse der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung für freiwillig versicherte Arbeitnehmer, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/202985