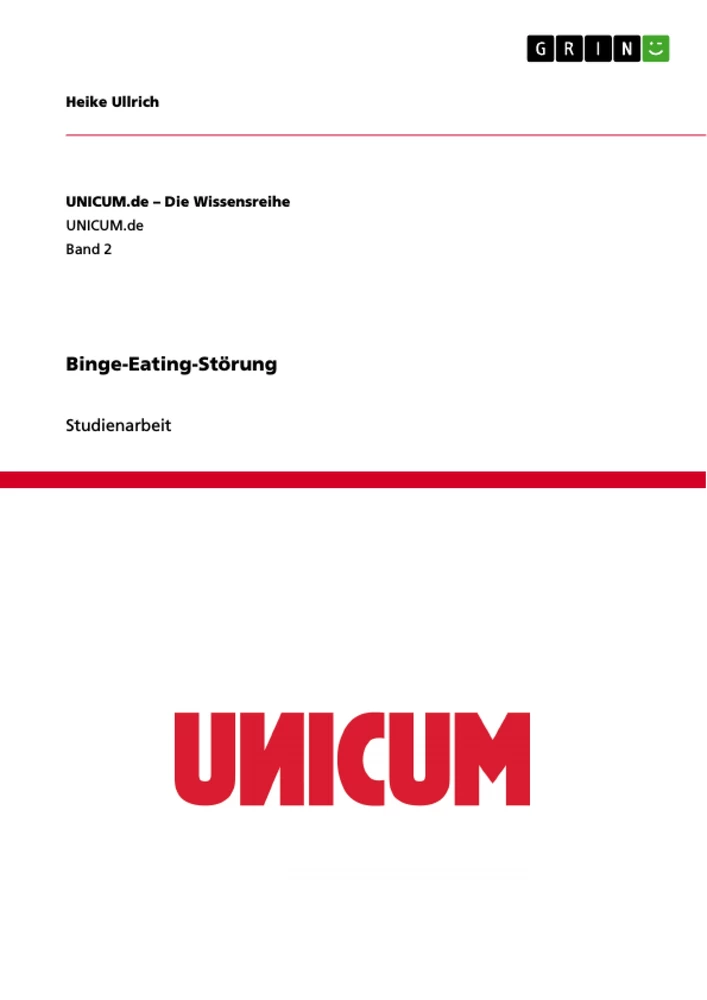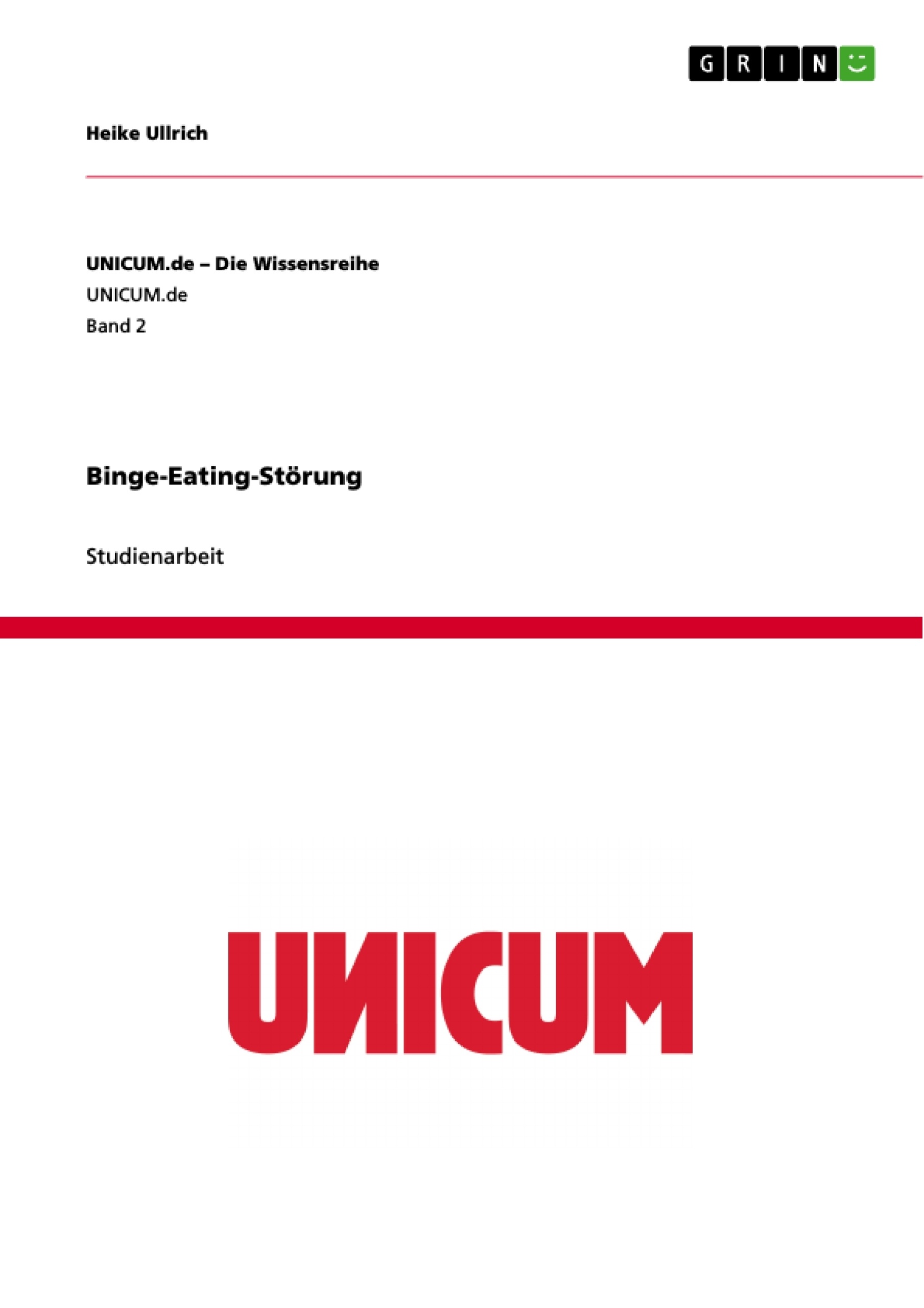Die wiederkehrenden Fressanfälle/Heißhungerattacken mit einhergehendem Kontrollverlust bzgl. Menge, Anfang und Ende des Essens, sind das gemeinsame Merkmal der „Binge-Eating-Störung“ und der Bulimia nervosa des Nicht-Purging-Typ sowie des Purging-Typ. Fressanfälle mit Kontrollverlust sind ebenso beim aktiven Typus, der Anorexia nervosa, dem Binge-Eating/Purging-Typ möglich, doch ergreift die Person, die unter BES leidet nicht regelmäßig bis gar nicht zu unangemessenen kompensatorischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Fasten, Diäthalten, exzessives Sporttreiben, Gebrauch von Diuretika und/oder Laxantien bzw. zu selbstinduziertem Erbrechen, um ihr Gewicht zu regulieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Diagnostik und Symptomatik
- 2 Komorbidität
- 3 Epidemiologie
- 4 Verlauf
- 5 Ätiologie und Erklärungsmodelle
- 6 CBT als Beispiel einer Therapiemöglichkeit
- 7 Reflexion: Welche Gefahren könnte eine Behandlung bergen?
- 8 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Binge-Eating-Störung (BES). Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Störung zu vermitteln, ihre Diagnostik, Symptomatik, Komorbidität, Epidemiologie, Verlauf und Ätiologie zu beleuchten sowie Therapieansätze aufzuzeigen. Die Arbeit berücksichtigt dabei verschiedene Forschungsansätze und diskutiert potentielle Gefahren einer Behandlung.
- Diagnostik und Symptomatik der BES
- Komorbidität der BES mit anderen psychischen Störungen
- Epidemiologische Daten zur Verbreitung der BES
- Verlauf und Prognose der BES
- Ätiologische Modelle und Erklärungsansätze für die Entstehung der BES
Zusammenfassung der Kapitel
1 Diagnostik und Symptomatik: Die Seminararbeit beginnt mit einer Abgrenzung der Binge-Eating-Störung (BES) von anderen Essstörungen, insbesondere der Bulimia nervosa. Es werden die diagnostischen Kriterien nach DSM-IV und die charakteristischen Merkmale der BES wie wiederkehrende Essanfälle mit Kontrollverlust, chaotisches Essverhalten und das Auftreten von Schuldgefühlen detailliert beschrieben. Der Unterschied zwischen einem normalen Überessen und einem Binge-Eating-Anfall wird hervorgehoben, wobei der entscheidende Faktor der Kontrollverlust im letzteren Fall betont wird. Die Arbeit diskutiert auch verschiedene Erscheinungsformen des Essverhaltens, wie zum Beispiel das kontinuierliche "grazing", und den Einfluss des Selbstwertgefühls, wobei unterschiedliche Forschungsbefunde hinsichtlich der Abhängigkeit des Selbstwerts vom Gewicht und der Figur präsentiert werden.
2 Komorbidität: Dieses Kapitel untersucht das häufige Auftreten von Komorbiditäten bei BES-Patienten. Es wird der hohe Prozentsatz an Betroffenen mit Major Depression und Angststörungen beleuchtet und die Debatte über die mögliche Interpretation der BES als moderne Ausdrucksform von Depressionen oder Angststörungen diskutiert. Die Arbeit vergleicht die Ergebnisse verschiedener Studien hinsichtlich der Häufigkeit psychiatrischer Störungen bei BES-Patienten im Vergleich zu anorektischen oder bulimischen Patienten und zeigt die Diskrepanzen zwischen den Forschungsbefunden auf, insbesondere bezüglich des Substanzmissbrauchs. Schließlich werden auch komorbide Persönlichkeitsstörungen, wie die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, die Borderline-Störung und die selbstunsicher-vermeidende Persönlichkeitsstörung, erwähnt.
3 Epidemiologie: Das Kapitel zur Epidemiologie präsentiert unterschiedliche Angaben zur Prävalenz der BES in der Bevölkerung, wobei die Bandbreite der Angaben und die Abhängigkeit von der Berücksichtigung von Adipositas hervorgehoben werden. Es werden Vergleiche der Punktprävalenzen der BES mit Bulimia nervosa und Anorexia nervosa gezogen und Geschlechtsunterschiede sowie Unterschiede im Auftreten der Störung im Lebensverlauf diskutiert. Die Arbeit hebt den Unterschied zwischen der BES und anderen Essstörungen bezüglich des Geschlechterverhältnisses und des Alters beim erstmaligen Auftreten der Störung hervor, und weist gleichzeitig auf die Notwendigkeit weiterer Forschung hin, um umfassendere und genauere Schätzungen zu erhalten.
4 Verlauf: In diesem Abschnitt wird der Verlauf der BES betrachtet, wobei die Remissionsraten nach abgeschlossener Therapie im Kurz-, Mittel- und Langzeitverlauf untersucht werden. Die Arbeit analysiert die Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Rückfallquoten und Chronifizierungsraten aufgrund methodischer Limitationen bestehender Studien. Die Bedeutung von Stichprobengröße und der Unterscheidung zwischen chronischem Verlauf und Rückfall wird hervorgehoben. Die Arbeit betont den Mangel an verlässlichen Daten bezüglich der Mortalitätsraten und die Notwendigkeit weiterer Forschung auf diesem Gebiet.
5 Ätiologie und Erklärungsmodelle: Das Kapitel widmet sich den Erklärungsmodellen für die Entstehung und Aufrechterhaltung der BES. Ein multifaktorielles Modell mit prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren wird vorgestellt, und es werden verschiedene Risikofaktoren wie sexueller Missbrauch, physische Vernachlässigung, geringer Selbstwert, Adipositas in der Kindheit und fehlende Bewältigungsstrategien diskutiert. Die Rolle von Stress, Unzufriedenheit mit dem Körper und dem Missbrauch von Essen als Problemlösungsstrategie wird ebenfalls hervorgehoben. Die Arbeit verweist auf weitere Literatur für eine detailliertere Auseinandersetzung mit diesen Modellen.
Schlüsselwörter
Binge-Eating-Störung, Essstörung, Komorbidität, Epidemiologie, Verlauf, Ätiologie, Diagnostik, Symptome, Therapie, Essanfälle, Kontrollverlust, Depression, Angststörung, Selbstwertgefühl, Adipositas.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Binge-Eating-Störung
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Binge-Eating-Störung (BES). Sie behandelt die Diagnostik und Symptomatik, Komorbidität mit anderen psychischen Störungen, epidemiologische Daten, den Verlauf der Störung, verschiedene Ätiologiemodelle und mögliche Therapieansätze (am Beispiel der kognitiven Verhaltenstherapie). Zusätzlich werden potentielle Gefahren einer Behandlung reflektiert.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Schwerpunkte ab: genaue Beschreibung der diagnostischen Kriterien und Symptome der BES, Häufigkeit des Auftretens von Komorbiditäten (z.B. Depression, Angststörungen), epidemiologische Daten zur Verbreitung der Störung, Untersuchung des Verlaufs und der Prognose, Diskussion verschiedener Erklärungsmodelle für die Entstehung der BES (einschließlich Risikofaktoren), und eine kurze Einführung in die CBT als Therapieoption.
Wie wird die Diagnostik und Symptomatik der BES beschrieben?
Die Arbeit differenziert die BES von anderen Essstörungen wie Bulimie. Sie beschreibt detailliert die diagnostischen Kriterien (DSM-IV), charakteristische Merkmale wie wiederkehrende Essanfälle mit Kontrollverlust und das Auftreten von Schuldgefühlen. Der Unterschied zwischen normalem Überessen und Binge-Eating wird herausgestellt, und verschiedene Erscheinungsformen des Essverhaltens (z.B. "grazing") und der Einfluss des Selbstwertgefühls werden diskutiert.
Welche Komorbiditäten werden bei BES betrachtet?
Die Arbeit untersucht das häufige Auftreten von Komorbiditäten wie Major Depression und Angststörungen. Sie diskutiert die Interpretation der BES als mögliche moderne Ausdrucksform von Depressionen oder Angststörungen und vergleicht die Ergebnisse verschiedener Studien zur Häufigkeit psychiatrischer Störungen bei BES-Patienten im Vergleich zu anorektischen oder bulimischen Patienten. Komorbide Persönlichkeitsstörungen werden ebenfalls erwähnt.
Welche epidemiologischen Daten werden präsentiert?
Das Kapitel zur Epidemiologie präsentiert Daten zur Prävalenz der BES, hebt die Bandbreite der Angaben und die Abhängigkeit von der Berücksichtigung von Adipositas hervor. Vergleiche mit Bulimie und Anorexie werden gezogen, Geschlechtsunterschiede und Unterschiede im Auftreten im Lebensverlauf diskutiert. Die Arbeit betont den Bedarf an weiterer Forschung für genauere Schätzungen.
Wie wird der Verlauf der BES beschrieben?
Der Abschnitt zum Verlauf untersucht Remissionsraten nach Therapie (kurz-, mittel- und langfristig). Die Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Rückfallquoten und Chronifizierungsraten aufgrund methodischer Limitationen werden analysiert. Die Bedeutung von Stichprobengröße und die Unterscheidung zwischen chronischem Verlauf und Rückfall werden hervorgehoben. Der Mangel an verlässlichen Daten zur Mortalität wird ebenfalls erwähnt.
Welche Ätiologiemodelle werden diskutiert?
Die Arbeit präsentiert ein multifaktorielles Modell mit prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren. Risikofaktoren wie sexueller Missbrauch, physische Vernachlässigung, geringer Selbstwert, Adipositas in der Kindheit und fehlende Bewältigungsstrategien werden diskutiert. Die Rolle von Stress, Unzufriedenheit mit dem Körper und Essensmissbrauch als Problemlösungsstrategie wird ebenfalls hervorgehoben.
Welche Therapie wird als Beispiel genannt?
Die kognitive Verhaltenstherapie (CBT) wird als Beispiel für eine mögliche Therapieoption genannt, ohne jedoch im Detail erläutert zu werden.
Welche Gefahren einer Behandlung werden angesprochen?
Die Seminararbeit enthält ein Kapitel zur Reflexion potentieller Gefahren einer Behandlung, welches jedoch im Detail nicht im bereitgestellten Auszug aufgeführt ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter umfassen: Binge-Eating-Störung, Essstörung, Komorbidität, Epidemiologie, Verlauf, Ätiologie, Diagnostik, Symptome, Therapie, Essanfälle, Kontrollverlust, Depression, Angststörung, Selbstwertgefühl, Adipositas.
- Quote paper
- Heike Ullrich (Author), 2011, Binge-Eating-Störung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/202025