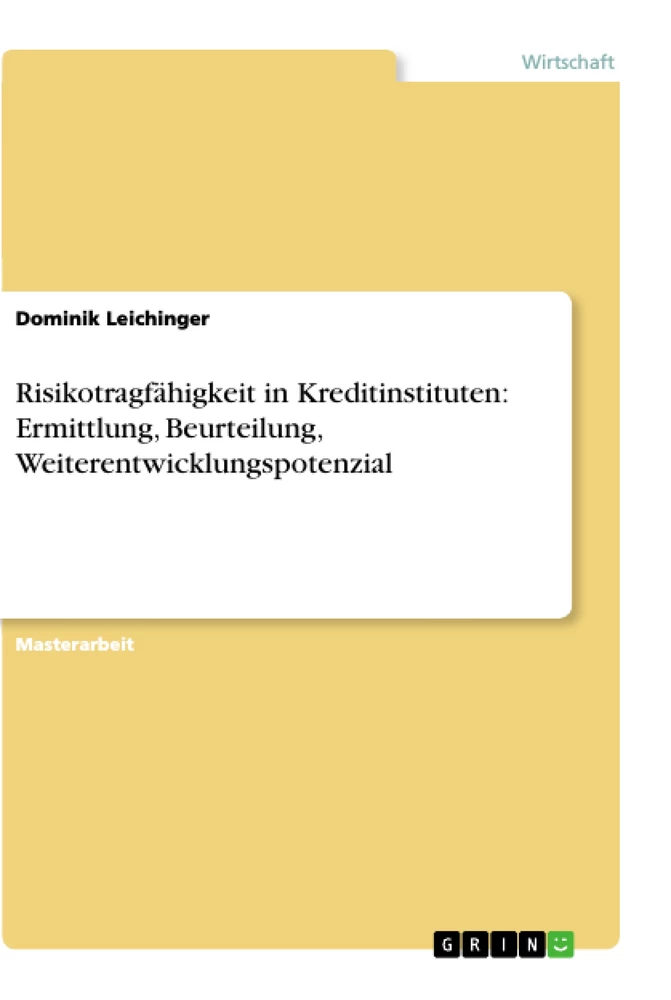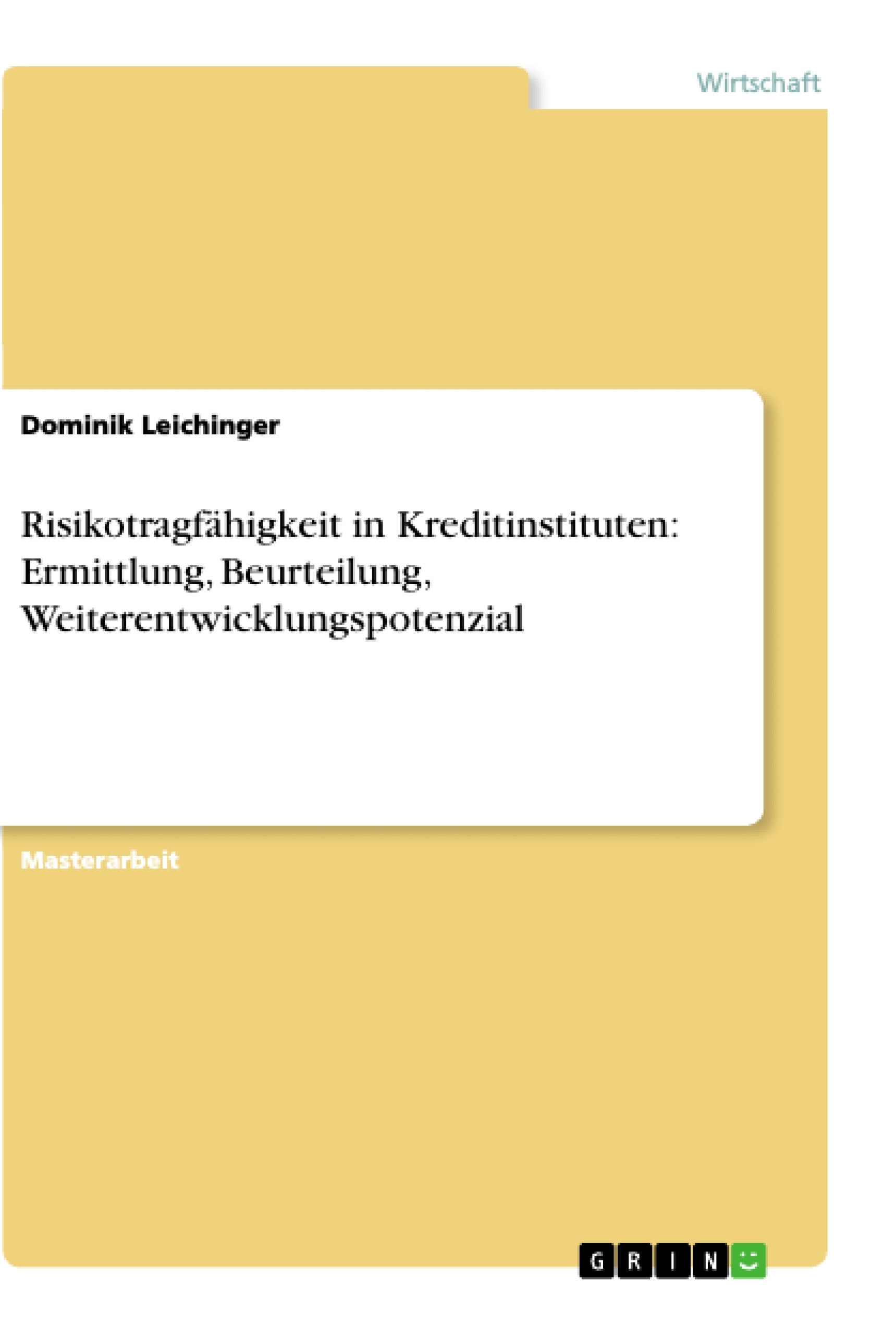Bei der Ausgestaltung von Risikotragfähigkeitsansätzen geben das KWG und die MaRisk die maßgeblichen rechtlichen Rahmenbedingungen vor und setzen die wesentlichen Inhalte der internationalen Vorgaben der Banken- und Kapitaladäquanzrichtlinie in deutsches Recht um. Zusätzlich existiert mit dem von BaFin und Bundesbank gemeinsam veröffentlichten Leitfaden zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte ein Positionspapier, in welchem die Bankenaufsicht ihre Beurteilungskriterien hinsichtlich der Erfüllung der rechtlichen Anforderungen darlegt.
Unter Beachtung des Wesentlichkeitsprinzips, des Proportionalitätsprinzips und des Prinzips der Methodenfreiheit legt die aufsichtliche Beurteilung insbesondere einen Fokus auf Konsistenzaspekte, eine vollständige Risikoabbildung sowie die Beachtung des Vorsichtsprinzips.
Methodisch lassen sich Risikotragfähigkeitsansätze in Abhängigkeit von der verfolgten Absicherungszielsetzung und der verwendeten Methode zur Ableitung des Risikodeckungspotenzials in jeweils zwei miteinander kombinierbare Grundtypen unterteilen, sodass insgesamt vier verschiedene Ansätze voneinander abgegrenzt werden können. Sofern das primäre Ziel in der Absicherung von Ansprüchen der Eigenkapitalgeber liegt und die für Unterlegungszwecke der Minde-steigenkapitalvorschriften nach Säule vorgehaltenen Kapitalbestandteile nicht zusätzlich als Risikodeckungsmasse für das Eingehen von Risiken bereitgestellt werden, handelt es sich um einen Fortführungsansatz. Wenn die Zielsetzung hingegen auf die Absicherung von Gläubigeransprüchen ausgerichtet ist, handelt es sich regelmäßig um einen Liquidationsansatz, in welchem auch das nach Säule eins vorzuhaltende Kapital als Teil des Risikodeckungspotenzials angesetzt werden kann.
Was die Ermittlung des Risikodeckungspotenzials betrifft, kann zwischen bilanzorientierten und wertorientierten Ansätzen differenziert werden.
Auf der Risikoseite sehen die MaRisk mindestens die Einbeziehung sämtlicher vom Institut als wesentlich eingestuften Risiken vor. Für die Quantifizierung verwenden die meisten Institute einen VaR – Ansatz. Sowohl der berechnete Risikobetrag einer einzelnen Risikoart als auch der aggregierte Betrag für das Gesamtbankrisiko wird in nicht unerheblichen Ausmaß durch die Wahl der Risiko-quantifizierungsparameter wie Konfidenzniveau, Haltedauer und Beobachtungszeitraum sowie den in die Rechnung einbezogenen Risikoverbundeffekten determiniert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rahmenbedingungen
- 2.1 Gesetzliche Grundlagen
- 2.2 Überprüfungs- und Sanktionsmöglichkeiten der Bankenaufsicht
- 2.2.1 Überprüfungsinstrumente und Beurteilungskriterien
- 2.2.2 Eingriffs- und Sanktionsmöglichkeiten
- 2.3 Allgemeine Grundlagen
- 2.3.1 Risikotragfähigkeit als Hauptkomponente des Risikomanagements
- 2.3.2 Abgrenzung unterschiedlicher Risikotragfähigkeitsansätze
- 3. Grundformen von Risikotragfähigkeitsansätzen
- 3.1 Ermittlung des Risikodeckungspotenzials
- 3.1.1 bei bilanzorientierten Ansätzen
- 3.1.2 bei wertorientierten Ansätzen
- 3.2 Ermittlung des Risikopotenzials
- 3.2.1 Einzubeziehende Risikoarten
- 3.2.2 Ausgestaltung der Risikomessmethoden
- 3.3 Gegenüberstellung von Risiko und Risikodeckungsmassen
- 3.1 Ermittlung des Risikodeckungspotenzials
- 4. Kritische Würdigung und Umsetzung in der Praxis
- 4.1 Ergebnisse der Studie der Deutschen Bundesbank
- 4.1.1 Verwendung von Risikodeckungspotenzialen
- 4.1.2 Berücksichtigung von Risikopotenzialen
- 4.2 Grenzen von Risikotragfähigkeitsansätzen
- 4.2.1 Konzeptionelle Grenzen
- 4.2.2 Grenzen der Risikoquantifizierung
- 4.3 Weiterentwicklungsmöglichkeiten von Risikotragfähigkeitsansätzen
- 4.1 Ergebnisse der Studie der Deutschen Bundesbank
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Ermittlung der Risikotragfähigkeit bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Ziel ist es, verschiedene Ansätze zur Bestimmung der Risikotragfähigkeit zu analysieren und kritisch zu würdigen.
- Gesetzliche Grundlagen und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
- Unterschiedliche Ansätze zur Ermittlung des Risikodeckungspotenzials und des Risikopotenzials
- Kritische Bewertung der bestehenden Methoden und ihrer Grenzen
- Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeitsansätzen
- Umsetzung der Ansätze in der Praxis anhand von Beispielen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Risikotragfähigkeit von Kreditinstituten ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Es skizziert die Bedeutung des Themas im Kontext der Finanzmarktregulierung und benennt die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf untersucht werden. Die Einleitung dient als Orientierungshilfe für den Leser und schafft einen Überblick über die gesamte Arbeit. Sie liefert den Kontext und die Motivation für die vorliegende Forschungsarbeit.
2. Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel legt die rechtlichen und regulatorischen Grundlagen für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit dar. Es analysiert sowohl internationale als auch nationale Vorgaben, beispielsweise die Kapitaladäquanzverordnung (CRD) und die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Weiterhin werden die Überprüfungs- und Sanktionsmöglichkeiten der Bankenaufsicht detailliert beschrieben, um den regulatorischen Rahmen vollständig darzustellen. Die Bedeutung der Risikotragfähigkeit als Kernkomponente des Risikomanagements wird hier ebenfalls hervorgehoben und verschiedene Ansätze werden abgegrenzt.
3. Grundformen von Risikotragfähigkeitsansätzen: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Darstellung unterschiedlicher Ansätze zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit. Es werden sowohl bilanzorientierte als auch wertorientierte Methoden zur Bestimmung des Risikodeckungspotenzials beschrieben. Darüber hinaus wird die Ermittlung des Risikopotenzials behandelt, inklusive der relevanten Risikoarten und der Gestaltung der Risikomessmethoden. Die verschiedenen Ansätze werden im Detail erläutert und systematisch gegenüberstellt, um ihre Stärken und Schwächen hervorzuheben.
4. Kritische Würdigung und Umsetzung in der Praxis: Dieses Kapitel befasst sich mit der kritischen Auseinandersetzung der in Kapitel 3 vorgestellten Ansätze. Die Ergebnisse einer Studie der Deutschen Bundesbank dienen als Grundlage für die Analyse der praktischen Umsetzung von Risikotragfähigkeitsansätzen. Konzeptionelle Grenzen und die Probleme der Risikoquantifizierung werden untersucht. Es werden Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Ansätze aufgezeigt und diskutiert, wie die bestehenden Limitationen überwunden werden können.
Schlüsselwörter
Risikotragfähigkeit, Kreditinstitute, Bankenaufsicht, Risikomanagement, MaRisk, CRD, Risikodeckungspotenzial, Risikopotenzial, Risikoquantifizierung, Wertorientierte Ansätze, Bilanzorientierte Ansätze, Regulierung, Finanzmarktstabilität.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Ermittlung der Risikotragfähigkeit bei Kreditinstituten
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Ermittlung der Risikotragfähigkeit bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Sie analysiert verschiedene Ansätze zur Bestimmung der Risikotragfähigkeit und würdigt diese kritisch.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die gesetzlichen Grundlagen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, unterschiedliche Ansätze zur Ermittlung des Risikodeckungspotenzials und des Risikopotenzials, eine kritische Bewertung bestehender Methoden und deren Grenzen, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Risikotragfähigkeitsansätzen und die praktische Umsetzung der Ansätze anhand von Beispielen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Rahmenbedingungen (einschließlich gesetzlicher Grundlagen, Überprüfungs- und Sanktionsmöglichkeiten der Bankenaufsicht und allgemeiner Grundlagen zur Risikotragfähigkeit), Grundformen von Risikotragfähigkeitsansätzen (Ermittlung des Risikodeckungspotenzials und des Risikopotenzials), kritische Würdigung und Umsetzung in der Praxis (Ergebnisse der Studie der Deutschen Bundesbank, Grenzen von Risikotragfähigkeitsansätzen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten) und Zusammenfassung.
Welche Ansätze zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl bilanzorientierte als auch wertorientierte Methoden zur Bestimmung des Risikodeckungspotenzials. Des Weiteren werden verschiedene Ansätze zur Ermittlung des Risikopotenzials, inklusive der relevanten Risikoarten und der Gestaltung der Risikomessmethoden, betrachtet und verglichen.
Welche Ergebnisse liefert die Studie der Deutschen Bundesbank?
Die Ergebnisse der Studie der Deutschen Bundesbank liefern einen Einblick in die praktische Anwendung von Risikodeckungspotenzialen und Risikopotenzialen. Sie dienen als Grundlage für die kritische Analyse der Umsetzung von Risikotragfähigkeitsansätzen in der Praxis.
Welche Grenzen der Risikotragfähigkeitsansätze werden aufgezeigt?
Die Arbeit identifiziert sowohl konzeptionelle Grenzen als auch Probleme der Risikoquantifizierung bei bestehenden Ansätzen zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit.
Welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Risikotragfähigkeitsansätze werden vorgeschlagen?
Die Arbeit diskutiert Möglichkeiten zur Überwindung der identifizierten Limitationen und schlägt Ansätze zur Weiterentwicklung der Risikotragfähigkeitsansätze vor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Risikotragfähigkeit, Kreditinstitute, Bankenaufsicht, Risikomanagement, MaRisk, CRD, Risikodeckungspotenzial, Risikopotenzial, Risikoquantifizierung, wertorientierte Ansätze, bilanzorientierte Ansätze, Regulierung, Finanzmarktstabilität.
- Quote paper
- Dominik Leichinger (Author), 2012, Risikotragfähigkeit in Kreditinstituten: Ermittlung, Beurteilung, Weiterentwicklungspotenzial, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/201829