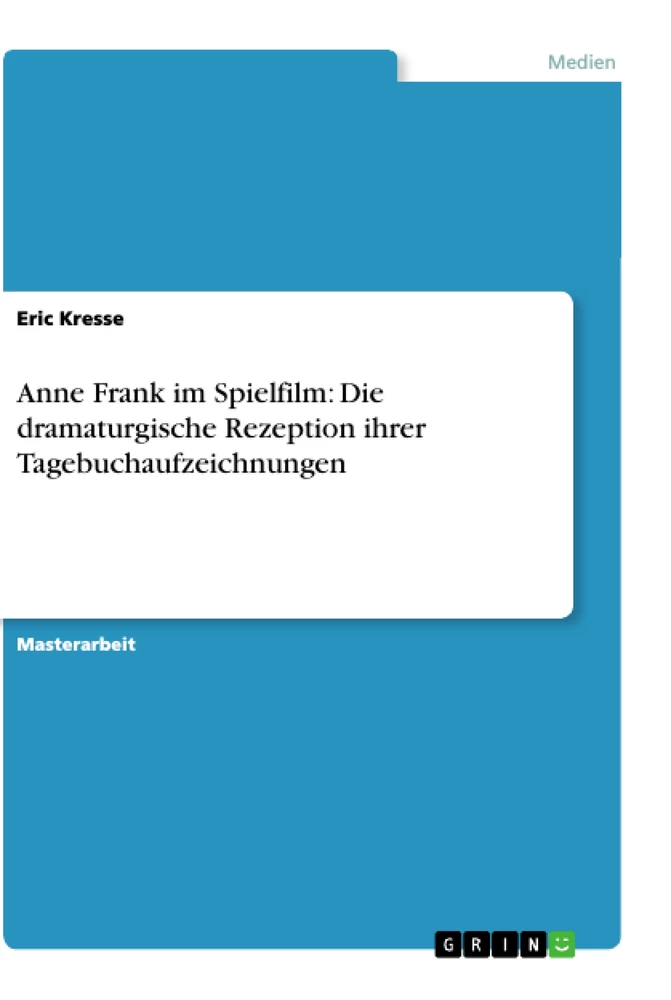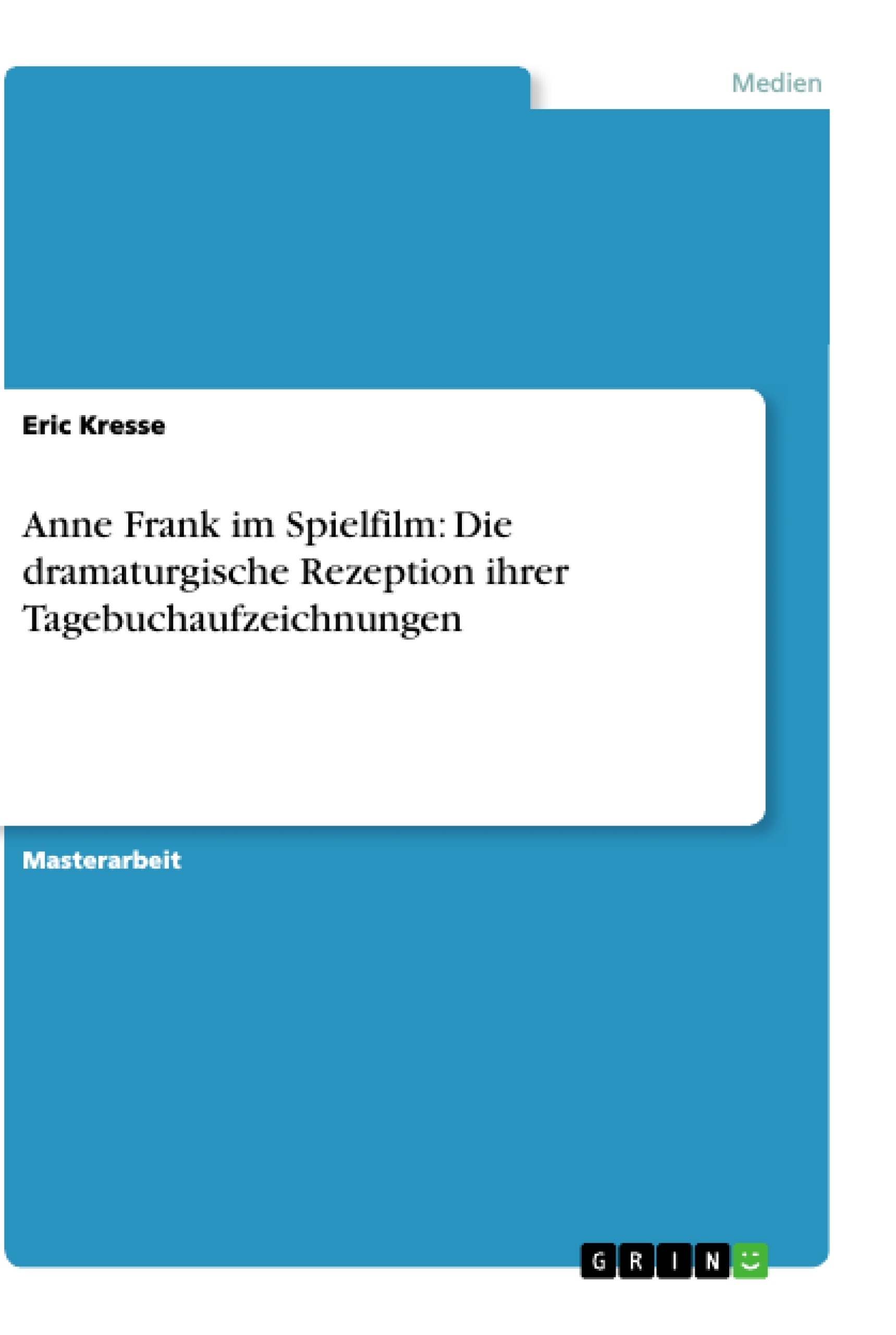Die Forschungsarbeit legt die wesentlichen medieneth. und filmanalyt. Grundlagen dar und untersucht mittels dieser die dramaturg. Aufarbeitung der Tagebuchaufzeichnungen der Anne Frank anhand der Historienfilme “The Diary of Anne Frank“ (1959) und “Anne Frank: The Whole Story“ (2001). In diesem Zusammenhang werden die Spielfilme einer Produkt- sowie Rezeptionsanalyse unterzogen. Dabei stellt sich der Anspruch beider auf die Darstellung vergangener Realität heraus, jedoch kann einzig “Anne Frank: The Whole Story“ einen Vergleich mit der hist. Vorlage bestehen. Im Rahmen einer komparatist. Analyse zeigt sich, dass “The Diary of Anne Frank“ von filmischer Konstruktion gezeichnet ist. Demnach kann lediglich der Film von 2001 aufgrund seiner historischen Faktizität und seinem erinnerungsbildenden Wirkungspotential in der heutigen Zeit als Erinnerungsfilm charakterisiert werden. Zudem verdeutlicht sich, dass beide Spielfilme von Werten und Normen ihrer Entstehungszeit gezeichnet sind und somit die Figur der Anne Frank unterschiedlich darstellen. Aufgrund der festgestellten Diskrepanz zwischen Konstruktion und Faktizität in Historienfilmen werden schließlich Leitlinien für die medieneth. Verantwortungsträger der Produktion und Rezeption im Umgang mit Geschichts- und Kulturbilder prägenden Filmen entworfen.
This research outlines the most important media ethical and film analytical basics and examines the dramaturgical processing of Anne Frank´s diary on the historical films "The Diary of Anne Frank" (1959) and "Anne Frank: The Whole Story" (2001). In this context, the feature films are subjected to a film analysis as well as an analysis of reception. It turns out that both films claim to be a representation of past reality; however, just “Anne Frank: The Whole Story” withstands a comparison with the historical fount. A comparative analysis shows that “The Diary of Anne Frank” is created by cinematic assembly. Thus, only the film from 2001 can be characterized as a remembrance film, because of its historical factuality and its potential ability to form memory in present time. In addition, this research illustrates, that both films are drawn by values and norms of their time of origin and characterize the figure of Anne Frank differently. On the basis of the observed discrepancy between assembly and fact in historical films, guidelines are devised for those ethically responsible in media creation when dealing with historical and cultural images forming films.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Einführung
- 1.2. Rezeptions- und Editionsgeschichte des Tagebuchs
- 1.3. Fragestellung und interdisziplinärer Forschungsansatz
- 1.4. Methodisches Konzept und Gliederung
- 2. Grundlagen
- 2.1. Medienethische Grundlagen
- 2.2. Filmanalytische Grundlagen
- 2.3. Historische Grundlagen zu Anne Frank
- 3. The Diary of Anne Frank (1959)
- 3.1. Filmanalyse
- 3.1.1. Filmografie
- 3.1.2. Analyse des Narrativen
- 3.1.3. Analyse des Visuellen
- 3.1.4. Analyse des Auditiven
- 3.2. Rezeption und Konstruktion: Zur dramaturgischen Aufarbeitung des Tagebuchs
- 4. Anne Frank: The Whole Story (2001)
- 4.1. Filmanalyse
- 4.1.1. Filmografie
- 4.1.2. Analyse des Narrativen
- 4.1.3. Analyse des Visuellen
- 4.1.4. Analyse des Auditiven
- 4.2. Rezeption und Konstruktion: Zur dramaturgischen Aufarbeitung des Tagebuchs
- 5. Komparatistische Betrachtungen aus filmwissenschaftlicher Perspektive
- 5.1. Dramaturgische Rezeption im Vergleich: Zwischen Dokumentation und Fiktion im Erinnerungsfilm
- 5.2. Die Darstellung der Anne Frank 1959 und 2001
- 5.3. Entwurf von Leitlinien im Umgang mit filmischer Konstruktion in Historienfilmen für Produktion und Rezeption
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
- 6.1. Zusammenfassung
- 6.2. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die dramaturgische Rezeption der Tagebuchaufzeichnungen der Anne Frank in zwei Verfilmungen: "The Diary of Anne Frank" (1959) und "Anne Frank: The Whole Story" (2001). Ziel ist es, die filmische Darstellung im Kontext medienethischer und filmanalytischer Grundlagen zu beleuchten und einen Vergleich beider Filme vorzunehmen. Die Arbeit analysiert die jeweiligen filmischen Mittel und deren Wirkung auf die Rezeption.
- Medienethische Aspekte der Darstellung der Holocaust-Thematik
- Filmanalytische Betrachtung der narrativen Struktur, des Visuellen und des Auditiven
- Vergleich der beiden Filme hinsichtlich ihrer historischen Genauigkeit und dramaturgischen Gestaltung
- Rezeption und Wirkung der Filme auf das Publikum
- Entwicklung von Leitlinien für den Umgang mit filmischer Konstruktion in Historienfilmen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein, beschreibt die Rezeptions- und Editionsgeschichte des Tagebuchs von Anne Frank und formuliert die Forschungsfrage. Sie skizziert den interdisziplinären Ansatz (medienethische und filmanalytische Perspektiven) und die methodische Vorgehensweise, die die Arbeit zur Erreichung ihrer Zielsetzung nutzt.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden die relevanten medienethischen Prinzipien im Umgang mit der Holocaust-Thematik erläutert, gefolgt von einer Einführung in die filmanalytischen Methoden, die im weiteren Verlauf der Arbeit Anwendung finden werden. Schließlich werden wichtige historische Fakten zum Leben von Anne Frank und ihrem Tagebuch präsentiert, um den Kontext für die folgenden Filmanalysen zu schaffen.
3. The Diary of Anne Frank (1959): Diese Sektion analysiert den Film "The Diary of Anne Frank" (1959) unter narrativen, visuellen und auditiven Aspekten. Es werden die Charaktere, die dramatische Struktur, die filmische Gestaltung und deren Wirkung auf das Verständnis der Geschichte beleuchtet. Die Analyse untersucht, wie die Geschichte im Film erzählt wird und welche Entscheidungen in Bezug auf die Darstellung der Figuren und Ereignisse getroffen wurden. Der Fokus liegt auf der dramaturgischen Gestaltung und ihrer Wirkung auf die Rezeption des Stoffes.
4. Anne Frank: The Whole Story (2001): Analog zu Kapitel 3 wird hier der Film "Anne Frank: The Whole Story" (2001) einer detaillierten Filmanalyse unterzogen. Die Analyse deckt narrative, visuelle und auditive Elemente ab und befasst sich mit der Frage, wie diese Elemente im Vergleich zum Film von 1959 die Geschichte von Anne Frank erzählen und welche Auswirkungen dies auf die Wahrnehmung des Zuschauers hat. Die Analyse untersucht die historischen Genauigkeiten und die dramaturgische Umsetzung.
5. Komparatistische Betrachtungen aus filmwissenschaftlicher Perspektive: Dieser Abschnitt vergleicht beide Filme und untersucht die unterschiedlichen dramaturgischen Ansätze und die Darstellung Anne Franks in beiden Produktionen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die historische Genauigkeit, die narrative Struktur und die filmischen Mittel herausgearbeitet. Ein wichtiger Aspekt ist die Untersuchung, wie die jeweilige Zeit der Entstehung der Filme die Darstellung beeinflusst hat.
Schlüsselwörter
Anne Frank, Tagebuch, Holocaust, Filmanalyse, Dramaturgie, Erinnerungsfilm, Medienethik, Historienfilm, Rezeption, Verfilmung, "The Diary of Anne Frank", "Anne Frank: The Whole Story", Dokumentation, Fiktion, historische Genauigkeit, filmische Konstruktion.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Analyse der filmischen Darstellung des Tagebuchs der Anne Frank
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die dramaturgische Rezeption des Tagebuchs der Anne Frank in zwei Verfilmungen: "The Diary of Anne Frank" (1959) und "Anne Frank: The Whole Story" (2001). Im Mittelpunkt steht ein Vergleich beider Filme hinsichtlich ihrer filmischen Mittel und deren Auswirkungen auf die Rezeption.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die filmische Darstellung der Anne Frank im Kontext medienethischer und filmanalytischer Grundlagen. Sie vergleicht die beiden Filme hinsichtlich ihrer historischen Genauigkeit und dramaturgischen Gestaltung und analysiert die jeweiligen filmischen Mittel und deren Wirkung auf die Rezeption. Letztendlich sollen Leitlinien für den Umgang mit filmischer Konstruktion in Historienfilmen entwickelt werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt medienethische Aspekte der Darstellung des Holocaust, filmanalytische Betrachtungen der narrativen Struktur, des Visuellen und des Auditiven beider Filme, einen Vergleich der historischen Genauigkeit und dramaturgischen Gestaltung, die Rezeption und Wirkung der Filme sowie die Entwicklung von Leitlinien für den Umgang mit filmischer Konstruktion in Historienfilmen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlagen (medienethische und filmanalytische Grundlagen sowie historische Grundlagen zu Anne Frank), Filmanalyse von "The Diary of Anne Frank" (1959), Filmanalyse von "Anne Frank: The Whole Story" (2001), komparatistische Betrachtungen aus filmwissenschaftlicher Perspektive (Vergleich der beiden Filme) und Zusammenfassung und Ausblick.
Wie wird die Filmanalyse durchgeführt?
Die Filmanalyse in den Kapiteln 3 und 4 umfasst eine detaillierte Untersuchung der narrativen Struktur, der visuellen Gestaltung und der auditiven Elemente beider Filme. Dabei wird analysiert, wie diese Elemente die Geschichte erzählen und welche Auswirkungen sie auf die Wahrnehmung des Zuschauers haben.
Was ist das Ergebnis des Vergleichs der beiden Filme?
Das fünfte Kapitel vergleicht die beiden Filme hinsichtlich ihrer dramaturgischen Ansätze und der Darstellung Anne Franks. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die historische Genauigkeit, die narrative Struktur und die filmischen Mittel werden herausgearbeitet. Die Arbeit untersucht auch den Einfluss der jeweiligen Entstehungszeit der Filme auf deren Darstellung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Anne Frank, Tagebuch, Holocaust, Filmanalyse, Dramaturgie, Erinnerungsfilm, Medienethik, Historienfilm, Rezeption, Verfilmung, "The Diary of Anne Frank", "Anne Frank: The Whole Story", Dokumentation, Fiktion, historische Genauigkeit, filmische Konstruktion.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich mit der filmischen Darstellung des Holocaust und der Rezeption des Tagebuchs der Anne Frank auseinandersetzt. Sie ist für Studierende und Forschende im Bereich der Filmwissenschaft, Medienwissenschaft und Geschichtswissenschaft relevant.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Eric Kresse (Author), 2012, Anne Frank im Spielfilm: Die dramaturgische Rezeption ihrer Tagebuchaufzeichnungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/201656