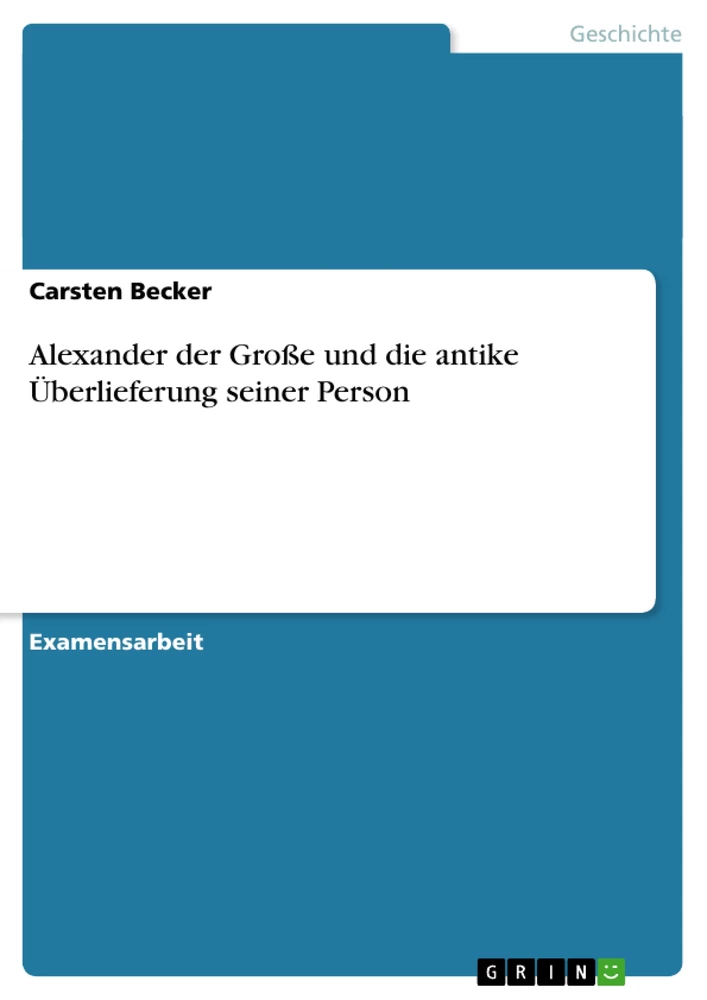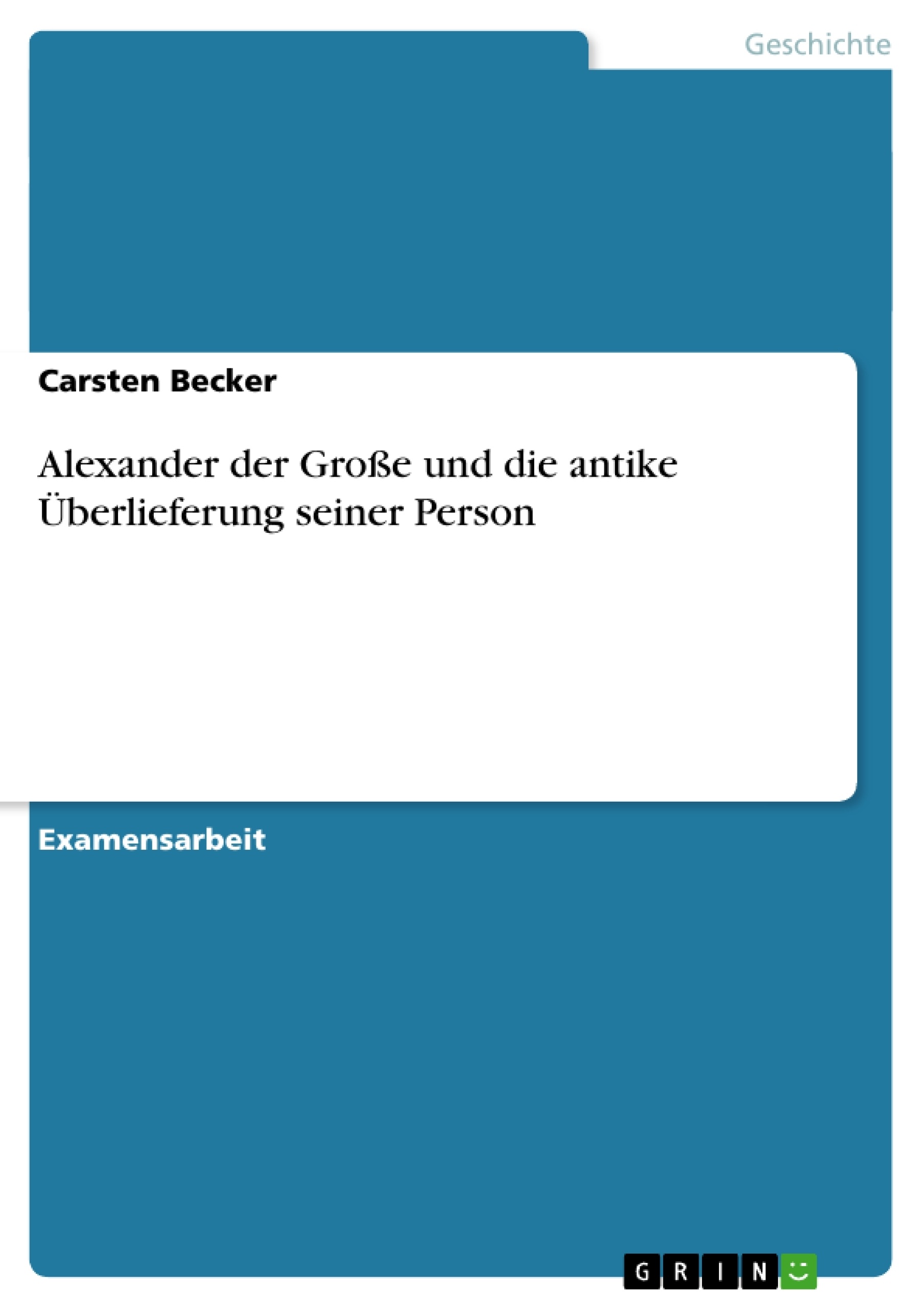Die vorliegende Arbeit analysiert die Verortung von einer legendären Figur der Weltgeschichte innerhalb der geistigen und kulturellen Landschaft der Antike, von Alexander dem Großen. Dem berühmten König gelang das Unmögliche, das Unfassbare in mehrfacher Hinsicht: Er konsolidierte kurzerhand die bis dahin noch nicht gänzlich ausgeprägte makedonische Vorherrschaft im griechischen Raum und im dazugehörigen bedeutendsten Pakt der dort ansässigen Staaten, dem `Korinthischen Bund´ und überwand zugleich die Spannungen zwischen den hellenischen Volksteilen zugunsten der nun gestärkten pannationalen Union. Ferner verwandelte er das Reich der Argeaden als Träger der nunmehr gefestigten, blühenden südosteuropäischen Allianz in einer unglaublichen Geschwindigkeit von zwölf Jahren blitzartig in die dominierende Hegemonialmacht der Oikumene und überdies war er im Begriff, eine neue verheißungsvolle Weltordnung zu etablieren, deren Endziel es war sämtliche Völker innerhalb seines gigantischen Reiches in einer kulturellen Einheit aufgehen zu lassen, im Ganzen genommen eine bis heute bemerkenswerte Leistung. Insofern drängt sich eine Bestandsaufnahme der Resonanz und der Reaktionen, die demjenigen, der dieses alles vollbracht hatte, bis zu einem geraumen Zeitabschnitt nach seinem Tode von der Gesellschaft entgegengebracht wurde sowie eine Beschäftigung mit dem, was den Menschen ausmachte, mit dem Wesen desjenigen, der der irdischen Zivilisation ein neues Gesicht gegeben hatte, mit dem Spiegelbild Alexander des Großen in der Antike, gerade zu auf. Vor diesem Hintergrund sollen vorwiegend die wichtigsten Zeugnisse, die zwischen den Anfängen des Hellenismus, also noch zu den Lebzeiten oder bald nach dem Tode des Königs etwa im vierten Jahrhundert v. Chr. und dem Untergang des Römischen Imperiums ungefähr im fünften Jahrhundert n. Chr. ein höheres Maß an Popularität während des Stadiums ihrer Abfassung erlangt hatten, untersucht werden. Dagegen sollen solche Überlieferungsgegenstände, welche innerhalb der dazugehörenden Epoche wenig Beachtung fanden entsprechend knapp abgehandelt werden.
Aus diesem Kontext ergibt sich die zentrale Fragestellung dieser Arbeit: Welche Spiegelung erfuhr Alexander der Große in der gesellschaftlich beachteteren antiken Überlieferung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die bedeutendsten Autoren der Primärtradition
- Kallisthenes von Olynth
- Anaximenes von Lampsakos
- Onesikritos von Astypalaia
- Chares von Mytilene
- Nearchos von Kreta
- Ephippos von Olynth
- Kleitarchos von Alexandreia
- Ptolemaios Lagu
- Aristobulos von Kassandreia
- Die philosophischen Schulen unter besonderer Berücksichtigung der Peripatetiker
- Die Zeugnisse einiger Rhetoriker
- Die bekanntesten sekundären, erhaltenen Alexanderhistoriker
- Der Alexanderroman
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Rezeption und dem Spiegelbild Alexander des Großen in der antiken Überlieferung. Die Arbeit untersucht, wie die historischen Quellen den berühmten König, seine Taten und sein Wesen darstellten und wie seine Persönlichkeit in der kulturellen Landschaft der Antike verortet wurde. Die Arbeit analysiert insbesondere die Primärquellen, d.h. die Zeugnisse, die noch zu Lebzeiten oder kurz nach dem Tod Alexanders entstanden sind, um ein umfassendes Bild seiner Rezeption zu gewinnen.
- Die wichtigsten Autoren der Primärtradition und ihre Werke
- Die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen Alexanders in den historischen Quellen
- Der Einfluss von philosophischen Schulen, insbesondere der Peripatetiker, auf die Darstellung Alexanders
- Die Rolle des Alexanderromans als Quelle für die Rezeption Alexanders
- Die Entwicklung des Alexanderbildes in der Antike
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die zentrale Fragestellung vor: Welche Spiegelung erfuhr Alexander der Große in der gesellschaftlich beachteteren antiken Überlieferung? Kapitel 2 untersucht die bedeutendsten Autoren der Primärtradition, die zeitgenössisch zu Alexanders Leben oder kurz danach schrieben. In diesem Kapitel werden die Autoren vorgestellt, ihre Werke und ihre Beziehung zu Alexander analysiert, um die verschiedenen Perspektiven auf den König zu beleuchten. Kapitel 3 widmet sich den philosophischen Schulen, insbesondere den Peripatetikern, und untersucht, wie sie Alexanders Leben und Wirken interpretierten.
Schlüsselwörter
Alexander der Große, antike Überlieferung, Primärtradition, Sekundärquellen, Alexanderroman, Historiografie, Hellenismus, Peripatetiker, Rhetorik, Quellenkritik, Rezeption.
- Quote paper
- Carsten Becker (Author), 2002, Alexander der Große und die antike Überlieferung seiner Person , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/20132