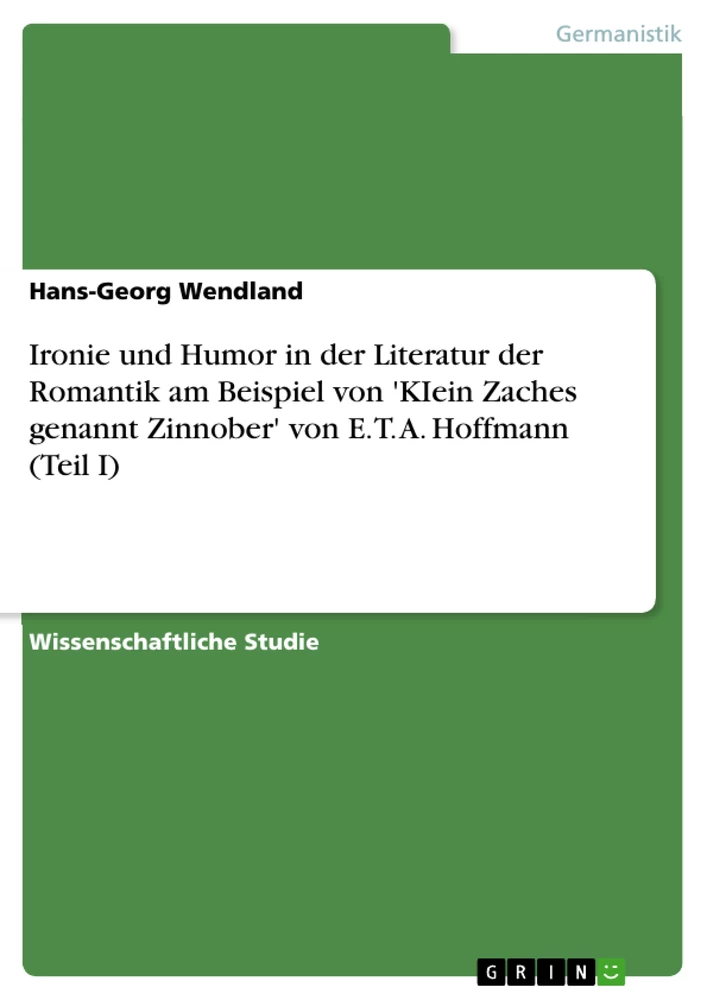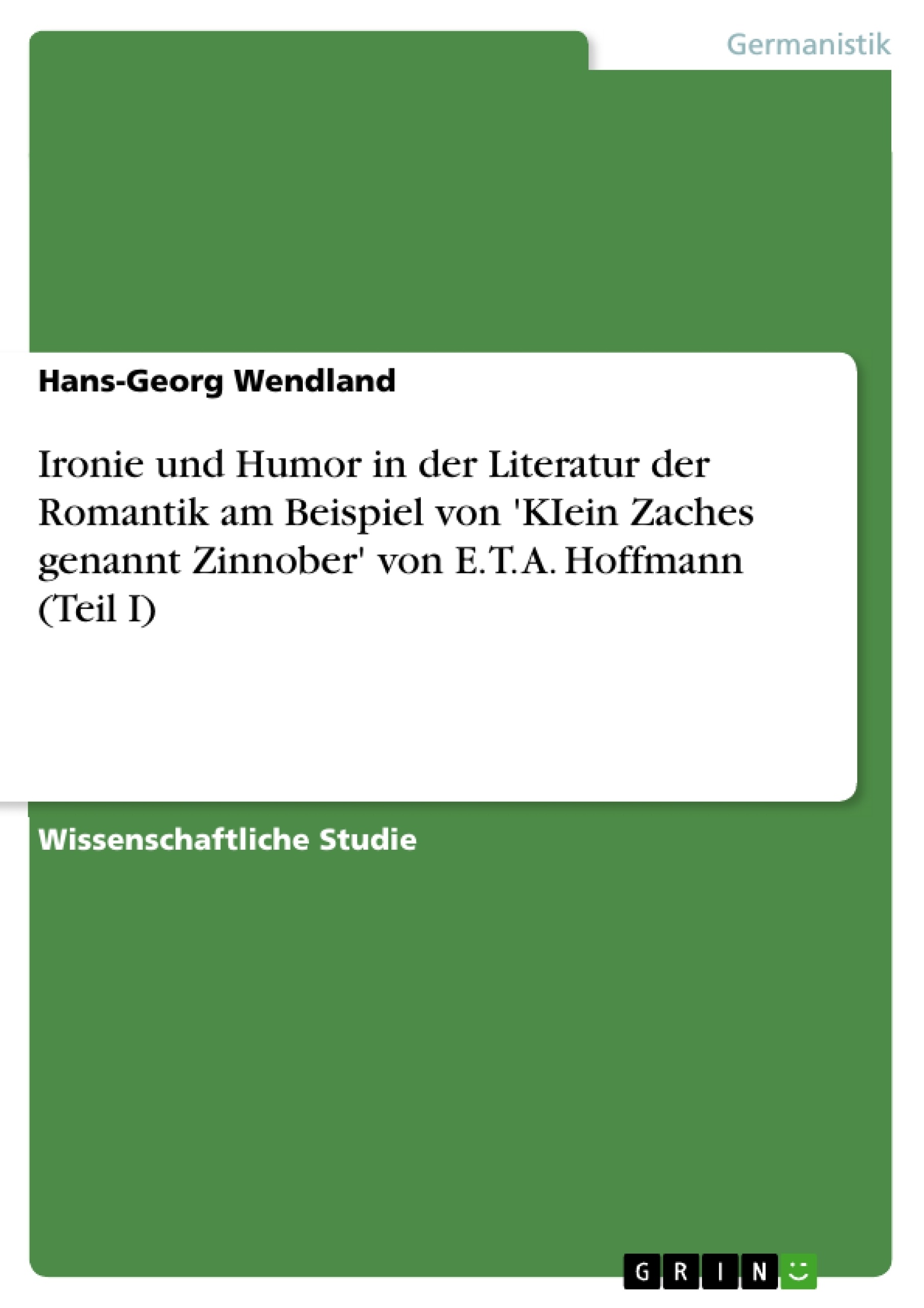In dieser Arbeit geht es darum, die Begriffe Ironie und Humor in ihrem wechselseitigen Verhältnis und in ihrer Entwicklung als literarische Gestaltungsmittel zu untersuchen und aufzuzeigen, dass beiden Begriffe in der Literatur der Romantik – und besonders im Werk E. T. A. Hoffmanns – ein besonderer Stellenwert zukommt. Dabei
sollen sowohl gemeinsame als auch unterscheidende Merkmale herausgearbeitet werden.
In den zeitgenössischen Untersuchungen erscheint die Ironie zumeist als eine bewusste, intellektuelle, reflexive erzählerische Haltung, während der Humor eher als eine gemütvolle, aus dem Herzen kommende und auf Verständnis und Ausgleich ausgerichtete Haltung des Erzählers verstanden wird. [1] Eine ähnliche Auffassung finden wir auch bei E. T. A. Hoffmann, beispielsweise im dritten Kapitel der „Prinzessin Brambilla“, wo in einem Streitgespräch des Italieners Celionati mit dem deutschen Maler Franz Reinhold zwischen einer spezifisch italienisch geprägten, scherz- und
possenhaften Ironie, die sich auf die äußere Erscheinungswelt bezieht, und einer von innen heraus tönenden deutschen Ironie – besser: einer gemütvollen, innerlichen Art deutschen Humors als umfassenderes Prinzip – unterschieden wird, „die nun einmal
unserem deutschen Sinn eigen“ ist. (Sämtliche Werke, Band 3, 814) Friedrich Schlegel hat – wie noch zu zeigen sein wird – u. a. in seinen „Athenäums-Fragmenten“ (1798) in Erweiterung solcher Überlegungen einen neuen poetologischen Begriff der
„romantischen Ironie“ formuliert, die den literarischen Diskurs seiner Zeit nachhaltig geprägt und beeinfluss hat.
E. T. A. Hoffmann wird häufig als „Vater der phantastischen Erzählung“ (Woodgate 33) und als Wegbereiter der phantastischen Literatur angesehen, in der die Nachtseiten der Natur und die Schattenseiten des menschlichen Seelenlebens dargestellt werden, wo sich gespenstische und dämonische Kräfte manifestieren – aus
psychologischer Sicht: Grenzphänomene zwischen überspannter Exaltation und Wahnsinn -, die hinter einer Fassade bürgerlicher Normalität und Harmonie auftauchen und in die Alltagswelt einbrechen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zeitgenössische Sichtweisen der Begriffe
- E. T. A. Hoffmann: Begründer der phantastischen Literatur
- Der Alltag und das Wunderbare in Hoffmanns poetologischem Konzept
- Die Rolle der Ironie beim desillusionierenden Erzählen
- Die Begriffe \"Ironie\" und \"Humor\" bei Hoffmann
- \"Klein Zaches\": ein \"superwahnsinniges Buch\"?
- Zeitgenössische Kommentare zu \"Klein Zaches\"
- Zwischen Alltagsrealität und Phantastik
- Die Entwicklung der Begriffe Ironie und Humor in Philosophie, Rhetorik und Literatur
- Ursprung der Ironie und des Humors als literarische Begriffe
- Sokrates: der Meister der philosophischen Ironie
- \"Eironeia\" und \"Alazoneia\" in der griechischen Komödie
- Der Einfluss der römischen Rhetorik auf den Ironiebegriff
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Begriffe Ironie und Humor in ihrer wechselseitigen Beziehung und ihrer Entwicklung als literarische Gestaltungsmittel. Sie zeigt auf, dass beide Begriffe in der Literatur der Romantik - insbesondere im Werk E. T. A. Hoffmanns - eine besondere Bedeutung einnehmen.
- Die Entwicklung der Begriffe Ironie und Humor in Philosophie, Rhetorik und Literatur
- Die Rolle der Ironie und des Humors als erzählerische Gestaltungsprinzipien in der Romantik
- Die Analyse der Erzählung „Klein Zaches genannt Zinnober“ von E. T. A. Hoffmann im Hinblick auf Ironie und Humor
- Die Bedeutung des „desillusionierenden Erzählers“ in Hoffmanns Werk
- Die Beziehung zwischen Alltagsrealität und Phantastik in Hoffmanns Poetik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den theoretischen Rahmen der Arbeit vor. Sie erläutert die Bedeutung von Ironie und Humor in der Literatur der Romantik und zeigt die spezifischen Merkmale beider Begriffe auf. Im zweiten Kapitel werden die zeitgenössischen Sichtweisen auf Ironie und Humor präsentiert und an E. T. A. Hoffmanns Werk und der „romantischen Ironie“ Friedrich Schlegels veranschaulicht. Das dritte Kapitel beleuchtet E. T. A. Hoffmann als „Vater der phantastischen Erzählung“ und geht auf die Rolle des Unheimlichen und Phantastischen in seinem Werk ein. Im vierten Kapitel wird Hoffmanns poetologisches Konzept analysiert, das den Leser aus dem Alltagsverstand befreien und ihm Zugang zu den Erscheinungen des Wunderbaren verschaffen soll.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Rolle der Ironie beim „desillusionierenden Erzählen“ und untersucht das Verfahren der „Erzählerironie“, das in Hoffmanns Werken häufig vorkommt. Im sechsten Kapitel werden die Begriffe Ironie und Humor in Hoffmanns Werk und insbesondere in der Erzählung „Klein Zaches“ genauer betrachtet. Das siebte Kapitel beleuchtet Hoffmanns uneindeutige Haltung gegenüber seiner Erzählung „Klein Zaches“, wobei er diese mal als „ironisierende Fantasie“, mal als „humoristischen Wechselbalg“ bezeichnet.
Das achte Kapitel befasst sich mit zeitgenössischen Kommentaren zu „Klein Zaches“, die die Fähigkeit des Humors hervorheben, sich auf den Flügeln der Fantasie zu erheben und die Alltagswelt in heiterer Unbeschwertheit zu betrachten.
Das neunte Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Alltagsrealität und Phantastik in Hoffmanns Werk und zeigt auf, dass das Phantastische immer wieder in die Alltagswelt einbricht und die gewohnte Ordnung stört.
Das zehnte Kapitel analysiert die Entwicklung der Begriffe Ironie und Humor in Philosophie, Rhetorik und Literatur, beginnend mit der sokratischen Ironie und der „eironeia“ in der griechischen Komödie. Das Kapitel beleuchtet den Einfluss der römischen Rhetorik auf den Ironiebegriff und endet mit einer Definition der rhetorischen Ironie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Begriffen Ironie und Humor als literarische Gestaltungsprinzipien in der Literatur der Romantik am Beispiel der Erzählung „Klein Zaches genannt Zinnober“ von E. T. A. Hoffmann. Die zentralen Themen sind die Entwicklung der Begriffe Ironie und Humor in Philosophie, Rhetorik und Literatur, die Rolle der Ironie und des Humors als erzählerische Gestaltungsmittel, die Analyse der Erzählung „Klein Zaches“ im Hinblick auf Ironie und Humor, der „desillusionierende Erzähler“ in Hoffmanns Werk, die Beziehung zwischen Alltagsrealität und Phantastik in Hoffmanns Poetik.
- Arbeit zitieren
- Hans-Georg Wendland (Autor:in), 2012, Ironie und Humor in der Literatur der Romantik am Beispiel von 'KIein Zaches genannt Zinnober' von E. T. A. Hoffmann (Teil I), München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/200584