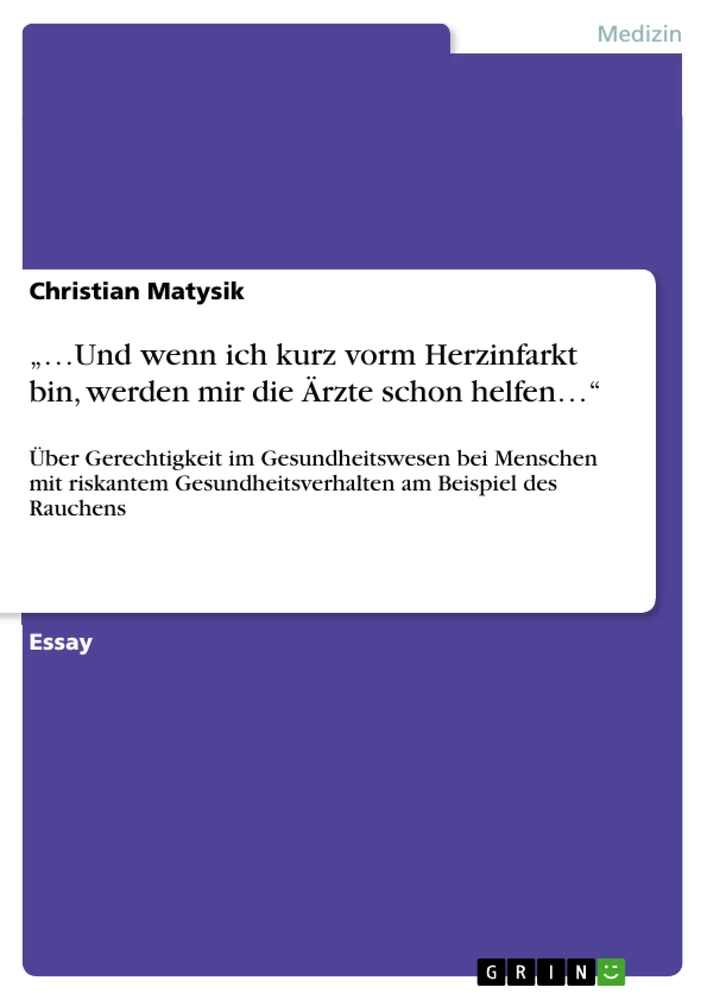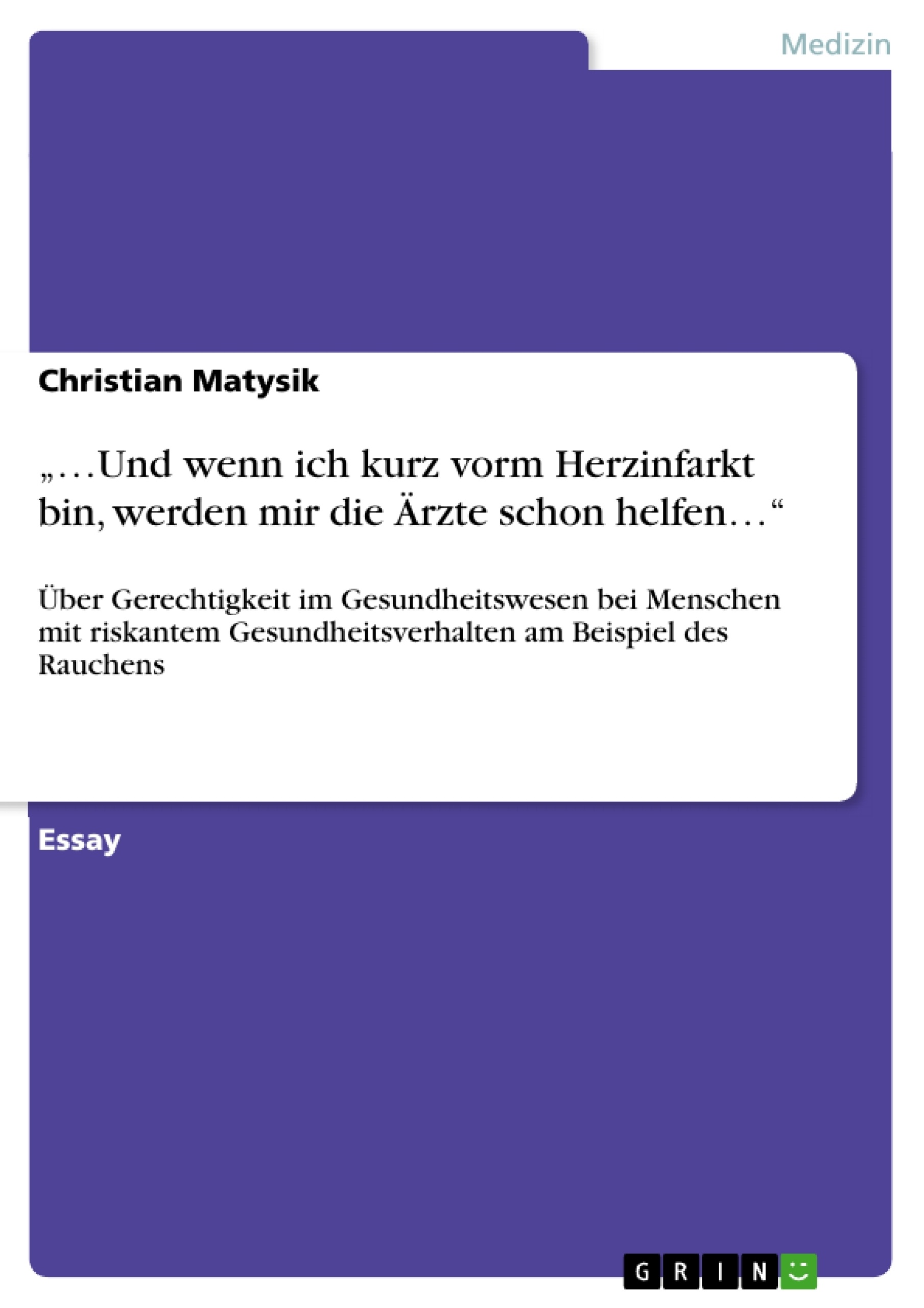Hat jeder ein Recht auf Gesundheit? Wenn jeder ein Recht darauf hat, besitzt dann jeder auch eine Gesundheitspflicht? Kommen Raucher ihren Gesundheitspflichten demnach nicht nach und sind deshalb selbst für ihre [wahrscheinlich] nachfolgenden Erkrankungen verantwortlich? Sollten Raucher deshalb Zusatzabgaben in das nach solidarischen Prinzipien organisierte deutsche Gesundheitssystem leisten? Sollen sie ganz vom System der gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen werden und jede in Anspruch genommene ärztliche Maßnahme, die auf ihr Rauchen zurückgeführt wird, selbst zahlen? All diese Fragen bedürfen des medizin-ethischen Diskurses, welcher im Zentrum dieses Essays steht
Eine Zigarette zu rauchen gibt den Händen etwas zu sein, wirkt anregend, senkt die Appetitschwelle, erleichtert es in Interaktion mit anderen zu treten. Vermutlich gerade die entspannende Wirkung, die somit zum Stressabbau beiträgt, macht das Paffen heute für knapp ein Drittel der über 15-jährigen Bevölkerung Deutschlands derart lohnenswert. Viele Menschen versuchen Belastungen durch den Griff zur Zigarette zu bewältigen. Vor den 1940er Jahren empfahlen Ärzte ihren Patienten aus Entspannungsgründen sogar das Rauchen (vgl. Schwarzer 2004: 309f.).
Allerdings wandelte sich das Bild der Zigarette nach den ersten empirischen Studien über die negativen Gesundheitsauswirkungen des dauerhaften Konsums. Heute gilt das Inhalieren von Tabakrauch als die größte indirekte und vermeidbare Todesursache (vgl. ebd.: 105f.). Unter anderem sind Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und chronische Atemwegserkrankungen in ihrer Häufigkeit vermehrt bei Rauchern als bei Nichtrauchern vorzufinden. Dadurch ist in vielen Fällen mit einer Verkürzung der Lebenszeit zu rechnen.
Dieses Wissen ist bis zur heutigen Zeit in alle Bildungsschichten vorgedrungen. Ist das Wissen aber auch bis in das Bewusstsein der Menschen vorgedrungen? Obwohl die Zahl der Raucher rückläufig ist, bemühen sich gerade Jugendliche - trotz der unangenehmen Wirkungen des erstmaligen Rauchens - dieses schädigende Gesundheitsverhalten „zu erlernen“ und führen ihren Körper in die Gewöhnung und zur Abhängigkeit (vgl. Hackauf, Winzen 2004: 118ff. und Lampert, Richter 2006: 199ff.).
Winston Churchill formulierte, meiner Meinung nach sehr passend: „Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den meisten Fällen auf – zu lesen“. Sehen somit Raucher, aufgrund ihrer Abhängigkeit, ihre Gesundheit nicht als „höchstes Gut“ an? Des Weiteren stellen sich mir in diesem Zusammenhang folgende Fragen: Hat jeder ein Recht auf Gesundheit? Wenn jeder ein Recht darauf hat, besitzt dann jeder auch eine Gesundheitspflicht? Kommen Raucher ihren Gesundheitspflichten demnach nicht nach und sind deshalb selbst für ihre [wahrscheinlich] nachfolgenden Erkrankungen verantwortlich? Sollten Raucher deshalb Zusatzabgaben in das nach solidarischen Prinzipien organisierte deutsche Gesundheitssystem leisten? Sollen sie ganz vom System der gesetzlichen Krankenkassen ausgeschlossen werden und jede in Anspruch genommene ärztliche Maßnahme, die auf ihr Rauchen zurückgeführt wird, selbst zahlen? All diese Fragen bedürfen des medizin-ethischen Diskurses, welcher im Zentrum dieses Essays steht.
Die Raucherquote in Abhängigkeit der gesellschaftlichen Schicht ist bisher häufig untersucht worden. Als Ergebnis kam wurde stets deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit der physischen und psychischen Nikotinabhängigkeit umso höher ist, je niedriger Bildungsstand und Einkommen der Menschen ist (vgl. Schwarzer 2005: 311f.). Die Ursachen für diesen Befund sind dabei vielseitig. Der Psychologe Schwarzer betont in diesem Zusammenhang, dass das Rauchen aber immer individuelles Verhalten mit situativen und persönlichen Einflussgrößen ist (vgl. ebd. 312ff.) .
Da der Ausstieg aus der Abhängigkeit, aufgrund des hohen Suchtpotentials, schlecht gelingt, gilt die Verhinderung des Einstiegs in das Rauchen als oberes Präventionsziel (vgl. Maschewski-Schneider 2010: 31.e1). Das Gesundheitsziel „Tabakkonsum reduzieren“ umfasst des Weiteren folgende Zielbereiche: Tabaksteuererhöhungen, vollständiges Verbot von Tabakwerbung, Schutz vor Passivrauchen, Förderung des Ausstiegs aus der Tabakabhängigkeit (vgl. ebd.: 31.e1).
Schwarzer nimmt in diesem Zusammenhang an, dass unter allen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die Verringerung des Einstiegs in das Rauchen die effektivste Einzelmaßnahme darstellt und deshalb immer wieder wirksamere Maßnahmen zur Tabakkontrolle gefordert werden (vgl. Schwarzer 323ff.). Ist eine Präventionsstrategie gegen das Rauchen nicht unserer aller Verantwortung gegenüber der jungen Generation? Greift man damit zu sehr in die Autonomie der Person ein? Führt gerade das staatliche Eingreifen in diese individuellen Angelegenheiten dazu, dass die Chancen zum gesunden Leben für den Einzelnen verbessert werden? Würde man nicht dadurch gerade den Benachteiligten eine vom sozialen Rang unabhängige Gesundheitsbiografie erst ermöglichen?
Auf der anderen Seite ist unsere moderne Gesellschaft durch eine steigende Lebenserwartung gekennzeichnet. Hense fragt in diesem Zusammenhang, ob deshalb überhaupt Anlass für derartige Zwangsmaßnahmen zur Sicherung der Gesundheit besteht (vgl. Hense 2007: 301f.)? Sollten wir nicht lieber einige Jahre besonders - auch mit gesundheitsschädigendem Verhalten – genießen, anstatt krampfhaft zu versuchen möglichst alt (und dabei unglücklich?) zu werden?
Überhaupt gab es in der Diskussion um Gesundheit einen Paradigmenwechsel. Bei der WHO-Konferenz von Alma-Ata 1978 hieß es damals noch: „Health for All – by the Year 2000“. Hieraus resultiert besonders das Recht auf Gesundheit. Auch in der Verfassung findet man ein individuelles Selbstbestimmungsrecht über die leibliche Integrität. Eine Pflicht zur Gesundheit ist darin jedoch nicht verankert. Hense bemerkt dabei, dass der Inhaber eines subjektiven Rechts nicht zugleich Pflichtensubjekt im Blick auf das gleiche Schutzgebiet sein kann (vgl. ebd. 2007: 301).
Ist damit auch gemeint, dass ein jeder auch ein Recht auf Krankheit hat? Damit wäre eine Pflicht zur Gesundheit weiterhin auszuschließen. Auf der anderen Seite darf das Selbstbestimmungsrecht im Interesse anderer legitimierter Gemeinwohlbelange eingeschränkt werden (vgl. Höfling 2009: 287f.). Liegt die individuelle Gesundheit im Bereich des Gemeinwohls? Erfordern somit der Schutz der Rechte anderer bzw. die Erfordernisse des Gemeinwohls eine individuelle Gesundheitspflicht? Kann somit die Entscheidungsautonomie des Einzelnen beschnitten werden? Verliert dadurch etwa sogar die Gesundheitspflicht den Charakter einer Privatangelegenheit? Ist somit Gesundheit ein öffentliches Gut, das um seiner selbst Willen zu schützen ist? Kann somit verhindert werden, dass sich soziale Unterschiede auf den Gesundheitszustand auswirken?
Das Solidarprinzip des Gesundheitswesens steckt schon länger in der Finanzkrise. Es sind nach Vermeulen somit gerechte Entscheidungsfindungsprozesse nötig, um solidarisch finanzierte Gesundheitsleistungen zu legitimieren (vgl. Vermeulen 2005: 55). Eine maximalistische Gesundheitsversorgung zu Lasten von drohenden Beeinträchtigungen anderer Sozialleistungen ist dabei nicht erstrebenswert. Der Jurist Dederer argumentiert hierzu, dass Gesundheit ein Gemeinschaftsgut von hohem Rang ist, es aber auf eine umfangreiche Gesundheitsversorgung für den Einzelnen kein durch die Verfassung begründeter Rechtsanspruch existiert (vgl. ebd.: 55f.). Gewährt die Verfassung dabei nur ein gesundheitliches Existenzminimum?
Es gilt einen „gesunden“ Mittelweg im Versorgungssystem zu finden. Dabei muss zwischen der ungleichen Verteilung, die ein freier Markt schaffen würde, und der uneffizienten Verteilung durch ein staatlich organisiertes System vermittelt werden (vgl. ebd.: 56). Dabei wird nach Wolfram Höfling die klassisch-normative Leitidee der ärztlichen Hilfe zunehmend durch den Leitbegriff der präferenz-orientierten Dienstleistung abgelöst (vgl. Höfling 2009: 288). Ist es somit nicht mehr vertretbar, dass verpflichtende Maßnahmen zur Prävention chronischer Krankheiten eingeführt werden? Stellt dies eine unangemessene Einschränkung der individuellen Freiheit dar? Kommt dieses Denken daher, dass viele chronische Erkrankungen als normal, regelhaft und schicksalhaft in ihrem Auftreten angesehen werden?
Es ist zu beachten, dass viele chronische Erkrankungen aus riskantem Gesundheitsverhalten resultieren. Beispielsweise hätten laut Schätzungen Schwarzers 90 Prozent der an Lungenkrebs Erkrankten diese Krankheit nie bekommen, wenn sie nie geraucht hätten (vgl. Schwarzer 2004: 105). Sollen somit diejenigen, die ein tadelloses Gesundheitsverhalten gewählt haben, finanziell für die „rücksichtslose Bevölkerung“ aufkommen? Ist das gerecht? Sollen diejenigen, die sich vernünftig verhalten und Einschränkungen ihrer Lebensmöglichkeiten in Kauf nehmen, die Last tragen, dass andere es nicht tun?
Auf der anderen Seite sind menschliche Verhaltensweisen nicht immer freiwillig gewählt, sodass es kein simpler Entschluss ist, davon abzulassen. Patzig bemerkt dabei, dass viele Lebensgewohnheiten – dazu ist riskantes Gesundheitsverhalten zu zählen -nicht eine Krankheit an sich darstellen, sondern schon selbst Symptome einer psychischen Erkrankung seien (vgl. Patzig 1993: 81). Ist somit beispielsweise ein Mensch mit posttraumatischer Belastungsstörung, der infolge eines einschneidenden Ereignisses zur Psychostimulanz Nikotin gegriffen hat, als „rücksichtsloser Bürger“ einzustufen, da seine Folgeerkrankungen aus den solidarisch finanzierten Mitteln des gesetzlichen Gesundheitssystems finanziert werden? Wo ist die Trennung zu ziehen? Wer hat den Freiheitsgrad sein Leben überhaupt gesund führen zu können? Und selbst wenn das Können vorhanden ist, wird ein Können in diesem Zusammenhang gleichzeitig ein Wollen, welches zwingend in eine Handlung überführt wird? Hat ein jeder dabei nicht das Recht auf eine freie Prioritätenwahl bezüglich seines Lebens? Besteht die Verantwortung wenn schon nicht sich selbst gegenüber, dann wenigstens gegenüber anderen bzw. dem Gemeinwohl gesundheitsbewusst zu verhalten? Existiert gar eine staatliche Legitimation für Zwangsmaßnahmen, da der Einzelne gar nicht in der Lage ist, sich gemeinwohlorientiert zu verhalten?
Die Risikowahrnehmung bezüglich der Gesundheitsgefahren des Rauchens sind in der Bevölkerung zwar vorhanden, doch die Einschätzung des persönlichen Risikos Folgeerkrankungen zu erleiden, schätzen viele Menschen laut dem Psychologen Schwarzer als unrealistisch niedrig ein (vgl. Schwarzer 2004: 323). Zudem sehen sie geringe Erfolgsaussichten für ihre eigene Entwöhnung und äußern, dass Gesundheit und Krankheit in diesem Zusammenhang eher zufällig in der Bevölkerung verteilt sind (vgl. ebd.: 323). Die Risikowahrnehmung beim Autofahren ist laut Hense höher, sodass das Anschnallen als „akzeptierte Zwangsmaßnahme“ gilt (vgl. Hense 2007: 302f.) . Woher kommt es, dass eine solche Zwangsmaßnahme toleriert wird? Liegt es daran, dass die gesundheitlichen Folgen eines Unfalls für den Einzelnen sofort ersichtlich sind? Beim Rauchen dagegen dauert es in der Regel Jahrzehnte, bis sich ernste Schädigungen einstellen. Besitzen viele Menschen diese prospektive Verantwortung für sich selbst gar nicht? Wie würden sie dann reagieren, wenn Zwangsmaßnahmen beim Rauchen eingeführt werden? Werden verpflichtende Maßnahmen zum Wohle des präventiven Gedankens als unangemessene Einschränkungen der individuellen Freiheit wahrgenommen? Stellt die Tabaksteuer bereits eine derartige Zwangsmaßnahme dar?
[...]
- Quote paper
- Christian Matysik (Author), 2012, „…Und wenn ich kurz vorm Herzinfarkt bin, werden mir die Ärzte schon helfen…“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/200295