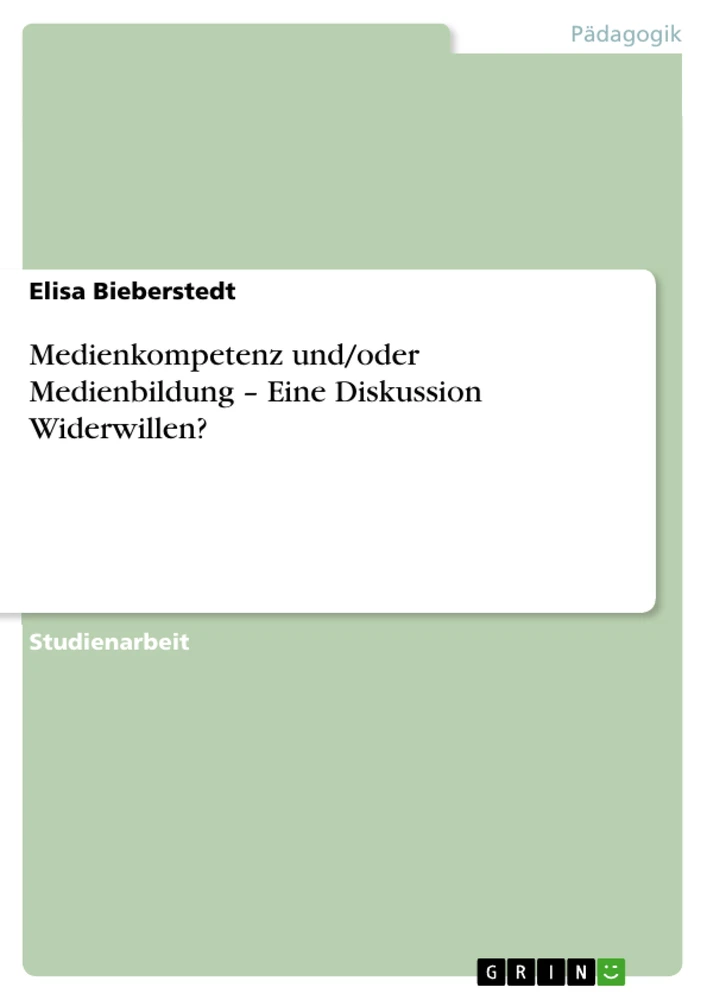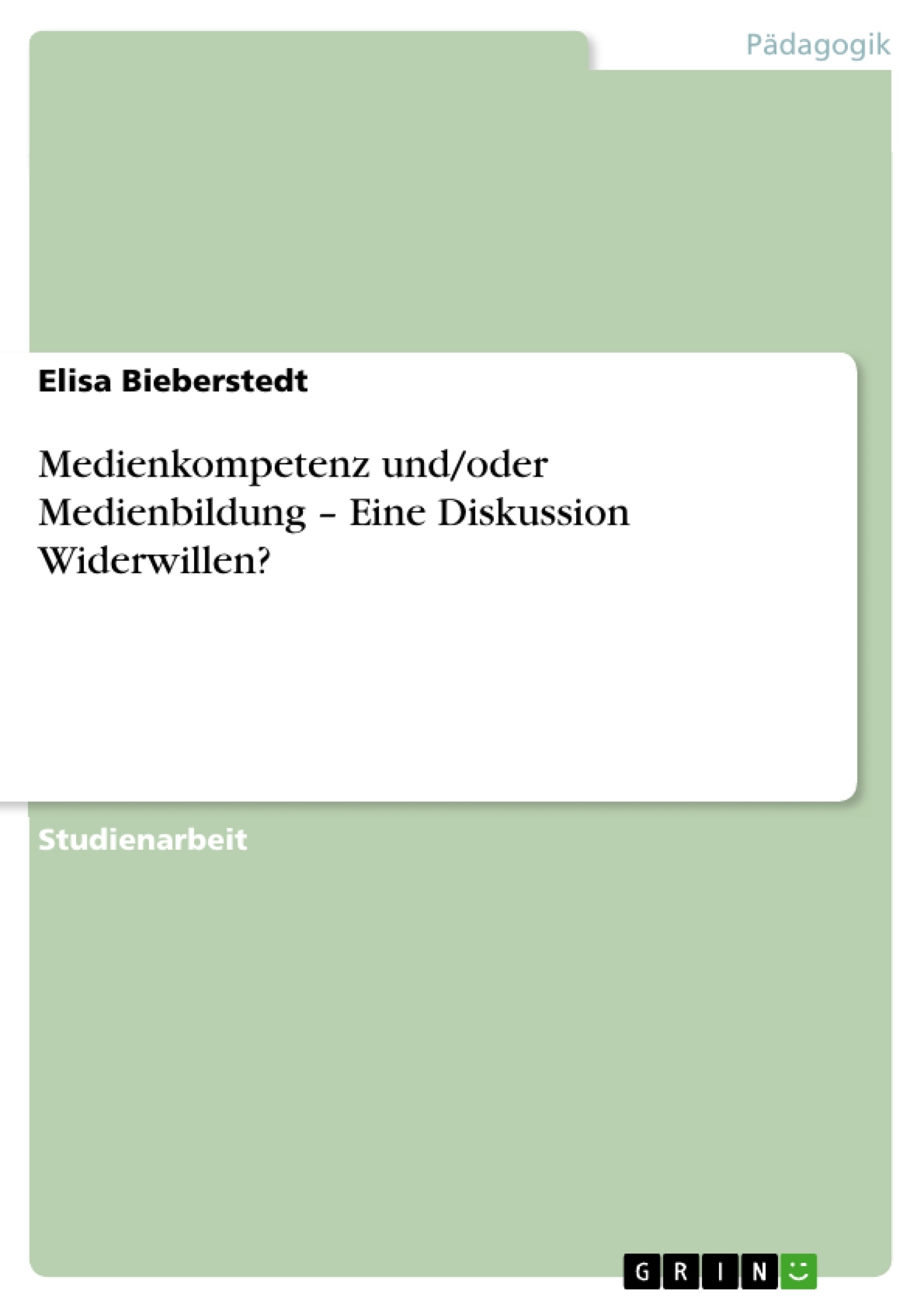1. Einleitung
"Medienkompetenz ist zu einem schillernden In-Begriff avanciert. In der Öffentlichkeit wird recht Unterschiedliches dazu laut und verlautbar; aber auch in wissenschaftlichen Zusammenhängen finden sich vielerlei Positionen, die in der Zusammenschau nicht unbedingt einen Begriff von Medienkompetenz ergeben."1
Mit diesen einleitenden Worten benennen Fred Schell, Elke Stolzenburg und Helga Theunert in ihrer Publikation Medienkompetenz. Grundlagen und pädagogisches Handeln von 1999 eine in der Medienpädagogik bestehende Problematik. Der Medienkompetenzbegriff und das damit verbundene Konzept stehen seit Beginn der neunziger Jahre verstärkt in der Diskussion. Die rasante Entwicklung des World Wide Webs sowie der Multimedia-Landschaft verlangen nach neuen Definitionen und provozieren dabei immer wieder neue Diskussionen. Zu der medienpädagogischen Debatte gesellt sich seit ein paar Jahren der Begriff der Medienbildung. Auch zu diesem Terminus finden sich in der Literatur zahlreiche Definitionsversuche und verschiedenste Positionen. In den letzten Jahren wurden auch immer wieder Stimmen laut, die ein Ende der anhaltenden Kontroverse – Medienkompetenz und/oder Medienbildung – fordern. Andere sehen im Disput wiederum für die oftmals als profillos bezeichnete Medienpädagogik die Chance der Weiterentwicklung.
Gegenstand dieser Hausarbeit wird es sein, das Beziehungsgeflecht zwischen Medienkompetenz und Medienbildung zu untersuchen und verschiedene Lösungsansätze zu analysieren. Als Grundlage für die weitere Untersuchung werden zunächst die Termini Medienkompetenz und Medienbildung in ihren Grundzügen beschrieben und unter Einbeziehung von einschlägigen Werken der Medienpädagogik definiert. Anschließend wird das Verhältnis der Begriffe Medienkompetenz und Medienbildung zueinander beleuchtet. Die dabei gewonnenen Ergebnisse sollen unterstützend bei der Reflexion des Disputs wirken und gegebenenfalls die Möglichkeit eröffnen, eine Tendenz der Entwicklung der Diskussion aufzuzeigen. Die Analyse baut dabei auf Ansichten verschiedener Erziehungswissenschaftler und Medienpädagogen auf.
In der Zusammenfassung erfolgen die abschließende Betrachtung des Sachverhalts, die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen sowie ein Ausblick zur weiteren Entwicklung der medienpädagogischen Debatte beziehungsweise der medienpädagogischen Disziplin an sich.
1 Schell; Stolzenburg; Theunert: Medienkompetenz, S. 18.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Medienkompetenz
- 3. Medienbildung
- 4. Medienkompetenz versus Medienbildung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Verhältnis zwischen Medienkompetenz und Medienbildung und analysiert verschiedene Lösungsansätze zur anhaltenden Debatte. Die Arbeit definiert zunächst die beiden Kernbegriffe und beleuchtet anschließend deren wechselseitige Beziehung. Ziel ist es, die Diskussion zu reflektieren und gegebenenfalls Entwicklungstendenzen aufzuzeigen.
- Definition von Medienkompetenz und Medienbildung
- Vergleichende Analyse von Medienkompetenz und Medienbildung
- Analyse verschiedener Modelle und Ansätze
- Reflexion der anhaltenden Debatte
- Aufzeigen möglicher Entwicklungstendenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problematik des schillernden Begriffs der Medienkompetenz und die vielfältigen, oft widersprüchlichen Positionen in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion. Sie führt den Begriff der Medienbildung ein und benennt die anhaltende Kontroverse zwischen beiden Begriffen, wobei die Arbeit deren Beziehungsgeflecht untersuchen und Lösungsansätze analysieren will. Die methodische Vorgehensweise, bestehend aus der Definition der Kernbegriffe und der anschließenden Analyse ihres Verhältnisses zueinander, wird skizziert, um die Diskussion zu reflektieren und mögliche Entwicklungstendenzen aufzuzeigen. Die Arbeit stützt sich auf die Ansichten verschiedener Erziehungswissenschaftler und Medienpädagogen.
2. Medienkompetenz: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Medienkompetenz anhand verschiedener Ansätze, insbesondere der Modelle von Bernd Schorb und Dieter Baacke. Schorbs Modell gliedert Medienkompetenz in Wissen, Bewerten und Handeln, während Baacke die Segmente Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung unterscheidet. Das Kapitel beleuchtet die kommunikative Kompetenz als Grundlage der Medienkompetenz und diskutiert die Vielfältigkeit der Definitionen sowie die Versuche, den Begriff in verschiedene Dimensionen zu zerlegen. Die unterschiedlichen Dimensionen der einzelnen Segmente (z.B. analytische, reflexive und ethische Dimensionen bei der Medienkritik) werden detailliert erklärt, um ein umfassendes Bild der Komplexität des Begriffs zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Medienkompetenz, Medienbildung, Medienpädagogik, Kommunikation, Kompetenz, Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung, Definition, Diskussion, Analyse, Modelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Medienkompetenz versus Medienbildung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Verhältnis zwischen Medienkompetenz und Medienbildung und analysiert verschiedene Lösungsansätze zur anhaltenden Debatte um die beiden Begriffe. Sie definiert die Kernbegriffe, beleuchtet deren wechselseitige Beziehung und reflektiert die Diskussion, um gegebenenfalls Entwicklungstendenzen aufzuzeigen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Medienkompetenz und Medienbildung, vergleichende Analyse beider Begriffe, Analyse verschiedener Modelle und Ansätze, Reflexion der anhaltenden Debatte und Aufzeigen möglicher Entwicklungstendenzen. Die Arbeit stützt sich auf die Ansichten verschiedener Erziehungswissenschaftler und Medienpädagogen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu Medienkompetenz und Medienbildung, ein Kapitel zum Vergleich beider Begriffe, und eine Zusammenfassung. Die Einleitung beschreibt die Problematik der Begriffe und die wissenschaftliche Diskussion. Die Kapitel zu Medienkompetenz und Medienbildung definieren die Begriffe anhand verschiedener Ansätze (z.B. Schorb und Baacke) und beleuchten deren Dimensionen (z.B. analytische, reflexive und ethische Dimensionen der Medienkritik).
Welche Modelle und Ansätze werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert verschiedene Modelle und Ansätze zur Medienkompetenz und Medienbildung, insbesondere die Modelle von Bernd Schorb und Dieter Baacke. Schorbs Modell gliedert Medienkompetenz in Wissen, Bewerten und Handeln, während Baacke die Segmente Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung unterscheidet. Die Arbeit vergleicht diese und weitere Ansätze.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Hausarbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Medienkompetenz, Medienbildung, Medienpädagogik, Kommunikation, Kompetenz, Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung, Definition, Diskussion, Analyse, Modelle.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist es, die anhaltende Debatte um die Begriffe Medienkompetenz und Medienbildung zu reflektieren und mögliche Entwicklungstendenzen aufzuzeigen. Sie soll ein besseres Verständnis des Verhältnisses und der Unterschiede zwischen diesen Begriffen liefern.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die methodische Vorgehensweise besteht in der Definition der Kernbegriffe Medienkompetenz und Medienbildung und der anschließenden Analyse ihres Verhältnisses zueinander. Durch die Analyse verschiedener Modelle und Ansätze soll die Diskussion reflektiert und ein umfassendes Bild vermittelt werden.
- Quote paper
- Elisa Bieberstedt (Author), 2012, Medienkompetenz und/oder Medienbildung – Eine Diskussion Widerwillen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/199985